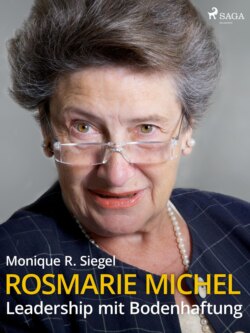Читать книгу Rosmarie Michel - Leadership mit Bodenhaftung - Monique R. Siegel - Страница 6
II
ОглавлениеKeine zu klein, um eitel zu sein
Die Eitelkeit ist das letzte Kleid, das der Mensch auszieht.
Ernst Bloch
Sie heissen zwar «Preussische Tugenden», aber sie könnten ebenso gut in Zürich entstanden sein: Geradlinigkeit, Fleiss und Sparsamkeit, Gerechtigkeitsbewusstsein und Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein und Genügsamkeit sowie Bescheidenheit – darauf halten sich auch die Zürcher etwas zugute. Das preussische Motto «Mehr sein als scheinen» hätte auch von Huldrych Zwingli (1484–1531) stammen können, der als Anführer der protestantischen Reformation einen beträchtlichen Einfluss auf die Zürcher Gesellschaft ausübte. Die Ehe- und Sittengesetze, die er neu und verschärft formulierte, enthielten auch Kleiderordnungen, und die Zürcher des frühen 16. Jahrhunderts taten gut daran, sie zu befolgen.
Die kleine Rosmarie Michel kannte diese Kleiderordnung nicht, und sie hätte sie wahrscheinlich auch für völlig überflüssig gehalten. Tochter eines Elternpaars, das viel auf Qualitätskleidung und gutes Aussehen hielt – sie erwähnt ihren Vater zum Beispiel fast nie, ohne das Adjektiv «elegant» zu gebrauchen –, hatte sie offenbar schon früh ein Gefühl für das mitbekommen, was hübsch und schmeichelnd war. Ihre Beliebtheit und ihr kindlicher Charme treffen nun auf ein gewisses Talent für Manipulation – oder sagen wir, auf ihre schon früh entwickelte Fähigkeit, zu erreichen, was sie will.
Da gibt es die Kniestrümpfe-Episode. Viele Frauen der Generation von Rosmarie Michel werden sich erinnern, wie lästig die langen Strümpfe waren, die man als Kind im Winter tragen musste – lange bevor auch kleine Mädchen ihre Beine mit wärmenden langen Hosen bekleiden durften. Die meisten haben diese unattraktiven, meist kratzenden Dinger gehasst und konnten es kaum erwarten, bis der Frühling sich als verlässlich genug erwiesen hatte, um zu Kniestrümpfen überzugehen. Wenn man die Wahl hatte, fror man lieber an ein paar Tagen und kam mit blauen Knien heim, als dass man bei der wärmenden Kratzhülle geblieben wäre.
Kinderschwestern sehen das meistens anders. Sie sind für die Gesundheit ihrer Schützlinge verantwortlich und versuchen, Leichtsinn und natürlich auch Eitelkeit früh zu bekämpfen. Rosmarie Michel zeigt sich solchen Versuchen gegenüber resistent und lösungsorientiert, wie sie es ihr ganzes Leben lang sein wird. Gleich um die Ecke vom Haus ist ein Kiosk, der von einem netten italienischen Ehepaar geführt wird. Dort stoppt die Kleine auf dem Weg zur Schule, den sie mit langen Strümpfen antritt, aber mit Kniestrümpfen beenden wird: Schnell und geschickt wechselt sie die langen Strümpfe gegen die mitgenommenen Kniestrümpfe aus und wiederholt dann diese Handlung in umgekehrter Form, kurz bevor sie wieder nach Hause kommt – dies alles unter den wohlwollenden Augen des Kiosk-Ehepaars, die der listigen Kleinen meistens noch eine Süssigkeit zustecken.
Nur einmal fällt der Kinderschwester auf, dass das Kind mit zerschundenen Knien, aber heilen langen Strümpfen nach Hause kommt ... Die Kleine kommentiert dies mit der Bemerkung, dass sie beim Turnen gestürzt sei.
Keine zu klein, um eitel zu sein, und wenn sie ihr Leben lang zu den gut gekleideten Geschäftsfrauen gehört hat, dann scheint sie dieses kleine Laster mit ins Erwachsenenleben genommen zu haben, wobei sie später natürlich auf jegliche Manipulation verzichten kann. Aber als Kind erweist sie sich als ausgesprochen clever, wenn es um die Kleidung geht.
Ein an sich grosszügiger und liebevoller Vater begleitet ab und zu die Familie beim Einkaufen – etwas, was die Mutter nervt und daher schon bald einmal aufhört. Einmal geht es um einen Schuhkauf für die zehnjährige Tochter. Das Paar, das zur Diskussion steht, kommt in aufregendem Schweinsleder-Beige und in langweiligem Braun. Die Kleine freut sich offensichtlich an dem Dunkelbeige, der Vater hingegen findet, das praktische Dunkelbraun würde es «für jeden Tag» auch tun. Wer zahlt, befiehlt bekanntlich: Man geht also mit den dunkelbraunen Schuhen nach Hause. Am nächsten Tag geht das Kind zum Schuhgeschäft und erklärt strahlend: «Also, wir würden die Schweinsledernen auch noch nehmen.» Offenbar ist dort niemand auf die Idee gekommen, diese Aussage anzuzweifeln. Ein glückliches Kind kommt nach Hause, wo die Mutter über die Cleverness ihrer Tochter lachen muss, der Vater allerdings weniger amüsiert ist. Er schimpft – doch sie darf die Schuhe behalten und wird die Heissgeliebten extra lange tragen.
Schliesslich: Eine ernsthafte Bronchitis schwächt die Kleine so sehr, dass die Familie beschliesst, sie zur Erholung nach Flims in ein Kinderheim zu schicken. Die Eltern sind beruflich besetzt und können sie nicht selbst hinbringen, also wird sie von der Kinderschwester gebracht. Die Gouvernante des Heims nimmt sie in Empfang, bringt sie in ihr Zimmer und hilft ihr beim Auspacken. Seltsamerweise scheint sie von Kinderkleidung nicht viel mitbekommen haben, denn sie fragt die Kleine: «Welches sind jetzt deine Kleider für jeden Tag und welches die Sonntagskleider?» Wer so blöd ist, muss beschwindelt werden: Das Kind wird ihren Aufenthalt hauptsächlich in den Sonntagskleidern bestreiten.
Vorher aber bricht auch hier das unheilbare Heimweh wieder aus: Ich wurde auf der Stelle todkrank, und die Leiterin des Heims musste bei mir im Zimmer schlafen, was ich gar nicht mochte. Jeden Abend sangen die Kinder unten «Guter Mond, du gehst so stille ...», und ich heulte oben die Kopfkissen voll. Dennoch muss man sich so gut um sie gekümmert haben, dass sie sich mit dem Aufenthalt aussöhnt. Später wird sie, als wache und intelligente 12-Jährige, nochmals freiwillig dorthin zurückkehren: Es ist Kriegszeit, und es gibt Lebensmittelcoupons, die abgerechnet werden müssen. Zahlen und Rechnen haben offenbar schon der Kleinen gelegen, und so bringt sie schnell und effizient Ordnung in die Abrechnungen und – ihre spätere Begabung zeigt sich hier schon deutlich – stellt den Wochen-Menüplan zusammen. Familientraining und Berufung gehen hier eine beeindruckende Verbindung ein.
Damit kein falsches Bild entsteht: Die spätere Wirtschaftsfrau wird zwar grossen Wert auf Qualität und Eleganz in Sachen Kleidung legen, aber nie wird eine Überlegung in dieser Richtung ihre Aktivitäten, die oft unter schwierigen und zum Teil gefährlichen Umständen durchgeführt werden, stören. Es ist keine ausgewachsene Eitelkeit, sondern eher ein Kokettieren mit der Eitelkeit plus Qualitätsbewusstsein. Sie wird später eine Meisterin im Kofferpacken werden, bei dem sie sich auf höchstens zwei Farbkombinationen beschränkt und wenige, aber qualitativ hochstehende Produkte, die sich alle kombinieren lassen, so in den Koffern und Taschen unterbringt, dass sie am anderen Ende der Welt fast immer unzerknüllt und sofort brauchbar wieder herauskommen. Sie weiss genau, was ihr steht, und hält sich daran, und da auch zu Hause der Kleiderschrank sehr gut organisiert ist, sind Garderobenfragen kein Thema. Gesegnet mit einer wunderbaren Haarqualität, kann ihr auch der afrikanische Coiffeur nichts anhaben – sie wird also für ihre ausgedehnte Reisetätigkeit in dieser Hinsicht ideale Voraussetzungen mitbringen.
Wie entsteht «Leadership»? Dieses Buch wird kein Rezeptbuch sein, kein «How to»-Handbuch, das eine Frage wie «Wie werde ich ein Leader?» beantwortet. Aber es versucht, Bausteine zu diesem Führungskonzept zusammenzutragen.
Einer davon ist, neben der Verwurzelung in der Familie, ihre Geburtsstadt: Zürich ist eine Stadt, die sich selbst oft und gerne als «puritanisch» bezeichnet. Heute wird sie international häufig als «Erlebnis-Stadt» gehandelt, aber wenn sie auch auf dem Gebiet zugelegt hat, so ist der Kern des Selbstverständnisses immer noch eher die Nähe zum Puritanismus als zu irgendeiner «Szene». Die Puritaner des englischen 17 Jahrhunderts waren religiöse Fundamentalisten. Wenn wir an «puritanisch» denken, kommen uns aber in erster Linie Adjektive wie «einfach», «schmucklos» oder «bescheiden» in den Sinn. Die Zürcher Architektur zum Beispiel illustriert dies: bestes Material in den Bauten, aber so verarbeitet und geformt, dass es nicht auffällt.
Hamburger und Zürcher sind bekanntlich Fans der jeweils anderen Stadt, und der Lübecker Thomas Mann hat sich nicht umsonst in Zürich so wohlgefühlt. Die Menschen im Norden Deutschlands und die Zürcher haben viele Gemeinsamkeiten: Sie sprechen weder von Erfolgen noch von Geld; sie arbeiten gut und verlässlich; sie tun, was angesagt ist, ohne viel Aufhebens davon zu machen, und sie üben sich in Bescheidenheit oder, wie man heute auf Neudeutsch sagen würde, im understatement.
Umso mehr beeindruckt es dann, wenn eine Zürcherin ins Schwärmen gerät, wie es Rosmarie Michel tut, wann immer sie über ihre Schulzeit und die Bildung redet, die sie an ihrer Schule geniessen durfte. Neben der Erfahrung einer intakten (Gross-)Familie im puritanischen Zürich ist die Schulzeit die zweite wichtige Säule des Leadership-Fundaments.
Was war denn so besonders an dieser Schule? Die Mädchenschule, liebevoll «Töchti» genannt, auf der Hohen Promenade thront über dem Stadtkern und erlaubt den Blick in die Weite, über den See, zu den fernen Bergen, auf deren anderer Seite eine andere Welt liegt. In der Nähe gab es ein Knaben-Gymnasium, und man traf sich in den Pausen oder nach der Schule am «Pfauen», international bekannt heute durch zwei Zürcher Institutionen, das Kunsthaus und das Schauspielhaus. In der Ferne aber, also während des Unterrichts, gab es die grosse, weite Welt, auf die es die jungen Mädchen vorzubereiten galt. Die Schule bot ihnen Raum – Raum für ihr Vorstellungsvermögen, für ihre Denkschulung, für ihre Wissensaufnahme, Raum für die eigene Entwicklung wie auch für das Bewusstsein eines sozialen Gefüges:
Wir konnten uns so entwickeln, dass wir alle ein Stück Bildung mitnahmen. Es war selbstverständlich, Musik zu machen, Theater zu spielen oder über Homer zu diskutieren, aber Technik und Fragen der modernen Literatur hatten genauso ihren Platz in Curriculum und Diskussion.
Die Wissensvermittlerinnen und -vermittler waren zum Teil Koryphäen auf ihrem Gebiet, wie der Altphilologe Felix Busigny, die berühmte Literaturkritikerin Elisabeth Brock-Sulzer oder die Italienerin, die das verbindliche Grammatikbuch für ihre Sprache geschrieben hat: Luisa Alani. Aber sie dozierten nicht nur, sie waren auch Mitspielende im Theater oder machten Musik; sie scheuten sich nicht, an Schulanlässen beim Catering mitzumachen oder sogar abzuwaschen. So entstand eine Gemeinschaft, die dem eigentlichen Lernen wie auch der Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls zuträglich war.
Die Schule war Teil meines Weges, der nicht mit einer Planung, sondern mit einer Absichtserklärung begonnen hat: Der erste Aufsatz, für den ich die bestmögliche Note bekommen habe, hatte den Titel «Was möchte ich werden?» – Nun, das wusste ich ganz genau, und ich habe das offenbar auch sehr klar formuliert: entweder eine Geschäftsfrau – so nannte man damals eine Unternehmerin – oder Mutter einer Grossfamilie. Das Modell meiner Kindheit mit diesem grossfamiliären Umfeld hatte mich so beeindruckt, dass dies auch mein Modell werden sollte.
Damals offenbar schon eine Pragmatikerin, hat sie gleich eine Alternative eingebaut, und als sich abzeichnet, dass es die Grossfamilie nicht werden soll, kann die Unternehmerin auf den Wurzeln von Kindheit und den Erfahrungen der Schulzeit aufbauen:
Die Hohe Promenade war für mich wie eine zusätzliche Dimension in meinem täglichen Leben. Ich hatte bereits einen gewissen Bildungszugang in meiner Familie; man hat auch zu Hause über Kultur gesprochen – meine Eltern waren viel auf Reisen gewesen, und so war es zum Beispiel dank meinem Vater und seiner Funktion als Hoteldirektor in Luxor für uns selbstverständlich, dass wir mit den ägyptischen Bauten vertraut waren; damals war gerade auch die Tutanchamun-Maske entdeckt worden. Oder mein Vater erzählte vom ersten Flug über das Mittelmeer des Schweizer Piloten Walter Mittelholzer mit einem Doppeldecker, der ganz in der Nähe des Hotels gelandet war – sozusagen Geschichte für den täglichen Gebrauch.
Was jetzt aber in der Schule dazukam, war eine erweiterte Basis von Einsichten, warum das alles, worüber wir gesprochen hatten, so war. Wir bekamen ein vernetztes Kulturverständnis, das bei mir bis in die heutige Zeit angehalten hat. Wir lernten, den Kontext zu verstehen, in dem etwas abläuft. Wir bekamen Antworten auf solche Fragen wie «Was müssen wir ändern?» oder «Was können wir übernehmen?» und konnten so auch unser politisches Denken schulen.
Unsere Lehrkräfte waren nicht nur hoch qualifiziert, sondern auch ganzheitlich involviert, und ihr Wissen war beeindruckend. So war unser Latein- und Griechischlehrer, Felix Busigny, auch ein begnadeter Altertumsforscher, der dieses Wissen sowohl bildhaft als auch emotional zusammenfassen konnte.
Der Schulabschluss ist das Ende einer reichen Zeit, für die Rosmarie Michel ihr Leben lang dankbar sein wird. Es ist nur folgerichtig, dass ihr erstes Mandat in Bezug auf Führung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Vorsitz des «Vereins der Ehemaligen» sein wird: Für sie ist es eine Möglichkeit, sich für die umfassende Ausbildung erkenntlich zu zeigen.
Die Abschluss-Schulreise geht – eher ungewöhnlich für die damalige Zeit – ins Ausland.
Wir waren die erste Klasse, die ihre Maturareise ins Ausland machte: nach Venedig. Sechzehn hübsche junge Frauen und drei Lehrkräfte, die alle Mühe hatten, die Italiener im Zaum zu halten; Märkte, Menschen, Landschaften, Kunstwerke – was für ein Eindruck!
Wohnen sollen die wohlbehüteten jungen Damen in einem Kloster, das Gäste aufnimmt. Dagegen hat an sich niemand etwas einzuwenden; doch gibt es da ein Problem: Die zuständige Nonne informiert, dass das Kloster abends um 20.00 Uhr seine Pforten schliesst.
Man hat mich delegiert, um mit dieser Nonne zu verhandeln. Ich habe ihr erklärt, dass wir den Markusplatz unbedingt im Abendlicht studieren müssten, und gefragt, ob sie da eine Möglichkeit sähe. Die einzige Art, das zu bewerkstelligen, meinte sie, sei, dass sie dann aufbleiben müsse, bis wir nach Hause kämen. Daraufhin habe ich alle Leckereien, die die Mädchen von zu Hause mitgebracht hatten, zusammengesammelt und ihr als «Müschterli» aus der Schweiz gegeben. Sie hat dann ohne Schwierigkeiten bis Mitternacht ausgeharrt ...
Die Bereicherung solcher Erfahrungen wird ihr späteres Berufsleben prägen: In den meisten Krisen wird sie einen Weg finden – gemeinsam mit den Opponenten, wenn möglich –, und sie wird ziemlich schnell wissen, wann sie die Süssigkeiten hervorholen und wann ihre Stimme diesen sehr bestimmten Ton annehmen muss, um zum Ziel zu kommen. Nie wird sie das Mandat suchen müssen, denn immer hat sie ein Umfeld, das in ihr die Leader-Figur erkennt und ihr die Führung anträgt.
Die Schule hat für so vieles bei mir den Grundstein gelegt: Ich habe alle Grundlagen erhalten, um aufbauen, entwickeln und – ganz wichtig – geniessen zu können. Die Schönheiten dieser Welt wurden uns auf diese Weise vermittelt, wir konnten sie aufnehmen, und das wurde zu einer reichen Basis für die Zukunft.
Nachdem die schöne Zeit vorbei ist, stellt sich die Frage: «Wie geht es weiter?» Die Familie findet, die Tochter solle noch, nach bewährtem Muster, ihre Sprachkenntnisse im französischsprachigen Teil der Schweiz vertiefen. Sie soll also, so findet die Mutter, in ein welsches Pensionat geschickt werden. Da aber legt die Tochter ein Veto ein: Sie ist jetzt neunzehn Jahre alt und möchte definitiv nicht in ein Pensionat, sondern auf die renommierte Hotelfachschule in Lausanne. Fünfzehn Generationen von Hoteliers auf der väterlichen Seite lassen grüssen ... Papa ist begeistert und nimmt die Anmeldung vor, die mit dem Namen «Michel» kein Problem darstellt – schliesslich war jemand in seiner Familie Mitbegründer dieser Institution, deren Ziel es ist, Interessentinnen und Interessenten aus aller Welt aufzunehmen und sie als bestausgebildete Hoteliers dann wieder in alle Welt hinauszuschicken.
Die Heimwehkranke nimmt Abschied von der Kinderschwester, die mehr als zwanzig Jahre Teil der Familie war («Wir haben beide schrecklich geheult!»), steigt in Papas Auto und fährt mit der Familie nicht nur nach Lausanne, sondern in die Eigenständigkeit. Es ist ein Ausbrechen aus den Familienbanden, die hie und da auch zur Fessel werden konnten.
Ich habe in einem sehr bescheidenen Zimmer gewohnt, bei der Witwe eines «Chef du Gare». Dort gab es nur kaltes Wasser zum Duschen, ausser am Samstag, wenn man ein Bad nehmen durfte. Die Dame war sehr gesprächig und versuchte immer, mich in eine Unterhaltung zu verwickeln. Dann rief sie vom Flur aus: «Rosmarie, vous êtes là?», und ich antwortete jeweils: «Oui, je travaille», obwohl ich einen Roman las oder mich sonst mit etwas vergnügte. Schwierig wurde es, wenn ich das Haus verliess, denn sie wachte über die Ausgangstür. Zum Glück war das Zimmer im Parterre, und ich bin oft durchs Fenster ein- und ausgestiegen. Aber trotzdem: Wir haben einander gemocht.
Die junge Fachschulstudentin ist nicht gewillt, sich die neu erworbene Freiheit einschränken zu lassen. Die Stadt am Lac Léman hat so viel zu bieten; die Mitstudenten sind Söhne aus internationalen Hoteliersfamilien, die sich um die Studentinnen, die nur rund zehn Prozent der Klassen ausmachen, reissen. Die junge Zürcherin tanzt für ihr Leben gerne, und Lausanne hat auch auf diesem Gebiet ein grosses Angebot. Plötzlich ist sie nicht nur der Kontrolle der Familie, so liebevoll sie auch ausgeübt worden war, entronnen, sondern auch befreit von den Familienpflichten: keine Sorgen mit den Mitarbeitenden und keine Nachmittage im Geschäft, wie sie sie während ihrer Schulzeit öfter verbracht hat, sondern ausgiebiges Geniessen der Abende in charmanter Gesellschaft und eigenständige Gestaltung der Wochenenden. Sie ist eine begehrte Tänzerin, jung und voller Energie:
Ich stieg also durchs Fenster nach draussen, bin nachts nach Hause gekommen und dann schon bald wieder aufgestanden, um zum Unterricht zu gehen. Ich war gut in der Schule, egal wie wenig ich geschlafen hatte; der Unterricht fand auf Englisch oder Französisch statt. In beiden Sprachen konnte ich mich gut ausdrücken. Ich genoss die Freiheit, die selbstständige Wochengestaltung. Meine Eltern hatten zwar Verständnis dafür, dass ich diesen Heimweh-Tick hatte, aber dieses Verständnis ging nicht so weit, dass ich übers Wochenende hätte nach Hause dürfen; dies war nur in den Semesterferien erlaubt.
Natürlich hat die junge Frau aus gutem Hause ihren Eltern keine Schande gemacht ...
Bei Schulabschluss hat sie den Unterbau in einem Beruf erlernt, dessen Praxis sie bereits in der Familie erlebt hat. Sie weiss jetzt, wie man ein Hotel führt, wie die Kalkulation aussieht, wie man die Küche managt usw., aber nun muss sie dieses theoretische Wissen selbst in der Praxis anwenden, um wirklich zu wissen, worum es hier geht. Gerne möchte sie jetzt zuerst einmal einen Stage in Zürich machen, und sie beginnt ihn im Hotel Glockenhof. Die Tochter aus guter Familie ist den meisten anderen ein Dorn im Auge, ganz besonders der Gouvernante, obwohl sie genauso arbeitet wie alle anderen. Die sehr tüchtige, aber auch sehr strenge Gouvernante ist ihre Vorgesetzte, und sehr bald schon ergibt sich für die junge Stagiaire eine Gelegenheit, ihre Auffassung von Recht und Unrecht klarzumachen:
Eines Tages hat sie mir befohlen, einen schlechten Sassella mit einem guten Veltliner zu mischen, damit man den Sassella besser verkaufen konnte. Ich sagte, dass ich dies nicht tun würde – nicht zuletzt, weil der Mix von einem schlechten und einem guten Wein wiederum einen schlechten ergeben würde. Sie hat mir das nicht geglaubt und ein Riesentheater gemacht. Ich habe sie gebeten, beim Direktor zu melden, dass ich so etwas nicht tun würde, damit diese Sache nicht mir angelastet würde.
Sie hat mir einmal gesagt, ich sei die Dümmste, die ihr je begegnet sei; abgesehen davon, dass diese Bemerkung eher eine Evaluation ihrer eigenen Intelligenz war, habe ich dann erfahren, dass ich die Einzige war, die die ganzen sechs Monate Stage ausgehalten hat; meine Vorgängerinnen hatten immer schon viel früher das Handtuch geworfen.
Das wäre allerdings in meinem Fall wohl nicht gut gegangen; bei mir zu Hause hat man gesagt: «Du spielst dann bitte nicht ‹verwöhnte Tochter›, sondern machst alles, was angeordnet wird. Wir möchten keine Klagen hören.» So habe ich von morgens 6.00 bis abends 10.00 Uhr gearbeitet, dann nach Hause unter die Dusche und danach häufig noch ausgegangen – und dies für einen Monatslohn von Fr. 180.–.
Auch diese Episode in ihrem Leben geht zu Ende, und – Heimweh hin oder her – der Wunsch, eigene Erfahrungen in einem anderen Land zu machen, wird immer stärker. Nach zwei Jahren, in denen sie im mütterlichen Geschäft gearbeitet und ihren ersten echten Liebeskummer durchlebt hat, ist es so weit: Die Wahl fällt auf London und auf eines der weltbesten Hotels, das Dorchester. Dort ist ein Freund des Vaters Direktor, dort wird sie als Trainee engagiert, und dort vollendet sie, ohne es zu wissen, den letzten Abschnitt der Vorbereitungen auf die Aufgaben, die auf sie warten.
Wenn die 25-Jährige nach Zürich zurückkommt, wird sie gerüstet sein für das Leben, denn es gibt keine bessere Lebensschulung als ein Hotel.