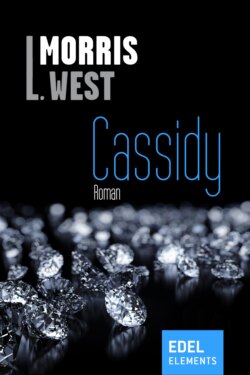Читать книгу Cassidy - Morris L. West - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеCassidys Arzt, ein weltmännischer grauhaariger Herr Mitte Fünfzig, begrüßte mich kurz, bat mich zu warten und ging dann hinaus, um sich mit dem zuständigen Arzt des Krankenhauses zu besprechen. Eine halbe Stunde später kam er zurück und ersuchte mich, im Ärztezimmer eine Tasse Kaffee mit ihm zu trinken. Er bekundete sein Beileid – eine Reihe nichtssagender Worte.
»… Diese plötzlichen Zusammenbrüche treten bei Patienten im letzten Stadium nicht selten auf. Offen gesagt, ich bin überrascht, daß der Mann noch so lange auf den Beinen geblieben ist. Er war von Metastasen förmlich durchsetzt. Die Leber- und Nierenfunktion war auf ein Minimum zurückgegangen. Ich würde sagen, für ihn war es eine Erlösung … Hinsichtlich des Totenscheins bestehen keine Probleme. Ich habe alle Röntgenaufnahmen und die Berichte von Sloan-Kettering gesehen. Ich habe ihn lange genug behandelt, um den Schein ohne Bedenken auszustellen. Sie können ihn draußen abholen, bevor Sie gehen, und gleichzeitig die Übernahme seiner persönlichen Habe bescheinigen … Er sagte mir, Sie seien sein Testamentsvollstrecker. Ich nehme an, Sie werden die Regierung unterrichten und Vorsorge für die Beisetzungsfeierlichkeiten treffen … Soviel ich weiß, haben Sie Marian nie kennengelernt … Ich werde ihr die Nachricht übermitteln. Sie ist natürlich darauf vorbereitet, aber sie wird jemanden brauchen, der ihr die Hand hält. Sie und Cassidy waren sehr eng befreundet, sehr eng … Schön, wenn es sonst nichts mehr gibt, Mr. Gregory, mache ich mich auf den Weg. Hier ist meine Karte, falls es noch irgendwelche Rückfragen gibt, was ich jedoch nicht annehme. Mein Beileid auch an Ihre Frau. Versuchen Sie ihr zu erklären, daß es eine Erlösung war … Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Doktor.«
Und gute Nacht auch dir, Charles Parnell Cassidy, der du jetzt kalt und bleich auf der Totenbahre liegst … Jetzt bin ich der Hüter dessen, was man deine Hinterlassenschaft nennt: deiner Frau, deiner Tochter, der Enkelkinder, die du nie anerkannt hast, und aller Geheimnisse, die in jener Aktentasche verschlossen sind, die du unter meinen Schreibtisch geschoben hast …
Es war halb zwei Uhr morgens, als ich nach Hause zurückkehrte. Kaum war ich eingetreten, kam Pat mir schon entgegen. »Er ist tot, nicht wahr? Er lag schon im Sterben, als er das Haus verließ. Ich wollte bei ihm sein, aber er ließ es nicht zu!«
Ich wollte sie in die Arme nehmen, aber sie stieß mich von sich. »Rühr mich nicht an! Noch nicht … Bitte, Martin!«
Ich war verblüfft. In all den Jahren unserer Ehe hatte keiner von uns jemals eine Liebkosung des anderen zurückgewiesen. Dann beschlich mich plötzlich eine unerklärliche Angst. Es war, als ob sich Cassidys unversöhnlicher Geist im Körper seiner Tochter verschanzt hätte und mich aus ihren tränenlosen Augen und ihren zusammengekniffenen, blassen Lippen zur Rechenschaft zog. Diesmal jedoch war ich nicht in der Lage zu kämpfen. Ich fand, daß wir beide jetzt einen Drink gebrauchen konnten.
Sie goß mir einen steifen Whiskey ein und sich selbst ein Glas Mineralwasser. Wir tranken uns nicht zu. Der Whiskey brannte mir in der Kehle. Dann äußerte Pat eine Entschuldigung, die so unpersönlich und reserviert klang, daß sie mehr schmerzte als die Zurückweisung.
»Ich will dich nicht verletzen, Martin. Wirklich nicht. Ich liebe dich, aber das gehört jetzt nicht hierher … Ich fühle mich von dir bedroht …«
»Das glaubst du doch selbst nicht!«
»Es ist aber so. Heute abend beim Essen hast du dich ehrlich bemüht, zivilisiert und mitfühlend zu sein, aber du warst genauso unnachgiebig wie mein Vater. Ich glaubte, einem Kampf auf Leben und Tod zwischen zwei Besessenen zuzuschauen.«
»Und aus diesem Grund kannst du nicht ertragen, daß ich dich berühre? – Du gibst mir die Schuld am Tod deines Vaters?«
»Nein, es ist etwas anderes.« Sie sprach in monotonem Tonfall weiter. »Ich komme mir wie ein Objekt vor, das ewig zwischen euch beiden hin- und hergeschoben wird. Ich halte es nicht mehr aus.«
»Liebling, bitte! Das bist nicht du. Hier spricht eine Frau, die unter Schock steht. Noch vor zwei Stunden war dein Vater am Leben. Jetzt ist er tot. Er starb neben mir im Auto – und ich konnte nichts anderes tun, als schneller zu fahren … Jetzt muß ich alles Notwendige veranlassen, damit seine Kollegen verständigt werden. Das hilft mir, aber du mußt dir von mir helfen lassen. Schließ dich nicht ein. Du brauchst …«
»Ich brauche gar nichts – außer meinen eigenen Freiraum.«
»Den hast du doch … du hast ihn immer gehabt.«
»Ich weiß.« Die Worte klangen irgendwie abschließend. »Ich mache mir Sorgen um Mutter. Sie darf nicht aus der Zeitung davon erfahren.«
»Ich werde gleich morgen früh unsere Botschaft in Paris anrufen. Sie wird versuchen, Mutter durch die französische Polizei ausfindig machen zu lassen … Warum gehst du nicht ins Bett? Ich komme hinauf, mummle dich ein und gebe dir eine Schlaftablette.«
»Mach dir um mich keine Sorgen. Du hast jetzt genug um die Ohren. Versuch nur, mich nicht zu sehr zu hassen.« Ich streckte meinen Arm aus, um sie zu einem Gutenachtkuß an mich zu ziehen. Sie berührte meine Handfläche ganz leicht mit ihren Fingerspitzen und ging. Ich machte keine Anstalten, sie zum Bleiben zu bewegen. Ich war froh, allein zu sein und mich gegen das Neue zu wappnen, das in mein Haus eingezogen war.
Ich schloß mich in mein Arbeitszimmer ein und telefonierte mit Sydney, Australien. Cassidys Amtsnachfolger, der Stellvertretende Premierminister, war gerade beim Mittagessen. Seine Sekretärin wollte ihn nicht stören. Ein paar unmißverständliche Worte überzeugten sie, daß sie es doch tun solle. Ich wurde mit dem Speisesaal des Kabinetts verbunden. Der Vizepremier war fassungslos:
»Tot! Ich kann es nicht glauben! Mein Gott, das ist ja schrecklich! Es hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt passieren können. Wir haben Kabinettsferien. Einige meiner Minister befinden sich im Ausland, die anderen sind auf Urlaub. Wir erwarten zwei Gerichtsverfahren gegen Beamte des öffentlichen Dienstes im März. Warum, in Gottes Namen, hat uns Cassidy nicht wissen lassen, daß er krank war! Aber das ist jetzt unser Problem. Wir werden schon fertig damit. Ich werde unseren Vertreter in London anrufen und veranlassen, daß er sich um die protokollarischen Angelegenheiten kümmert – Hof, Parlament, die Dienststellen des Commonwealth, die Presse – und natürlich um die Überführung des Toten nach Australien. Wenn es irgend etwas gibt, das er für Mrs. Cassidy oder Ihre Familie tun kann, wenden Sie sich an ihn. Hat Cassidy übrigens irgendwelche Regierungsunterlagen bei Ihnen hinterlassen – dienstliche Korrespondenz, Akten oder so etwas?«
Meine Antwort war ehrlich, wenn auch unvollständig.
»Ich bin der Testamentsvollstrecker, aber ich habe das Dokument noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Es wird einige Tage dauern, bis ich feststellen kann, wo und wie seine Unterlagen aufbewahrt worden sind. Dann werden die üblichen Nachforschungen beginnen. Falls ich auf irgendwelche Regierungsunterlagen stoße, werde ich es Sie wissen lassen – außer, natürlich, es findet sich etwas Besonderes, das sofortige Bearbeitung erfordert.«
»Wissen Sie, wo solches Material zu finden sein könnte, Mr. Gregory?«
»Um Himmels willen! Bei uns ist es jetzt zwei Uhr morgens. Cassidy ist erst vor drei Stunden gestorben. Meine Frau hat einen Schock erlitten. Ich habe viel zu tun. Eine Suche nach Akten ist das letzte, woran ich jetzt denken kann!«
»Verzeihen Sie, Mr. Gregory.« Der Stellvertretende Premierminister lenkte plötzlich ein. »Auch ich bin schockiert und spreche ganz unvernünftig. Meine Leute und ich werden uns sicher mit Ihnen noch unterhalten müssen; deshalb seien Sie bitte so freundlich, mir die Telefonnummern Ihrer Wohnung und Ihres Büros zu geben.«
Ich nannte sie ihm. Er dankte mir hastig und legte auf. Ich hob Cassidys Aktentasche auf, legte sie auf den Schreibtisch und stellte die Kombination nach Tag, Monat und Jahr von Pats Geburt ein. Ich war schon im Begriff, das Schloß zu öffnen, als mir ein neuer Gedanke kam.
Cassidy war eine bedeutende Persönlichkeit gewesen. Er hatte weder im privaten noch im öffentlichen Leben je etwas hergeschenkt. Deshalb würden alle möglichen Leute ein Interesse an seinen Papieren und an mir als ihrem rechtmäßigen Verwalter haben. Diejenigen, die sich bedroht fühlten, konnten ebensogut auch mich, oder meine Familie, in Gefahr bringen. Wer auf Macht oder Profit aus war, konnte in mir den Hüter eines wunderwirkenden Talismans sehen.
Und dann, bevor ich auch nur eine einzige Zeile überflogen hatte, erkannte ich das wahre Wesen der List, die Cassidy mir gegenüber angewendet hatte. Ich war gesetzlich verpflichtet, alles zu ordnen, was er in einem wilden Durcheinander zurückgelassen hatte. Für alle Schulden, die er nicht bezahlt hatte, würde ich aufkommen müssen. Alle Geheimnisse, die er hatte, würde ich unter dem Deckmantel rechtlicher Schweigepflicht bewahren müssen. Die Freunde, die er hatte, würden sich um Schutz an mich wenden. Früher oder später würden seine Feinde kommen und an meine Tür klopfen. In einem kurzen, verrückten Augenblick sah ich ihn als häßlichen Gnom auf dem Deckel der Aktentasche sitzen und mich mit einem weiteren Zitat aus dem Cassidyschen Evangelium verspotten:
»Die Tugend hat ihren eigenen Lohn: Hungerrationen und einen nackten Hintern! Heb jetzt den Deckel auf, Sonnyboy, und schau dir Charlie Cassidys Schlaraffenland an!«
Und das tat ich. Ich öffnete die Aktentasche und fand sie angefüllt mit Mikrofilmkassetten, die laufend durchnummeriert und mit Inhaltsangaben versehen waren. Oben auf den Kassetten lag ein dicker Umschlag mit Cassidys Testament und drei Treuhandverträgen. Außerdem befand sich darin ein an mich adressierter handgeschriebener Brief:
»… Was das Testament angeht, so mußt sogar Du, Martin der Selbstgerechte, mir beipflichten, daß es sich um ein ausgewogenes und großzügiges Dokument handelt. Zunächst die üblichen Gaben an die Dienerschaft und an alte Angestellte, dann vier Millionen in verschiedenen Vermögenswerten für meine Tochter und ihre Nachkommenschaft. Auch das dürfte für meinen Testamentsvollstrecker kein Problem darstellen. Die Vermögenswerte entsprechen dem Wert vom 31. Dezember letzten Jahres. Die Urkunden befinden sich in der Zentrale meiner Bank. Geld für Steuerzahlungen und andere laufende Verbindlichkeiten liegt bereit.
Dann kommen die Stiftungen, die Dir keine Arbeit abfordern, sondern lediglich Kenntnis der Dokumente. Da ist die Clare-Cassidy-Stiftung, die meine Frau zu ihren Lebzeiten in der Weise versorgt, an die ich sie gewöhnt habe und die nach ihrem Tod auf die Innere Mission übergeht. Die Gemälde-Dotation umfaßt meine eigene Kunstsammlung – übrigens keine schlechte, wenn man bedenkt, daß ich als junger Mann vom Lande die ersten Bilder auf einer Pralinenschachtel gesehen habe – und einen hübschen Jahresbetrag für künftige Neuerwerbungen. Ich bin kein Paul Getty, aber schlecht reden wird man auch über mich nicht, besonders wenn man sieht, welchen Betrag ich für die ärztliche Versorgung behinderter Kinder und ihre Weiterbildung ausgesetzt habe.
Alles zusammen beläuft sich auf runde zehn Millionen, was etwa der Summe entspricht, die meine Anhänger von mir erwarten und für die sie mich nach meinem Tode loben werden. Es kommt nur darauf an, reich genug zu sein, so daß die Leute wissen, daß man es zu etwas gebracht hat – aber nicht stinkreich, dann bleibt es ihnen im Halse stecken. Und wenn Du findest, daß ich mich noch aus dem Grab sehr um meinen Ruf besorgt zeige, so hast Du recht! Wer will schon auf Ewigkeit der Schande preisgegeben sein!
Aber da Politiker immer niederträchtig sind, habe ich schon vor langer Zeit beschlossen, mich damit abzufinden und, wenn möglich, Profit daraus zu ziehen. Deshalb begann ich die kleine Sammlung, die Du jetzt vor Dir hast. Sie sieht aus wie ein Sammelsurium von Briefen, Dokumenten, Tagebucheintragungen, Rechnungen, Todesanzeigen, Ausschnitten aus Telefongesprächen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine systematische Übersicht über das Leben, die Zeit und die offiziell nicht bekannten Amusements von Charles Parnell Cassidy. Bevor Du Dich jedoch genauer damit befaßt, möchte ich Dich aus Gründen der Fairneß warnen. Alles darin enthaltene Material ist gefährlich, einiges davon tödlich. Deshalb schlage ich Dir drei Möglichkeiten der Vorgehensweise vor.
Die erste ist, daß Du Dich dieses Materials gewinnbringend entledigst. Du übergibst es zu treuen Händen der Nordfinanz-Bank in Zürich zu Händen eines gewissen Mr. Marius Melville. Du wirst dann nichts mehr davon hören, und die Bank wird Dir sofort fünf Millionen US-Dollar gutschreiben, was dem Preis entspricht, den ich mit Mr. Melville vereinbart habe, falls ich mich jemals entschließen sollte, die Unterlagen zu verkaufen.
Dieses Arrangement hat nur einen einzigen Haken: Es überträgt Mr. Melville außerordentlich viel Macht, und da ich nicht mehr bin, würde er nicht zögern, davon Gebrauch zu machen. Wenn Du ihm je begegnest, bezeige ihm Respekt. Er verdient ihn. Und vergiß nie, daß er, während er eisern zu seinen Freunden hält, rücksichtslos wie Caligula vorgeht, wenn es sich um seine Feinde handelt.
Die zweite Möglichkeit ist die, das gesamte Material dem Justizminister des Bundesstaates New South Wales zu übergeben. Er wird Dir dafür nichts zahlen. Er wird Dir nicht einmal besonders gewogen sein, wenn er erst gesehen hat, um was für Unterlagen es sich handelt! Er wird die ganze Sammlung seinen Mitarbeitern zur ›Verifizierung und Veranschlagung‹ weiterreichen. Man kann es auch so ausdrücken: Er wird sich glücklich schätzen, auf diese Weise das ganze Material loszuwerden. Dann, nach allerlei Aufregungen und Indiskretionen der Presse und dem Ruf nach noch einer Royal Commission, ist alles ausgestanden. Teile des Materials werden verschwinden, Schlüsseldokumente gehen verloren, bis der gesamte Zündstoff verschwunden ist. Du brauchst Dir natürlich keinerlei Sorgen zu machen. Du bleibst Martin der Rechtschaffene und schläfst den Schlaf der Gerechten, mit der Quittung für eine mißlungene Gegendarstellung unter dem Kopfkissen.
Schließlich hast Du noch die Wahl, die Unterlagen persönlich zu prüfen und selbst zu entscheiden, ob Du sie verwenden oder vernichten willst. Dann sitzt Du am längeren Hebel – wenn Du es willst. Du wirst reich sein – falls es Dir darauf ankommt. Allerdings wirst Du dann auch die Zielscheibe für jeden sein, der Angst hat vor dem, was ich über ihn weiß – und es gibt da eine lange Liste mit vielen berühmten Namen. Eine interessante Situation, nicht wahr? Schade, daß ich nicht mehr hiersein werde, um zu erfahren, wie Du Dich entschließt, aber vielleicht wird mir der Allmächtige noch einen Blick zurück gönnen, bevor Er mich in den Fünften Kreis der Hölle hinabstößt. Warum den Fünften? Ich gebe Dir Dantes Antwort:
Lo buon maestro disse: Figlio or vedi
L’anime di color che vinse l’ira …
Das bin ich, und das bist Du, Sonnyboy:
›Die Seelen derer, die der Zorn besiegte.‹
Du hast es nie gewußt, und ich habe fünfzehn Jahre gebraucht, um Dir zu sagen, daß Du der Sohn warst, den ich mir immer gewünscht und nie bekommen habe. Wie jeder Vater seinen Erstgeborenen wollte ich Dich nach meinem eigenen Abbild prägen oder wenigstens zu einem geläuterten Ebenbild meiner selbst machen. Aber Du hast dagegen rebelliert. Du wolltest um jeden Preis eigenständig sein – und uns allen kam das teuer zu stehen. Als wir uns das erstemal stritten, dachte ich, Du würdest über mich herfallen. Dann haben wir uns alle geküßt und versöhnt und uns jeweils mit bösen Hintergedanken zufriedengegeben – so wie es die Iren gern tun, wo immer sie leben.
Statt dessen bin ich dir zum Opfer gefallen. Ich verlor meine Tochter. Ich verlor meine Frau. Ich verlor alle Freude an meinen Enkelkindern. Schließlich haßte ich den Mann, den ich wie einen Sohn lieben wollte. Meine einzige Genugtuung war die Tatsache, daß ich auch in Deinen Kelch etwas Gift hineintropfen ließ. Albern, nicht wahr – aber so ist der Mensch nun einmal. Es wird eine Zeit kommen, wir beide wissen das, da werden sich die Dinge so weit entwickelt haben, daß man nichts mehr rückgängig machen kann, da wird die Liebe verdorrt sein und das Herz sich verhärtet haben. Aus diesem Grunde habe ich Dich aus meinem Testament herausgeschnitten und so gewissermaßen zum Ebenbild der schlechtesten Seite meiner Selbst gemacht.
Das ist noch ein Grund, weshalb ich nicht bereit bin, die letzten schlimmen Tage über mich ergehen zu lassen. Marians Arzt tritt für ein schmerzloses und sauberes Ausscheiden aus diesem Leben ein. Er hat mir eine Pille gegeben, so daß ich meinem Leben selbst ein Ende setzen kann, bevor es zu schwer wird, und er wird den Totenschein unterschreiben, ohne mit der Wimper zu zucken.
Was gibt es sonst noch zu sagen? Alles übrige ist Klischee.
Moriturus te salutat …
Charles«
Plötzlich kam angesichts der ganzen Sinnlosigkeit dieses üblen Scherzes der Zorn in mir hoch. Ich ging mit dem Brief in der Faust hinauf und warf ihn Pat hin, die schlaflos in den Kissen lag und zur Decke starrte.
»Lies das!« sagte ich schroff. »Lies es und sag mir, welches der beiden wilden Tiere den Kampf gewonnen hat.« Dann ging ich hinaus und kehrte in mein Arbeitszimmer zurück. Ich goß mir ein halbes Glas Whiskey ein, bekam den ersten Schluck in die falsche Kehle und stürzte ins Badezimmer, um mich zu übergeben.
Als ich schweißgebadet ins Schlafzimmer zurückkam, erwartete Pat mich. Sie streckte mir die Hände entgegen; ich ergriff sie dankbar. Sie sagte:
»Ich möchte dich um etwas ganz Besonderes bitten, Martin. Ich möchte, daß du zusammen mit mir für sein Seelenheil ein Gebet sprichst.«
Mir war jetzt nicht nach Beten zumute. Sie wußte es, aber sie sprach leise weiter.
»Er zitierte oft ein altes Sprichwort. Er sagte, es sei gälisch. ›Ein Wolf muß in seiner eigenen Haut sterben.‹ Und genau das hat er getan. Ich wünschte, ich könnte um ihn weinen. Ich kann es nicht. Aber ich schulde ihm wenigstens ein Gebet. Weißt du, er suchte Vergebung, aber er war zu stolz, darum zu bitten. Deshalb nahm er die Todespille. Er wollte uns nicht mit einer Fürsorge belasten, die er seiner Meinung nach nicht verdiente. Kannst du das glauben? Willst du versuchen, es zu glauben, uns beiden zuliebe?«
»Ich würde es gerne glauben. Aber was soll diese – diese Sammlung, die er hinterlassen hat und die mich reich, einflußreich machen, aber mich auch töten kann? Es klingt wie die Äpfel von Sodom, die im Mund zu Staub zerfallen.«
»Ich glaube, es ist etwas anderes, ein Gefallen, den man ihm tun muß. Ich glaube nicht, daß man ein Leben wie seins in einem Testament und drei Treuhandverträgen zusammenfassen kann. Es muß noch andere unbezahlte Schulden geben, Verpflichtungen irgendeiner Art. Er konnte dich nicht direkt bitten, deshalb hat er dich in seinem Brief anzustacheln versucht, ihm zu helfen.«
»Vielleicht sollten wir zwei Gebete sprechen – eines für ihn und eins, auf daß er uns nicht noch einmal einen miesen Streich spielt.«
Sie kramte in der Nachttischschublade und brachte ein altes Gebetbuch zum Vorschein, das sie als Mädchen benutzt hatte. Wir sprachen ein Vaterunser und ein Ave Maria und das De profundis, gingen ins Bett, liebten uns auf eine merkwürdige, flüchtige Art und schliefen dann getrennt und gefühllos ein wie Marmorfiguren auf dem Grabmal in einer Kathedrale.
Ich erwachte noch vor Tagesanbruch aus einem merkwürdigen Alptraum, in dem Leprechaun Cassidy, die Hände voller Dollarnoten, auf unserer Marmorplatte zu den Tönen von Strawinskys »Feuervogel« einen wilden Tanz aufführte.