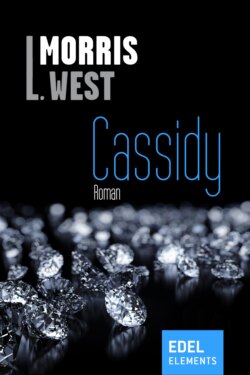Читать книгу Cassidy - Morris L. West - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеCharles Parnell Cassidys Empfang in der Heimat war kurz, trübe und ironisch.
Während wir Passagiere im Flugzeug sitzen blieben und darauf warteten, mit einem Insektenvertilgungsmittel besprüht zu werden, wurden Cassidys sterbliche Überreste aus dem Laderaum gehoben, in eine schwarze, fensterlose Limousine geschoben und rasch zur Leichenhalle eines Bestattungsinstituts gefahren. Von dort sollten sie am Morgen des Begräbnisses zur St. Mary’s Cathedral gebracht werden. Der Protokollbeamte, der mich abholte, erklärte, warum alles so schnell abgewickelt werden müsse:
»Es ist ein Werktag. Die Polizei möchte vermeiden, daß sich während der morgendlichen Stoßzeit Menschenmengen am Flugplatz und an den Zubringerstraßen zur Stadt versammeln. Der Premier – gestern hat er den Amtseid abgelegt – meinte, wir sollten dem Staatsbegräbnis nicht die Feierlichkeit nehmen … Er war überzeugt, daß Sie das verstehen würden. Er möchte gern mit Ihnen heute abend im Parliament House zu Abend essen, um sieben Uhr dreißig. Der Justizminister wird auch dort sein. Sein Name ist Loomis. Um sieben Uhr zwanzig wird Sie ein Wagen im Hotel abholen. Wir haben im Town House für Sie reserviert. Ich habe die Suite überprüft. Sie ist sehr hübsch … Das Begräbnis findet morgen statt. Die Feierlichkeiten beginnen um zehn Uhr mit einem Requiem in der Kathedrale … Hier ist ein Zeitplan und eine Liste der Würdenträger … Falls Sie noch etwas brauchen …«
Nach einem vierundzwanzigstündigen Flug, hohläugig und nach Übermüdung riechend, wollte ich nichts weiter, als mich rasieren, ein heißes Bad nehmen und schlafen. Der Schlaf mußte jedoch noch etwas warten. Ich wollte nämlich so schnell wie möglich Cassidys Aktentasche loswerden. Sobald ich mich gebadet und umgezogen hatte, fuhr ich deshalb mit einem Taxi in die Stadt und meldete mich bei der Banque de Paris, unserem Hauptgeschäftspartner in Australien.
Der Direktor, Paul Henri Langlois, war ein alter Freund von mir. Wir tranken Kaffee und tauschten Erinnerungen aus. Er stellte mir ein großes Schließfach zur Verfügung, ein Büro sowie den Zugang zu seinem Mikrofiche-Leseapparat und die Dienstleistungen einer mehrsprachigen Sekretärin. Dann fuhr ich, inzwischen völlig erschöpft, ins Hotel zurück, blockierte das Telefon bis fünf am nächsten Morgen und ließ mich ins Bett fallen. Um halb sechs klopfte es an der Tür, und ein Page vom Empfang übergab mir einen versiegelten Umschlag, der, wie der Junge mir sagte, soeben durch Kurier überbracht worden sei. Das Kuvert enthielt einen handgeschriebenen Brief, verfaßt auf dem Papier des Melmar Marquis.
»Lieber Martin G. – Hoffentlich sind Sie gut untergebracht. Es war klug von Ihnen, Ihre Papiere bei einer ausländischen Bank zu deponieren. Genießen Sie Ihr Dinner heute abend. Seien Sie vor Loomis auf der Hut. Er ist ein Cassidy-Mann und wird unter allen Umständen wissen wollen, wo sich die Unterlagen befinden. Mr. Melville hat per Fernschreiben seine besten Wünsche übermittelt. Die meinen kommen mit diesem Brief. Rufen Sie mich an, wenn Ihnen danach zumute ist. Beste Grüße – Laura L.«
Bei Licht besehen, war es eine finstere Botschaft. Sie sagte mir, daß ich genau überwacht wurde, meine künftigen Bewegungen festgehalten würden und daß ein Minister – dazu noch einer mit großem Einfluß – eventuell auf der Gegenseite stand. Anders gelesen, wurde der Brief jedoch zu einem Bekenntnis der Sorge, zu einer Freundschaftsbekundung. Ich muß ehrlich sein: So wollte ich den Inhalt dieser Nachricht verstehen. Zwanzigtausend Kilometer von Frau und Kindern entfernt, ein Fremder in meiner eigenen Heimat, der Überbringer schlechter Nachrichten an Menschen, denen ich noch nie begegnet war, wollte ich mich umsorgt fühlen und mich ablenken, auch wenn die Ablenkung eine Falle und die Sorge eine arglistige Täuschung war.
Dieser Wunsch war so stark, daß ich mich an den Schreibtisch setzte und eine freundliche Empfangsbescheinigung an Laura Larsen schrieb. Dann gewann doch die instinktive Vorsicht des Rechtsanwalts in mir. Ich zerriß den Brief in kleine Fetzen und warf sie in den Papierkorb. Der Ärger über mich selbst verschaffte mir wieder einen klaren Kopf. Ich erinnerte mich an die alten Lektionen aus dem Dschungelkrieg: Im Dickicht lag der Hinterhalt; in den Bäumen saßen Scharfschützen; die Dschungelpfade waren voller Tigerfallen, die Lichtungen vermint; ein unvorsichtiger Schritt, und man war ein toter Mann. Plötzlich überfiel mich jener höchst primitive Schrecken, die Panik des einsamen Wanderers, der sich in unbekanntem Gelände verirrt hat.
Meine Arbeit für Cassidy und meine spätere Tätigkeit auf den Geldmärkten der Welt hatten mich bittere Erfahrungen über die Wurzeln der Macht machen lassen: wie tief sie in die Erde reichen, wie weit und wie verzweigt sie sich über Grenzen erstrecken, quer durch Familien und soziale Schichten, und das alles trotz der scheinbaren Absicherung durch Verträge und internationale Bestimmungen. »Ein Bär hustet am Nordpol« – so lautet ein altes Sprichwort –, »und ein Mensch stirbt in Peking.« Die Entscheidung eines Aufsichtsrates in Detroit konnte die Wirtschaft eines südamerikanischen Staates ruinieren. Ein Gerücht, das in Delhi in Umlauf gesetzt wurde, konnte einen Mann in Delaware töten. Ich kannte einmal einen libanesischen Bankier, Treuhänder eines Millionenvermögens, das Nomadenstämmen gehörte, den ein Öl-Mann in Texas in den Bankrott trieb, nur um sich an ihm wegen einer Frau zu rächen.
Und noch eine Lektion hatte ich gelernt: Niemand ist unverwundbar – keine Nonne in ihrer Zelle, kein Tyrann inmitten seiner Legionen, kein Säulenheiliger auf seiner Säule inmitten der Wüste. Die Nonne kann durch ihre Einsamkeit verführbar werden, der Tyrann wird vielleicht von seiner Leibwache umgebracht. Der Säulenheilige stürzt durch ein Erdbeben vom Podest. Und wie stand es um mich selbst, Martin Gregory? Mit Hilfe welcher Strategie und von wem erdacht, konnte ich am schnellsten beseitigt werden? Eine Frau konnte mich zu einer Torheit verleiten; erpressen konnte sie mich nicht so leicht. Ein Mann konnte mir drohen, indem er meine Familie bedrohte. Davor fürchtete ich mich mehr als vor Gewalttätigkeiten gegen mich selbst. Aber der Verräter im Inneren? Der eine, ständig drohende falsche Schritt, der mich Hals über Kopf ins Unglück stürzen konnte – wie würde man mich dazu bringen, ihn zu tun?
Ich mußte es wissen, denn von dieser Kenntnis konnte mein Leben abhängen. Ich kam mir vor wie der Wachhabende in einer alten Festungsstadt, der an den Brustwehren seine Runden dreht, die vor sich hin dösenden Wachen anstößt, auf diejenigen achtet, die zu wach sind, als daß man ihnen trauen könnte, oder zu betrunken, um gut Wache halten zu können, und der sich schließlich fragt, ob womöglich er selbst es ist, der, wissentlich oder unwissentlich, den Feind durch die Tore eingelassen hat.
Um meiner eigenen Sicherheit willen mußte ich es zugeben. Ich war immer ehrgeizig gewesen. Ich mußte immer der führende Mann auf meinem Gebiet sein, ob es klein oder groß war. Charlie Cassidy war bereit gewesen, mich zu seinem Erben zu machen, aber er wollte mich demütigen und gefügig machen, bevor er das Erbe übergab. Dieser Preis war mir zu hoch gewesen; ich wollte ihn nicht zahlen. Aber ich war damals noch nicht groß genug, stark genug, reich genug, um ihm die Stirn zu bieten. Ich konnte nicht einfach in das Empfangszimmer des Kardinals eindringen, mit der Faust auf den Tisch schlagen, wie Charlie es getan hatte, und Wählerstimmen und Patronatsrechte und die Übertragung von Ländereien in unterentwickelten Gebieten einhandeln. Ich konnte nicht – jedenfalls noch nicht – den ganzen Tag bei den alten Mietskasernen am Hafen umherbummeln und am Abend die Wählerschaft in der Kneipe an der Ecke zu einem Bier einladen …
Aber kämpfen konnte ich, und ich kämpfte, ein stiller, geschmeidiger, gelenkiger Meuchelmörder, den niemand aufhalten konnte. Ich nahm Charlie seine Tochter weg, die ich liebte, die aber auch er liebte. Ich gewährte seiner Frau Zuflucht. Ich verlangte einen Preis für ihr Leben und das Leben seiner Enkelkinder, und der Preis lautete so: »Jetzt beugst du dich vor mir, Charles Cassidy! Jetzt bettelst du und überreichst mir deine Petition auf den Knien!«
Gott weiß, daß es nicht ganz so unverblümt gefordert wurde – aber es war die Wahrheit. Ich mußte gewinnen, und wenn nicht mit Gewalt, dann durch Hinterlist und Raffinesse und mit Hilfe der geheimen Kalkulationen des Spielers. Was war denn meine augenblickliche Karriere anderes als ein täglicher Kampf, in dem ich die Devisenhändler in Hongkong übers Ohr zu hauen, den Aktienmarkt in New York vorauszuahnen, das Währungsgefälle zwischen Sydney und Tokio zu beobachten und bei Geschäftsschluß am Freitag immer noch ganz oben zu sein versuchte?
Der einzige Ort, wo ich nicht gewinnen wollte, war mein Haus mit Pat und den Kindern, mit Clare Cassidy, der alten Dame, Witwe meines toten Feindes. Dort jedoch holte mich die Ironie ein. Eine Familie im Exil verlangt einen Führer. Sie waren Kolonisten aus einer neuen Welt und brauchten ein Bollwerk gegen die Fremdartigkeit und Feindseligkeit der Alten Welt. Das lieferte ich ihnen und war stolz darauf, daß ich es konnte. Es machte mich zu einem ehrenwerten Mann, der seine Schulden bezahlte und sich um die kümmerte, die er liebte. Auch sie liebten mich, und ihre Zuneigung war warm und herzlich. Aber manchmal litt ich unter dieser Bürde. Ich wollte sie abschütteln und meine verkrampften Muskeln lockern. Ich sehnte mich nach dem Luxus der Verantwortungslosigkeit – so wie ich mich jetzt danach sehnte, in Sydney, ganz allein. Ein Dinner mit Politikern stand mir bevor und ein Begräbnis, über das man auf den Titelseiten der Zeitungen berichten würde, außerdem hatte ich ein verzweigtes Vermögen zu ordnen. Und während der ganzen Zeit hing ein Damoklesschwert über meinem Kopf.
Es waren deprimierende Gedanken, und es war gefährlich, sich ihnen allzulange hinzugeben. Ich versuchte sie zu verdrängen. Ich rasierte mich und zog mich mit besonderer Sorgfalt an; dann machte ich mich auf den Weg zum Dinner mit dem Premier und seinem Justizminister.
Der Premier gehörte zur neuen Generation: nach den genauen Angaben einer großen Werbeagentur und einer Gruppe sehr geschickter Public-Relations-Leute zugeschnitten. Er war jung, erst Anfang Vierzig, schlank, braungebrannt, hatte strahlende Augen, ein freundliches Lächeln und einen festen Handschlag – der Traum jeder jungen Mutter von einem vertrauenswürdigen Mann. Er »konnte reden«, wie Cassidy zu sagen pflegte, aber er hatte auch verschiedene Slangausdrücke auf Lager, die bei der großen Masse gut ankamen. Ich sprach ihn mit »Mr. Premier« an, was ihm sehr gefiel. Er nannte mich Martin, was mich sehr ärgerte.
Loomis, der Justizminister, war ein ganz anderer Typ, untersetzt, mit langsamer Redeweise, scharfem Blick und einem Händedruck, der sich schwammig wie ein Weißfisch anfühlte, und mit einem verstohlenen Lächeln, das um seine Mundwinkel zuckte und sich dann in den Runzeln seiner Backen verlor. Cassidy hatte ihn ernannt, also kannte er das Gesetz und die mehr als tausend Möglichkeiten, es als Machtinstrument zu benutzen. Er nannte mich Mr. Gregory, forderte mich aber auf, ihn Rafe zu nennen. Der Premier bot mir einen Drink an, den er selbst großzügig einschenkte. Dann kam er, unvermittelter, als ich erwartet hatte, zum Kern der Sache.
»Wir haben große Probleme, Martin.«
»Was für Probleme?«
»Ein Mann stirbt«, beantwortete der Justizminister meine Frage. »Er kann niemanden mehr wegen Verleumdung verklagen. Wir haben erfahren, daß die Presse nur wartet, bis Cassidy begraben ist, um dann seinen persönlichen und politischen Werdegang auf den Titelseiten groß herauszubringen.«
»Und davor fürchten Sie sich?«
»Persönlich, nein.« Die Stimme des Premiers klang etwas unsicher.
»Politisch, ja.« Der Justizminister sprach mit Nachdruck. »Charlie Cassidy hatte eine sehr einfache Philosophie: Wenn du an der Regierung bist, lebst du mit dem, was du vorfindest – mit Nutten und Drogensüchtigen und Schlägern und anständigen Allerweltsbürgern, alles zusammen. Wenn du Touristen anlocken willst, kannst du auf Callgirls und Zuhälter nicht verzichten. Wenn du eine Glücksspielindustrie willst und die Steuern, die sie dir einbringt, brauchst du Leute, die das Ganze überwachen, ebenso wie Buchmacher. Charlie hat sich davor nie gedrückt. Er hat gute Arbeit als Hüter des Friedens geleistet – und er hat den Gaunern das Geld für ihre Privilegien aus der Tasche gezogen.«
»Aber«, sagte der Premier, »in den letzten Jahren sind die Dinge außer Kontrolle geraten.«
»Was für Dinge, Mr. Premier?«
»Drogen«, sagte der Justizminister. »Und die ganze Scheiße, die damit zusammenhängt.«
»Verzeihen Sie, daß ich es erwähne, aber Sie sind doch der Mann, der die Rechtsprechung verwaltet. Was hält Sie zurück?«
»Schmutzige Wäsche«, sagte der Premier.
»Haufenweise«, sagte der Justizminister.
»Und wir fragen uns, was Sie schon haben oder noch bekommen werden, um diesen Haufen zu vergrößern.« Der Premier hatte die Initiative übernommen. »Sie gehören zur Familie. Sie sind der Testamentsvollstrecker. Alle Unterlagen Cassidys werden in Ihre Hände gelangen – wenn Sie sie nicht schon haben.« »Und wir wollen sicherstellen, daß wir sie sehen und die Presse nicht.«
»Lassen Sie mich eines ganz deutlich sagen, meine Herren.« Ich versuchte, höflich zu bleiben. »Meine Familie und ich, wir hatten uns Charles Cassidy seit Jahren entfremdet. Er kam kurz vor seinem Tod zu mir und erklärte, er habe mich zum Testamentsvollstrecker über sein Vermögen eingesetzt. Die einzigen Dokumente, die ich bis jetzt gelesen habe, sind das Testament und drei Treuhandverträge – auf den ersten Blick einfache und ganz harmlose Dokumente. Bevor ich meine Nachforschungen als Testamentsvollstrecker beginne, habe ich also keine Ahnung, was ich entdecken werde. Aber alles, was in meine Hände gelangt, ist vertraulicher Natur, bis ich gerichtlich verpflichtet werde, es vorzulegen. Ich sehe beim besten Willen nicht, wie ich Ihnen helfen kann.«
»Seien Sie sich hinsichtlich Ihrer Stellung als Testamentsvollstrecker nicht zu sicher«, sagte Loomis. Er lächelte flüchtig. »Wenn Sie Unterlagen zurückhalten, die sich auf kriminelle Angelegenheiten beziehen, kann ich Sie wegen Nichtanzeige eines schweren Delikts vor Gericht bringen …«
»Doch nicht wegen eines Delikts, das von einem Toten begangen wurde!«
»Aber wegen eines Delikts, das von den Lebenden untersucht werden muß!«
»Nur wenn Sie beweisen könnten, daß ich belastende Dokumente in der Hand habe, ihre Bedeutung kenne und sie wissentlich zurückhalte. Bitte, halten Sie mich nicht zum Narren, Mr. Loomis! Ich habe den Zeitunterschied noch nicht ganz verkraftet und für solche Scherze im Moment kein Verständnis.«
»Verzeihung!« Er entschuldigte sich sofort. »Auch ich habe einen schweren Tag hinter mir. Konnte nicht mal zum Pissen gehen, ohne über Fernsehkabel und Mikrophonanschlüsse zu stolpern. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, indem ich die ganzen Prozeduren für Sie etwas beschleunige … Ein Wort vom Minister, etwas in der Art …«
»Dafür wäre ich dankbar. Ich will mich hier nicht zu lange aufhalten. Ich möchte zurück zu meiner Frau und den Kindern.«
»Unterrichten Sie mich, sobald Sie einen Überblick über die Aktenlage haben. Wer wird in Sydney für Sie tätig werden?«
»Die alte Kanzlei: Cassidy, Carmody, Desmond & Gorman.«
»Die würde ich nicht einmal mit einer Feuerzange anfassen«, sagte der Justizminister.
»Ich auch nicht«, meinte der Premier.
»Warum nicht?« Ich war die Unschuld in Person.
»Weil«, sagte Loomis mißvergnügt, »Carmody sich an der Grenze zur Senilität befindet, Desmond zwei unserer größten Betrüger vertritt und Micky Gorman als Berater für unseren schillerndsten Presselöwen fungiert. Diese Kanzlei ist nicht gerade der sicherste Aufbewahrungsort für Ihr Material.«
»Warum nicht Standish & Waring?« Das war der Vorschlag des Premiers. »Die arbeiten mehr nach Ihrem Stil.«
»Ich habe leider keine Wahl. Sie waren für Cassidy tätig, alle Unterlagen sind bei ihnen deponiert.«
»Gehen wir essen«, sagte Loomis. »Ich habe heute das Lunch verpaßt.«
Es war offensichtlich, daß sie beide unter Streß standen und daß wir vom eigentlichen Kernpunkt der Diskussion noch weit entfernt waren. Als wir unsere Plätze bei Tisch einnahmen, sagte der Premier: »Ich weiß, es ist ein bißchen voreilig, aber haben Sie irgendeine Vorstellung, wie hoch Cassidys Vermögen sein könnte?«
»Ich habe mehr als nur eine Vorstellung, und es wird sowieso bald allgemein bekannt sein: Es gibt eine Hinterlassenschaft für seine Tochter und unsere Kinder und eine Stiftung für seine Frau, die auf die Innere Mission übergeht, sowie die Schenkung seiner Kunstsammlung an die Staatsgalerie und außerdem Zuwendungen für die Kinderkrankenhäuser. Insgesamt beläuft sich die Summe auf etwa zehn Millionen.«
»Hübsch!« meinte der Premier trocken. »Sehr hübsch.«
»Aber erträglich.« Loomis war offensichtlich erleichtert. »Er ist als reicher Mann gewählt worden. Er starb als reicher Mann. Die Innere Mission und die Kinderkrankenhäuser verdienen es, daß man sie unterstützt. Und die Kunstsammlung ist sehr wertvoll. Was die Spenden betrifft, so würde ich sagen, Charlie geht nach Rosen duftend in die Grube.« Er wandte sich wieder mir zu. »Sind Sie sicher, daß es keine anfechtbaren Vermächtnisse gibt – an Geliebte, an uneheliche Kinder, so etwas?«
»Keine.«
»Ich frage mich, was er mit dem Rest seines Vermögens gemacht hat.«
»Die Aufstellung der Vermögenswerte entspricht dem Stand vom letzten Dezember. Die Unterlagen weisen keine anderen Beträge auf.«
»Loomis stellt nur Vermutungen an.« Der Premier klang gereizt.
»Was heißt hier Vermutungen! Es ist doch nur logisch …«
»Sie sind müde, Rafe!« Aus dem Tonfall des Premiers sprach echter Zorn. »Sie reden dummes Zeug. Nichts ist logisch, solange es nicht vor Gericht bewiesen werden kann.«
Ich fand, es sei an der Zeit, den Friedensstifter zu spielen. Ich zuckte mit den Achseln und lächelte die beiden freundlich an. »Sie beide kannten Cassidy besser als ich. Er hat seit vielen Jahren an meinem Leben und dem meiner Frau keinen Anteil mehr genommen. Aber war es nicht seine Art, sich mit Geheimnissen zu umgeben und wie ein Zauberer auf einem Kinderfest Illusionen zu schaffen?«
Zum erstenmal lachte Loomis, und die Spannung löste sich.
»Sie haben natürlich recht. Das war Charlie, wie er im Buche steht.«
»Worüber machen Sie sich dann Sorgen? Es wird uns allen viel Zeit ersparen, wenn Sie offen mit mir sprechen.«
»Heben wir es uns bis zum Kaffee auf.« Der Premier warf einen verstohlenen Blick auf die Kellner, die im Hintergrund standen. »Aus diesem Lokal dringen Informationen wie durch ein Sieb hinaus. Wenn es nach mir ginge, würde das Personal aus stummen Sklaven bestehen!«
»Passen Sie auf, daß die Presse nichts von dem erfährt, was Sie da gerade gesagt haben«, murmelte Loomis verdrießlich. »Sie würde es Ihnen immer wieder vorhalten.«
Beim Kaffee kamen sie zum Kern der Sache. Sie hatten den Anstand, eine gewisse Verlegenheit zur Schau zu stellen, aber als echte Politiker kam es ihnen im Grunde nur darauf an, um jeden Preis zu überleben. Der Premier kam als erster darauf zu sprechen.
»Loomis und ich – eigentlich das ganze neue Kabinett – sind Cassidy-Leute. Er war eine große Führerpersönlichkeit. Er war frech wie ein Hochstapler und mutig wie ein Raufbold. Er erteilte klare Anweisungen, und wenn man sich an die hielt, stand man für immer unter seinem Schutz. Wenn man aber anfing, eigene Variationen auszuprobieren oder Charlie über das Warum und Wofür zu befragen, fand man sich plötzlich in einer leeren Pferdekoppel wieder, und die Presse bellte wie eine Meute Bluthunde hinter einem her … Es war Diktatur, natürlich, aber eine wohlwollende Diktatur – jedenfalls meistens!« »Aber jetzt ist der Diktator tot«, sagte Loomis, »und wir müssen uns vor der Partei und der Wählerschaft verantworten. Unsere einzige Chance zu überleben besteht darin, Cassidy die Schuld an dem zu geben, was letzten Endes seine eigene Politik war! Was halten Sie davon?«
»Ich frage mich, warum sich die Erde nicht auftut und Sie verschlingt!«
»Kann noch kommen.« Der Premier zuckte mit den Achseln.
»Aber ich verstehe noch immer nicht, was Sie von mir erwarten.«
»Ich werde es Ihnen genau sagen«, erklärte Loomis kurz und bündig. »Ich will Zugang zu allen Papieren von Cassidy haben – bis hin zur Aufstellung seines Bestands an Unterwäsche. Ich will – und ich werde Ihnen dafür eine rechtmäßige Empfangsquittung geben – alles haben, was uns möglicherweise interessieren könnte. Übergeben Sie es uns ohne Widerrede, und Sie werden die Bestätigung des Testaments doppelt so schnell erhalten. Widersetzen Sie sich, dann werden Sie noch in zehn Jahren um die Erbschaft Ihrer Frau winseln. Klar?«
»Völlig klar, Mr. Loomis.«
»Na, und was sagen Sie dazu?«
»Ich danke Ihnen für das Abendessen und das aufschlußreiche Gespräch. Wir drei sehen uns bei der Beerdigung wieder.«
Ich schob meinen Stuhl zurück und stand auf. Der Premier packte mich am Ärmel meiner Jacke.
»Bitte, Martin! Bitte, setzen Sie sich!« Er fuhr Loomis wütend an. »Um Himmels willen, Mann! Was wollen Sie denn damit erreichen?«
Loomis hob die Schultern und lächelte träge.
»Bloß Taktik. Gerichtliche Spielereien. Sie verstehen das doch, nicht wahr, Mr. Gregory? Wir müssen schließlich wissen, was für eine Art von Zeugen wir da vor uns haben.«
»Scheren Sie sich zum Teufel mit Ihrer Taktik und noch mehr mit Ihren Drohungen! Sie haben eine Minute Zeit, um die Drohung zurückzuziehen und mir endlich zu gestehen, was eigentlich los ist. Was soll ich angeblich besitzen, das Ihnen solche Furcht einjagt?«
Es trat ein langes, gespanntes Schweigen ein, bis der Premier zu Loomis sagte:
»Entschuldigen Sie sich! Sagen Sie es ihm! Wir sind nicht hierhergekommen, um uns Kämpfchen zu liefern!«
»Ich ziehe die Drohung zurück«, sagte Loomis widerwillig. »Ich garantiere eine schnelle Behandlung Ihrer Testamentsbestätigung. Was das übrige angeht, so ist folgendes unser Problem: Cassidy hatte die Schlüsselposition in diesem Bundesstaat inne und damit in gewissem Sinne die in der ganzen Nation – denn wir haben den größten Hafen und den verkehrsreichsten internationalen Flughafen. Er steuerte alles, Legales wie Illegales. Er verteilte Vergünstigungen und strich die Gewinne aus dem Drogenhandel, dem Glücksspiel, der Prostitution, aus Grundstücksgeschäften und Regierungsaufträgen ein. Wir haben es ihn gern tun lassen, weil er den Frieden sicherte und ein ehrlicher Zahlmeister war. Jeder bekam, was zugesagt worden war – Lohn oder Strafe. Die Geldbeträge wurden über sichere Wege verteilt, und man bekam immer ein paar gute Tips, wo man das Kapital außerhalb der Reichweite der Steuerbehörde anlegen konnte. Cassidy beherrschte auch einen Großteil der Juristen; Anwälte, die ihr verfügbares Kleingeld zu zwanzig Prozent irgendwo unterbringen konnten … Das Problem ist, daß nur Cassidy wußte, wie das ganze System funktionierte. Wir alle wußten, daß es Verbindungen nach Übersee gab. Es mußte sie geben, denn heißes Geld wurde exportiert, und sauberes Geld kam zurück. Aber der Aufbau dieses Netzes und die Identität der eingeschalteten Personen … darüber wußte nur Cassidy Bescheid.«
»Und Sie wollen jetzt wissen, ob diese Kenntnisse zusammen mit ihm gestorben sind.«
»Oder ob er sie an Sie weitergegeben hat«, sagte Loomis. »Und wenn er es getan hat, könnten wir vielleicht ein Geschäft daraus machen.«
»Damit Sie anfangen können, das System zu reformieren, die Korruption höheren Orts zu beseitigen, etwas in der Richtung, ja?«
»Genau«, sagte der Premier. Man konnte ihm anmerken, wie erleichtert er war. Loomis bedankte sich mit einer ironischen Ehrenbezeugung, einem zweideutigen Kompliment:
»Sie sind ein guter Mann, Charlie Brown! Cassidy muß stolz auf Sie sein, wo immer er jetzt auch sein mag. Um also die Frage einfach zu formulieren: Wieviel wissen Sie, und wieviel kostet es?«
»Es kostet nichts – denn im Augenblick weiß ich nichts.«
»Aber Ihre Nachforschungen könnten – könnten vielleicht irgend etwas ans Tageslicht bringen.«
»In welchem Falle ich angemessene Maßnahmen ergreifen werde.«
»Nämlich mir das Material überlassen.« Loomis verschwendete keine Zeit mit Höflichkeitsfloskeln.
»Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt vielleicht noch andere.«
»Sie machen sich über uns lustig!«
»Nein. Ich behaupte lediglich meine Position. Können Sie mir daraus einen Vorwurf machen? Noch vor kaum einer halben Stunde haben Sie mir erzählt, daß Cassidy in diesem Staat alles in der Hand hatte – ob legal oder illegal – und daß Sie, seine Kabinettskollegen, ihn dies gern haben tun lassen. Was sagt das über Sie aus? Und wie stehe ich da, wenn ich Ihnen Beweismaterial anvertraue?«
»Als kluger Diener des Gerichts«, sagte der Premier ganz ruhig.
Meine persönliche Meinung war, daß ich damit zum Dorftrottel würde; aber wir hatten inzwischen genügend Beleidigungen ausgetauscht, und es war an der Zeit, die Auseinandersetzung abzubrechen. Ich tat so, als überlegte ich einen Augenblick, und wandte mich dann an Loomis: »Eines haben Sie anscheinend vergessen: Ich bin seit mehr als zehn Jahren nicht mehr in Australien gewesen. Ich habe jegliches Interesse an innenpolitischen Fragen verloren. Ich könnte einen Verbrecher nicht von einem Kabinettsminister unterscheiden. Wenn Sie also Informationen aus Cassidys Akten haben wollen, müssen Sie mir wenigstens eine Liste der für mich wichtigen Personen zur Verfügung stellen. Sonst tappe ich völlig im dunkeln.«
»Ich könnte Ihnen einen Mitarbeiter zur Seite stellen.«
»Kommt gar nicht in Frage!«
Loomis und der Premier sahen sich an. Der Premier nickte. Loomis gab sich damit widerwillig zufrieden.
»Zum erstenmal an diesem Abend haben Sie angefangen, vernünftig zu reden. Ich werde Ihnen nach dem Begräbnis eine solche Liste übergeben.«
»Vielen Dank für Ihre Kooperation, Martin«, sagte der Premier.
»Vielen Dank für das Dinner, Mr. Premier.«
»Sie sind genau wie Cassidy«, sagte Loomis. »Den ganzen Abend über halten Sie einen hin, verteilen plötzlich ein paar Brocken und erwarten dann von uns, daß wir Sie einen Wohltäter nennen … Hoffentlich ist das verdammte Begräbnis morgen völlig verregnet!«
Es kam anders. Charles Parnell Cassidys Bestattung verlief wie eine erstklassige Theateraufführung. Der Generalgouverneur war da und hatte als Vertreter der Krone gegenüber dem Gouverneur des Bundesstaates den Vortritt. Der Premierminister war da und spielte hinter dem Premier nur die zweite Geige. Gewerkschaftler und Diplomaten, bekannte Sportler, die Geistlichkeit und die Presse waren erschienen, Cassidys frühere Partner und das Personal aus seiner Kanzlei und dem Haushalt. Eine Abordnung berittener Polizei fungierte als Ehrengarde, denn die Bundesstaaten Australiens besitzen keine bewaffneten Streitkräfte außer ihrer Polizei und ihren Verbrechern.
Auch von diesen waren in der Menschenmenge einige vertreten – aber nur die Erfolgreichen, deren Namen immer wieder in Untersuchungskommissionen auftauchten, doch offensichtlich niemals in den Polizeiakten. Es gab ein ganzes Sammelsurium von Einwanderergruppen – Libanesen, Italiener, Griechen, Türken, Chinesen, Vietnamesen, Iren, Angelsachsen, Holländer, Serben und Spanier –, alle fühlten sich Charlie Cassidy zu Dank verpflichtet und wollten seinen Nachfolgern zeigen, welch starke Wählerkontingente sie stellten.
Die Seelenmesse wurde auf lateinisch gehalten – »Ein Tribut«, sagte der Kardinal, »an Charles Parnell Cassidy, einen großen Lateiner.« Dann stürzte er sich in eine mit Gemeinplätzen derart vollgestopfte Lobrede, daß sich Cassidy im Grab umgedreht haben muß. Er sprach von »herausragendem Dienst an der Öffentlichkeit und Wohltätigkeit, die im verborgenen geübt wurde«, von einem »christlichen Leben, das trotz aller Versuchungen, die eine politische Laufbahn bereithält, von ihm gelebt wurde«, von einer »schillernden Persönlichkeit, in der sich der Geist außergewöhnlicher Einfachheit erhalten hat«. Er erzählte von »jenen beschaulichen Dinners, bei denen Charles Cassidy sich mir öffnete und mir von seinen Hoffnungen, Befürchtungen und von seinen Plänen für dieses unser großes Land erzählte …« Er redete und redete und redete. Was Cassidy von alldem dachte, blieb ein Geheimnis zwischen ihm und seinem Schöpfer.
Aber – ich muß ehrlich sein – diesem Geschwätz lag eine echte Gefühlsbewegung zugrunde, eine Bestätigung der Bruderschaft zwischen dem Geistlichen und dem Politiker. Sie waren seit langem Freunde gewesen und hatten sich in harten Auseinandersetzungen zusammengerauft. Beide waren sie irischer Abkunft, beide von Natur aus Absolutisten und beide in demselben Dilemma: Was auch immer die Dogmen und die Regeln vorschreiben mochten, man mußte sie zurechtbiegen, damit die sozialen Verhältnisse intakt blieben. Tat man es nicht, hatte man bald Ausschreitungen in den Straßen.
Etwa bei der Hälfte des Nekrologs versank ich in Tagträume, und mir fiel ein, was Cassidy bei seinem letzten Abendessen in meinem Haus erzählt hatte.
»Der Kardinal ist ein raffinierter alter Gauner. Er sagt mir, was ich tun soll. Ich sage ihm, was ich tun kann. Er schmollt ein bißchen vor sich hin und zitiert Augustin oder Thomas von Aquin. Ich mache einen schlechten Witz und gehe mit seinem Vertrauensvotum in der Tasche davon. Es ist nicht so groß, wie es einmal war, aber es existiert noch, ein Tauschobjekt, wie es die hartgesottenen Marxisten und die Pazifisten sein können. Im Grunde, Sonnyboy, bewundere ich Leute, die eigene Überzeugungen haben – aber sie sind bestenfalls gefährliche Werkzeuge. Das einzige, wessen ich mir ganz sicher bin, das ist, daß der Mensch eine wilde Bestie ist und man ihn nur noch mehr in Wut bringt, wenn man ihn in die Enge treibt. Man muß ihm Spielraum gewähren und sexuelle Freiheit und alle Drogen, nach denen er süchtig ist, damit er sich austoben kann, ohne andere in Gefahr zu bringen …«
Der Chor intonierte das alte Lied: »Schenke ihm ewige Ruhe, o Herr, und laß Dein Licht über ihm leuchten. Möge er in Frieden ruhn.« Dann war es plötzlich zu Ende, und ich gehörte zu den sechs Männern, die langsamen Schrittes, Cassidys Sarg auf den Schultern, den Mittelgang der Kirche hinuntergingen. Auch jetzt empfand ich keine Trauer. Erst als ich auf dem Friedhof stand, Hände schüttelte und die rituellen Dankesfloskeln für die Beileidsbezeigungen murmelte, fühlte ich ein plötzliches Aufwallen von Scham und Reue. Das war nicht alles bloßes Geschwätz und politischer Humbug. Cassidy war ein großer Mann gewesen. Er hatte eine breite Lücke hinterlassen, und die beiden Witzfiguren, mit denen ich gestern diniert hatte, waren nicht annähernd groß genug, um diese Lücke ausfüllen zu können. Auch ich war nicht groß genug. Ich war weder so gütig gewesen, ihm zu verzeihen, noch so großzügig, ihn bei seinem ersten und letzten Essen in meinem Haus auch nur zu umarmen.
In diesem Augenblick kamen mir die Tränen, und mit ihnen kam ein schreckliches Gefühl der Vereinsamung. Ich war jetzt der Fremde. Die Menschen waren freundlich, aber sie wußten nicht recht, wie sie sich gegenüber diesem Zwitter verhalten sollten, der englische Kleidung trug und britisch redete und dem die Tränen über die Wangen liefen.
Der Premier und Loomis fuhren mich ins Hotel zurück. Es war ihre Show gewesen, und sie hatten alles recht gut in Szene gesetzt. Ich dankte ihnen im Namen der Familie.
»Es war uns ein Vergnügen«, sagte Loomis mit einem Achselzucken. »Er hat einen guten Abschied verdient.« Er übergab mir einen versiegelten Umschlag. »Dies ist das Material, um das Sie gebeten haben. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.« Dann machte er mir unerwartet ein Kompliment: »Sie haben heute eine gute Vorstellung gegeben. Ich wußte gar nicht, daß Ihnen so schwer ums Herz war. Ein solcher Solo-Auftritt geht an die Nerven.«
»Morgen wird es noch schwerer werden.« Der Premier machte einen düsteren Eindruck. »Man hat uns schon vor langer Zeit gewarnt: ›Nach Cassidy die verdammte Sintflut!‹«