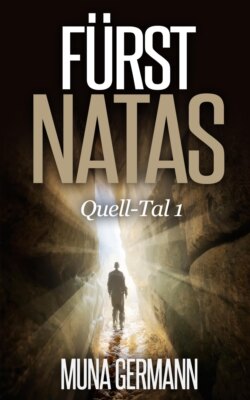Читать книгу Fürst Natas - Muna Germann - Страница 4
Kapitel 1: Im Auftrag des Bösen
Оглавление… Wenige Jahre später…
„Und du wirst sie töten“, beschloss Fürst Natas und deutete mit dem Finger auf Gabriel. Dieser nickte nur, ohne eine Miene zu verziehen. Gabriel befolgte jeden seiner Befehle – wirklich jeden! - und doch spürte Fürst Natas einen Widerstand bei diesem jungen Mann, der ihn irritierte. Der Fürst bedeutete ihm mit einer Handbewegung, dass er sich entfernen solle, um seinen Auftrag auszuführen. Gabriel verneigte sich genau so tief wie es sich gehörte und ging rückwärts durch den protzig dimensionierten Thronsaal zur hohen Flügeltür, die ihm die beiden Wachen öffneten. Der Fürst starrte ihm hinterher. Beinahe schmerzte die Sehnsucht nach diesen schmalen Hüften, den schwieligen, zernarbten Händen und den festen Lippen. Auch wenn der Junge ihm diese Nacht wieder gehören würde, so fiel es ihm schwer, ihn jetzt gehen zu lassen.
Genauso wie die Höflinge fand auch Fürstin Maagi, dass Fürst Natas seinen Blick etwas zu lange auf Gabriels kantigem Gesicht, blondem Haar und seinen Hüften hatte ruhen lassen, ein wenig zu sehr geschmachtet hatte und dass er ihn den anderen vorzog. Auch wenn niemand Gabriel um diesen Auftrag beneidete. Eine unschuldige Schäferin zu töten! Keiner am Hof glaubte wirklich an die Prophezeiung, und doch riskierte Natas niemals, dass sie sich erfüllen könnte. Dabei war keines der Halbblute gefährlich. Viel zu sehr waren diese Mischlinge damit beschäftigt zu überleben. Maagi fürchtete viel mehr all diejenigen, die Fürst Natas‘ Macht durchschauten, ihre Gedanken laut aussprachen und auführerische Flugblätter verteilten. Diejenigen, die sich lieber verbrennen, erschlagen oder zu Boden nageln ließen als ihr Knie vor dem Schattenfürsten zu beugen, der dabei war, die gesamte bekannte Welt zu unterwerfen. Nicht nur, dass die Befehle seiner Boten im ganzen Land ausgeführt wurden, sondern alle Menschen dachten wie er, selbst diejenigen, die ihn nicht kannten. Wie Gift im Trinkwasser hatten sich die Glaubenssätze des Bösen verbreitet, wie eine ansteckende Krankheit.
Maagi neigte ihren Kopf zu Natas´ Ohr und fragte: „Liebling, können wir nun speisen?“ Nur Erika hatte den Wink mit dem linken Zeigefinger bemerkt, der bedeutete, dass sie demjenigen zu folgen hatte, der eben den Raum verließ. Nichts weiter: nur folgen, beobachten und berichten. Wenn sie eingreifen durfte, zuckte Maagi mit zwei Fingern. Erika verschwand durch eine der Bedienstetentüren in der Wand, hinter einem Vorhang verborgen. Ihre nackten Füße tappten auf kaltem Stein, glatt getreten im Lauf der Jahrtausende, durch unzählige Diener, die alle dem schwarzen Fürsten und seiner Gemahlin gedient hatten. Was die beiden unsterblich jung bleiben ließ wusste niemand, doch man munkelte, ihre Bösartigkeit hielte das Alter fern.
Erikas Herrin wusste, dass sie ebenso geschickt war wie Gabriel. Erika und Gabriel waren wie Geschwister aufgewachsen in einer Welt aus Schmutz, Fußtritten und Verbitterung. In die schmalen Gassen zwischen den unendlich hohen Mietshäusern schien niemals Sonnenlicht. Selbst die Vögel schwiegen und das Unkraut war mit einer hellen Staubschicht überzogen. Sie gehörten zu einer Gruppe von Kindern, die sich tagsüber aus den Abfallhaufen ernährten, aber ansonsten nichts gemeinsam hatten mit denen, die Metall und Holz sammelten oder stahlen, um sie an die Lumpensammler zu verkaufen. Sie übten lukrativere Geschäfte aus. Im Alter von sechs Jahren brannten sie zum ersten Mal einen Laden nieder, und mit acht waren sie bereits Mörder. Niemand beachtete kleine Kinder. Man lächelte ihnen zu, vertraute auf ihre Unschuld, bückte sich, um ihnen die Köpfe zu tätscheln, und unerwartet stieß ein Messer vor und bohrte sich zwischen die Rippen. So einfach war das. Und Erika war froh, dass sie sich ihr Geld wie ein Junge verdienen konnte, statt sich mit Prostitution zu beschmutzen. Ja, ihrer war ein stolzerer Beruf. Gabriel und sie waren die besten gewesen. Darum lebten sie als einzige noch von der einst siebenköpfigen Gruppe.
Fehler konnten sich Leute wie sie nicht erlauben. Darum hörte sie den Atem des Mannes, der in der Nische des unterirdischen Ganges lauerte. Trotzdem stockte ihr Schritt nicht. Geschmeidig wie eine Tänzerin zog sie ihren Dolch aus dem Gewand, setzte einen Fuß vor und stieß zu. Der andere sprang ihr entgegen und rammte sich so selbst die Schneide in den Bauch. Im flackernden Licht der Fackeln sah Erika eine erstaunte Fratze, die sich verzerrte. Sein Schwert fiel klirrend zu Boden, dann griff er mit beiden Händen nach dem Messergriff in seinem Unterleib. Dabei packte er auch Erikas Hände. Sie zog die Augenbrauen hoch und stellte fest: „Sobald ich die Klinge herausziehe, stirbst du. Also sag, was du zu sagen hast.“
Er schüttelte nur stumm den Kopf, packte Erikas Hände und wollte das Messer ziehen, doch sie stemmte sich mit aller Kraft gegen ihn, stieß ihn mit dem Rücken an die Wand unter einer Fackel und hielt fest. Er war mager und seine Hände knochig. Sie blickte ihm in die Augen. Er ertrug den Schmerz tapfer, doch sie spürte keinen körperlichen Widerstand.
„Wer hat dich geschickt?“ fragte sie.
„Wer wohl?“ ächzte der Mann und schlug seinen Hinterkopf mit geschlossenen Augen gegen die feuchte unebene Wand, dass es hohl hallte. Er stöhnte und begann zu beten: „Gott im Himmel, sieh meinen Tod und erwarte meine Seele. Amen.“
„Hurensohn“, zischte Erika. „Du wirst verlöschen wie eine Kerzenflamme, und deine Seele geht nirgendwo hin. Niemand belohnt deinen sinnlosen Tod.“
„Mag sein“, erwiderte er heiser. „Aber ich habe getan, was ich konnte.“
„Und das war nicht viel, Gottesanbeter!“
„Gott segne dich und erweiche dein Herz. Kehre um und…“
Körperlich war er ihr unterlegen, doch dass er den Tod nicht fürchtete, ärgerte Erika. Sagte man nicht, die Gottesanbeter seien feige und schwach? Sie zog das Messer heraus, und er sackte nach vorne, gegen ihre Hand, die seine Schulter packte. „Scheiße“, zischte sie dann und ließ ihn in die Hocke sinken, wo sie ihn fest hielt. Sie hatte die Beherrschung verloren. Erbärmliche Folterknechtin, der Kerl starb ihr unter der Hand, ohne viel verraten zu haben. „Scheiße, Scheiße, Scheiße!“ schimpfte sie vor sich hin und ärgerte sich, dass ihre Stimme hoch wurde dabei. Dann packte sie sein Kinn, drückte seinen Hinterkopf wieder gegen die Mauer. Seine geschlossenen Augenlider zuckten. Seine Lippen bewegten sich sacht. Sie glaubte zu verstehen: „Gott liebt dich.“
Wut kochte in ihr hoch, und sie fauchte ihn an: „Das ist nicht, was ich hören will. Wer schickt dich und wie bist du hereingekommen? Gibt es noch mehr von deiner Sorte?“
„Genug“, flüsterte er und lächelte dabei. „Ihr werdet niemals siegen.“
„Du irrst dich“, knurrte sie. „Wir haben bereits gesiegt. Fürst Natas beherrscht die ganze Welt.“
Der Sterbende röchelte und würgte als ersticke er.
„Ich würde ja gerne länger mit dir plaudern“, sagte Erika ungeduldig. „Aber ich habe noch anderes zu tun.“ Sie ließ ihn los und er sank zu Boden wie ein schlaffer Sack aus Haut und Knochen. Er war kein würdiger Gegner gewesen. Wenn Gott nur solche Trottel dienten, brauchte man sich nicht zu wundern, dass Fürst Natas herrschte.
Sie wischte ihr Messer an seiner Hose ab, erhob sich und gab ihm noch einen Tritt gegen die Knie, den er nicht zu spüren schien. „Hundesohn“, zischte sie und eilte davon. Durch den Zwischenfall war ein Umweg nötig, um die oben zu alarmieren. Sie kam im ersten Untergeschoss wieder in den Palast und sprach zwei Wachen an, die vor der Kammer der Wachleute herumlungerten. „Sagt Eurem Hauptmann, in Abschnitt 9-14 liegt ein feindlicher Meuchelmörder. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr ihn noch verhören, aber wahrscheinlich ist er schon tot.“ Sie wandte sich ab und ging. Die Müllbeseitigung überließ sie gerne anderen.
Sie eilte durch die vordere Eingangshalle des Schlosses und dann zum schmalen Bedienstetenausgang hinaus in den dritten Vorhof, wo inmitten von Hühnern und Hunden Tag und Nacht ein gesatteltes Pferd für sie bereit stand. So wie für Gabriel. Seines war schon weg, doch sie wusste, wo sie ihn finden würde. Erika band die Zügel von dem rostigen Ring in der Mauer los, schwang sich in den Sattel und galoppierte durch den Hof und das Tor. Die Wärter hatten Anweisung, sie nie anzuhalten. Die Zugbrücke dröhnte und bebte unter den Hufen, dann schlugen die Eisen auf steinigen Boden, der leicht bergab führte, hinunter auf die Hänge, wo dürres Gras und Disteln wuchsen. Weiter hinten auf den Bergen, auf denen auch Natas’ Burg stand, würde sie die beiden finden, hinter dem Königspalast, unter der Heiligen Quelle.
Sie hatte bei dem Bericht des Spähers gut zugehört. Das kleine Mädchen Ho Nung stammte aus demselben Viertel wie sie und Gabriel. Die Tochter einer Hure und eines unbekannten Wüstenräubers. Sie war also eines der Halbblute. Das Mädchen hütete die Schafe am Fuß der Heiligen Quelle. Wüstennomaden hatten ihre Schafherde überfallen und geraubt, Ho Nung war vergewaltigt worden und die Besitzer der Schafe verlangten Ersatz. Seitdem waren Ho Nung und ihre Mutter Li B schwer verschuldet. Und trotzdem… trotzdem widerstand das Mädchen und verzweifelte nicht. Erika verstand nicht, wieso dieser kindlich-naive Trotz des Fürsten Pläne gefährdete, auch wenn Maagi ihr oft genug erklärte, wie eng Denken, Reden und Handeln zusammen hingen. Erika hörte das nicht gerne, denn in ihren seltenen sentimentalen Momenten wollte sie sich einreden, sie habe sich trotz all ihrer Verbrechen ein reines Herz bewahrt. Und auch Maagi sei tief drinnen gut und milde und treu. Und eigentlich dienten sie alle dem schwarzen Fürsten nur, weil sie auf der Gewinnerseite stehen wollten und überleben. Nur überleben, sonst nichts. Sie waren nicht böse, sie beugten sich nur den Machtverhältnissen.
„Es gibt keine Tatsachen“, war einer von Maagis albernen Sprüchen. In ihren weinerlichen Krisen stellte Maagi fest: „Meine Seele ist verflucht, deine Seele ist verflucht, und während die Erinnerung an unsere Verbrechen wie Asche verweht wird, ist die Dankbarkeit für alles Gute wie eine Pflanze, die lebt und sich fortpflanzt und immer wieder neue Ableger auswirft.“ Dann wieder lachte Maagi und gab zu: „Manchmal bin ich seltsam. Dabei weiß ich, dass dieses Unkraut sich stets langsamer vermehrt als wir es zertreten. Und darum wird es aussterben.“
„Genau“, erwiderte Erika. „Und darum stehen wir auf der richtigen Seite.“
Maagi nickte und fügte hinzu: „Und die Erinnerung an unsere Schandtaten wird niemals vergehen.“
Das Pferd zögerte unter Erika, denn es glitt auf den glatten Steinen ab. Sie erlaubte ihm, seine Schritte zu verlangsamen. Flüchtig fragte sie sich, wann sie zuletzt über das Land geritten war. Sie kannte die unterirdischen Gänge, die von der Burg aus das ganze Quell-Tal durchzogen, genauso gut wie die Geheimfächer ihrer Kleidertruhe. Doch nun verunsicherte es sie, dass das helle Sonnenlicht sie blendete und sie vergessen hatte, dass man hier oben langsamer reiten musste als unter der Erde. Schon so mancher Reiter war samt Pferd abgeglitten, und obwohl die Hänge des Quell-Tals nur sacht anstiegen, fiel man hier hart auf die Steine und konnte ungehindert hinunterpoltern, ohne sich irgendwo festhalten zu können. Zwischen glatten Steinplatten, die vermutlich die abgeschliffene Oberfläche großer Brocken darstellten, sammelten sich loser Kies und Sand, so dass hier eher Hundepfoten, nackte Menschenfüße und gespaltene Bockshufe Halt fanden als die Eisen der Pferde. Erika ließ ihrem Reittier Zeit und blickte zu Boden. Obwohl es hier derart karg und trocken war und jeder Regen sofort und eilig ins Tal plätscherte, um sich dabei in launisch gewundenen, fast ständig ausgetrockneten Bachläufen zu sammeln, die unten im Tal hellgrüne Niederungen bildeten, wuchsen doch verschiedene Pflanzen, deren Namen Erika vergessen hatte. Sie war in der Stadt aufgewachsen. Sie unterschied die trockenen Disteln und fleischige Pflanzen, die in ihren Blättern offensichtlich Wasservorräte speicherten. Sie erinnerte sich, dass diese glatten Blätter oft aussahen als würden sie bald platzen. Doch heute hingen sie schlaff herunter und waren an den Rändern braun. Sie wuchsen zwischen dem Kies, und gerade dort ließ sie das Pferd gehen, weil es leichter Halt fand. Dabei zerquetschte es achtlos das eine oder andere der tapferen Gewächse. So war der Lauf der Welt.
„Wie sich wohl das Unkraut fühlt, wenn es zertreten wird?“ fragte Maagi eines Tages in einem ihrer weinerlichen Anfälle, und Erika reichte ihr kommentarlos das Mundstück ihrer Wasserpfeife.
„Hast ja recht“, lachte Maagi traurig und sog die Droge ein. „Manchmal bin ich zu dumm. Ich habe mich längst unwiderruflich entschieden, nie zertreten zu werden, sondern selbst zu treten.“
Und Erika fragte sich dann doch, ob Maagi nicht zu jung geheiratet hatte. Und ob auch sie selbst nicht zu früh schon im Dienst des schwarzen Fürsten gestanden hatte, als dass man davon sprechen könnte, sie habe sich frei entschieden. Doch Zweifel sind der erste Schritt zum Verrat, wie der Fürst oft sagte, wenn er jemanden wegen unbedachter Worte enthaupten ließ. Und darum sorgte sich Erika manchmal um ihre eigene Gewissheit. Um Maagis Kopf machte sie sich weniger Sorgen, denn Maagi genoss die Nachsicht, die man einem hübschen Mädchen schenkt, obwohl sie wie 30 aussah und mindestens dreitausend Jahre alt sein musste. Doch selbst wenn sie etwas tat, was des Fürsten Pläne durchkreuzte, dann lächelte er nur ironisch und meinte: „Man weiß nie, was sich daraus ergibt, und am Ende entwickelt sich stets alles zu meiner Zufriedenheit.“ Und so ließ er Maagi gewähren wie ein Kind, das beim Spiel eine teure Vase fallen lässt. Maagis Gewissen beruhigte es ein wenig, wenn sie das, was ihr Gatte Wüstes tat, ein wenig lindern konnte. Er ließ den Vater einer Familie hinrichten, Maagi sandte den Hinterbliebenen Lebensmittel, Medizin und kleine Briefchen mit angeblich letzten Worten des Toten. Sie dachte sich dafür immer etwas Nettes aus und bewies damit eine Feinfühligkeit aus dem Grunde ihres Herzens.
Manchmal war Erika neidisch und wütend auf die dumme Maagi, die sich so viel herausnehmen konnte. Denn wenn Gedanken wirklich so viel bedeuteten, dann schwebte Erika in ständiger Gefahr, dass die ihren durch die Fürstin verdorben würden.
Erika knirschte mit den Zähnen, doch endlich näherte sie sich ihrem Ziel. Die so genannte Heilige Quelle war ein Ort für die Abergläubischen, denn hier war nichts Heiliges. Man sagte, dass das Heilige Wasser nie versiegte, doch Erika glaubte das nicht. Wenn es wochenlang nicht geregnet hatte, woher sollte dann das Wasser stammen? Alle anderen Felsenquellen tröpfelten noch einen halben Tag lang nach während der trockenen Tage, doch niemals länger. Der Berg konnte das Wasser nicht halten. Alles kam dem grünen Tal zugute.
Erika ritt an der aus Lehm erbauten Höhle vorbei, die die Quelle überdachte. Weiter unten entsprang das Wasser ein zweites Mal dem Felsen. Die Schafe weideten im Tal. Eine krumme, gebleichte Eiche klammerte sich unterhalb der Quelle an den Fels, geduckt, zerzaust und grau. Selbst die Blätter waren silbrig und keines sah gesund aus, alle zerrissen und eingerollt. Hier hatte Gabriel sein Pferd angebunden. Erika sprang ab und schlang ihre Zügel um denselben Baumstamm. Lautlos eilte sie den Hang hinab. Deckung gab es hier keine, gnadenlos schien die Sonne auf sie herab. Hier waren sie noch nie gewesen. Sie hörte die Quelle, sah ein winziges silbernes Rinnsal, das wie ein übermütiger Fisch über die Steine sprang, und weiter unten folgte auf die Felswüste fast übergangslos ein grüner Teppich aus kurzem, fettem Gras. Es fühlte sich unter ihren Füßen wie ein teurer, feiner Teppich an, jedoch frisch und kühl. Zwischen Schafweide und Waldrand wuchs eine Baumgruppe.
Dort lehnte Gabriel lässig an einem riesigen Felsblock im Schatten zwischen fünf Birken, die nervös mit den silber-grünen Blättchen raschelten. Die Bäumchen standen im Gegensatz zu der gebeugten Eiche aufrecht wie weiß und grün gekleidete Dämchen, die überall eine gute Figur zu machen gewohnt waren. Nur wenige Schritte weiter unten graste die Schafherde, und Erika erkannte eine braun gekleidete Gestalt, die auf einem flachen Stein saß und ihnen den Rücken zukehrte, um ins Tal zu blicken. Sie konnte zwei straff geflochtene schwarze Zöpfe erkennen, die rechts und links über die Schultern auf den Rücken hingen.
Gabriel grinste Erika entgegen, als sie sich zu ihm gesellte. Sie fand es nicht nötig, sich vor ihm zu verbergen. Gabriel wusste, dass sie ihn oft überwachte, und sie wusste, dass auch er ihr genauso oft folgte. Und sie wussten, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. Niemals würde Gabriel einen Fehler machen, den sie dann genötigt wäre zu berichten. Und umgekehrt. Sie gehörten zu den Besten, und darum waren sie bereits über fünfzehn Jahre im Geschäft, was in ihrem Beruf selten genug vorkam. Denn der Gegner schlief nicht.
Gabriel trug sein Hemd gerne offen und rasierte sich die Brust, so wie der Fürst es liebte. Und Erika musste zugeben, dass sie sich gerne an diesen glatten, muskulösen Oberkörper geschmiegt hätte. Gabriel war einer der wenigen Männer, die sie überhaupt interessierten. Doch den Günstling des Fürsten durfte niemand anrühren. Und Gabriel verschwendete keinen Blick an Frauen, so wie sie keinen an andere Männer. Verliebt zu sein verführte nur zu Dummheiten, und die gerieten zu leicht tödlich.
Gabriel änderte seine Stellung, so dass er sich nun mit nur einem Ellenbogen abstützte und auf die Schafherde blicken konnte, und tat das so elegant wie ein Löwe, was Erika neidisch machte. Sie selbst kam sich oft genug wie ein Schatten vor. Das war gut für ihren Beruf, doch es machte sie nicht zufrieden. Sie war nur der Schatten von irgendetwas oder irgendwem. Erika verstellte ihm die Sicht und fragte beiläufig: „Wie viel würdest du für eine Nacht mit mir zahlen?“ Sie wiegte die Hüfte, so dass Gabriel den Blick hinunter wandte und anerkennend mit der Zunge schnalzte. Das war ein Spiel zwischen ihnen, und es erregte sie. Oh, dieser Mann, den sie stets geliebt hatte wie einen Bruder, und dessen Unnahbarkeit ihn nur noch attraktiver machte. Wenn sie eine Prostituierte wäre, würde sie ihn nun berühren, doch sie wagte es nicht, weil sie dann ganz und gar in Flammen stehen würde. Also fragte sie ihn lässig mit gespielt heiserer Stimme: „Ich habe dich noch nie hier gesehen.“
„Ich werde auch nicht wiederkommen“, murmelte er und starrte an ihr vorbei ins Tal. Erika folgte seinem Blick. Das Mädchen war aufgestanden und blickte unverwandt zu ihnen hinauf. Sie hieß Ho Nung, war die schlitzäugige Tochter der Nutte Li B und sollte heute sterben. Weil sie gelacht hatte. Nicht nur ein Mal. Sie war ein Halbblut wie so viele, doch sobald eines von ihnen zu übermütig wurde, musste es sterben. Wegen der Prophezeiung, die besagte, dass einer von ihnen den Kampf zwischen Gut und Böse zugunsten des Guten endgültig entscheiden würde.
„Guten Tag“, rief das Mädchen und lächelte, wobei es eine Verneigung andeutete.
Irritiert stellte Erika fest, dass Gabriel das Kind wie hypnotisiert begaffte. Sie wollte ihn mit dem Ellenbogen anstoßen. Sie hatte nicht vor, seinen Auftrag für ihn zu erledigen. Wieder blickte sie das Mädchen an, erkannte aber offensichtlich nicht, was er sah. Ho Nung war nur ein Kind, das heute sterben sollte.
„Hallo Kleine“, säuselte Erika süßlich, als das Mädchen zu ihnen herauf stieg. Erika war nicht mehr die kindliche Mörderin, doch noch immer vertrauten ihr die Menschen und ließen sie nahe an sich heran. Sie tat alles dafür, um lieb, harmlos und niedlich auszusehen. Nur wenn sie alleine war, malte sie sich manchmal die Augen zu bösen Schlitzen und die Lippen kirschrot, bleckte die Zähne und fauchte ihr Spiegelbild wie eine Katze an. Das war ihr wahres Gesicht. Doch der Welt zeigte sie nur das kindliche Gesichtchen einer Dreiundzwanzigjährigen, die noch wie sechzehn aussah. Der bleiche Teint, der Schmollmund und ihre zarte Statur ließen sie zerbrechlich wirken. Das schulterlange blonde Haar trug sie heute offen. Der porzellanfarbene Puder, leicht gerötete Wangen und die groß gemalten Augen unterstrichen ihre Schönheit und täuschten Unschuld vor. Doch als das Kind sie anblickte, fühlte Erika sich als sei sie durchschaut, durch und durch. Als habe sie heute Morgen vergessen sich zu pudern. Und sie begriff, was Gabriel sah: sich selbst, die sich in den Augen des Mädchens spiegelte.
Doch Erika riss ihren Blick los und fragte gönnerhaft: „Wo sind denn deine Eltern?“
„Ich bin kein Kind“, erwiderte das Mädchen und sprach gekünstelt wie eine schlechte Schauspielerin. „Ich bin die Schäferin und verantwortlich für diese Herde.“
Erika fühlte, dass Ho Nung wusste, dass sie ihre Mörder waren. Viele Menschen erkannten das, wenn sie ihrem Verfolger gegenüber standen, doch keiner traute diesem Gefühl. Sie glaubten nur was sie sahen, und sobald Erika die Waffe zog, war es schon zu spät. Doch Ho Nung vertraute ihren Instinkten. Bevor Erika oder Gabriel sich rühren konnten, wandte sie sich um und rannte davon, ins Tal.
Erika wollte ihr nachlaufen, doch Gabriel packte sie hart am Handgelenk und riss sie herum. „Scheiße, Gabriel!“ war alles, was ihr einfiel. Sie verstand ihn nicht. Er drehte sie so, dass sie in seine Augen blicken musste. Sie waren von einem hellen Graublau wie die Farbe des Himmels an Tagen, an denen Schleierwolken die Sonne verbergen und den Eindruck erwecken, der Himmel sei weiß und man könne alles davon sehen. Und Erika begriff, dass sie Gabriel vielleicht gar nicht kannte. Stets war er zu schön, zu freundlich, zu gehorsam gewesen. Sie fürchtete sich vor dem, was er nun sagen würde. Sie ahnte, dass es ihr Leben verändern könnte.
Gabriel sagte ganz ruhig und sicher: „Das war’s. Es ist vorbei. Ich ermorde niemanden mehr.“
Erika wollte lachen, doch der Versuch blieb ihr im Hals stecken. Sie wusste, dass er es ernst meinte. Und sie wusste, dass sie ihn nun töten musste. Und sie wusste, dass er es wusste. „Scheiße.“ Das war nicht ihr Tag. Erst die vermasselte Befragung und jetzt sollte sie ihr Idol kalt machen.
„Auch mich nicht?“ fragte Erika, doch es klang nicht so gelassen wie erhofft. Ihre Stimme zitterte. Einer oder eine von ihnen musste jetzt sterben, und sie fürchtete, dass er stärker war als sie.
„Du wirst mich nicht alle machen“, stellte er ganz ruhig fest.
Und sie wusste, sie konnte es nicht. „Gabriel“, flehte sie. „Tu mir das nicht an!“
Er lächelte spöttisch so als sei das alles ein Witz. Erika klang fast hysterisch als sie jammerte: „Das ist doch nur ein Kind! Irgendein Kind!“
„Nein, das ist sie nicht. Sie ist die Tochter von Li B.“
„Na und?“
„Li B?“ fragte er. „Erinnerst du dich nicht?“
„Nein, ich bin nie jemandem begegnet, die so heißt. Außerdem ist Li B eine Nutte.“
„Aber sie ist die Li B“, betonte Gabriel.
„Und warum ist das wichtig???“ Er trieb sie noch in den Wahnsinn.
„Li B ist eine Göttin“, erklärte Gabriel knapp.
„Das ist irre“, jammerte Erika verzweifelt. „Sie ist die Mutter einer Bastardtochter und sie hat jede Nacht ein halbes Dutzend Freier, die ihr pro halbe Stunde einen Kupferling geben.“
„Na und?“ fragte Gabriel. „Trotzdem ist sie eine Göttin.“
„Weißt du was“, seufzte Erika. „Wir gehen in ein Lokal, trinken auf meine Kosten und du erklärst mir das Ganze. Und wenn du mich nicht von deinen Gründen überzeugen kannst, dann vergisst du den Unsinn und führst deinen Auftrag aus. In Ordnung?“
„Ich kann es nicht erklären“, erwiderte Gabriel und grinste wieder spöttisch so als verstünde sie etwas ganz Selbstverständliches und Einfaches nicht. Dann legte er ihr den Arm um die Schultern, drückte sie an sich und sagte versöhnlich: „Gut, lass uns einen trinken gehen und ich erzähle dir ein Geheimnis. Wir trinken aus der Heiligen Quelle.“
Sie wollte widersprechen, doch sie spürte, dass er nur dieses Wasser mit ihr trinken würde oder nie wieder irgendetwas.
So gingen sie schweigend nebeneinander her. Gabriels Arm blieb auf ihren Schultern ruhen, doch die Nähe erregte sie nicht, sondern ängstigte Erika. Gabriel konnte einen Menschen mit bloßen Händen töten. Nein, das hier musste ein böser Traum sein, geschah nicht wirklich. Nicht hier und heute und jetzt. Gabriel war einer, der es geschafft hatte. Er war Natas’ bester Meuchelmörder. Der Fürst vergötterte ihn sogar ein wenig zu sehr, und Gabriel würde noch weit kommen. Macht, Reichtum, alles würde der Fürst ihm geben, noch viel mehr als Maagi Erika jemals geben könnte. Und er warf das alles weg? Sicher scherzte er. Doch es gelang ihr nicht, sich das einzureden. Gabriel meinte es auf seine spöttische Art todernst. Er hegte Geheimnisse vor ihr und der ganzen Welt, hatte etwas in seinem Inneren verborgen, das wie ein Geschwür gewachsen war und nun aufbrach. Und sie betraf es auch, sie würde mit zerstört.
Erika wagte nicht, die Tränen aus den Augenwinkeln zu wischen, denn dann hätte er sie erst bemerkt. So aber schenkte er ihr keinen Blick, als er erhobenen Hauptes neben ihr ausschritt und sie mit seinem um ihre Schulter gelegten Arm lenkte. Sie stiegen einige Treppen hinauf, die von regelmäßig angelegten glatten Steinen gebildet wurde und folgten dabei dem Bach bis zu seiner Quelle. Erika wollte hier anhalten, doch Gabriel zog sie weiter. Dieser Mann, dessen löwenhafte Arroganz sie eben noch anzog, erschien ihr plötzlich wie ein Todesengel, umso mehr als er sie in eine dunkle Höhle ziehen wollte. Sie sträubte sich und entwand sich seinem Griff.
„Dies ist die Höhle der Heiligen Quelle“, erklärte er. „Dorthin gehen wir.“
„Aber der Bach entspringt weiter unten dem Fels!“
Dieses Mal grinste er nicht, sondern sagte traurig und sanft: „Vertrau mir.“
Dass der Mann das sagen musste, den sie bisher wie einen Bruder zu kennen glaubte, brachte sie beinahe wieder zum Weinen. Er hatte sie verraten, als er das Mädchen gehen ließ, und jetzt sollte sie ihm vertrauen? Sie wollte es nicht. Tief in ihr kochte eine kleine Flamme der Wut, von der Erika sich wunderte, dass sie so schnell Nahrung fand. So als sei sie schon immer da gewesen. Als sie in Gabriels Gesicht blickte, das noch immer so makellos war wie stets und sie nun fragend anblickte, wusste sie, dass sie ihn trotzdem nicht töten könnte. Denn sie war nicht auf ihn wütend, sondern vor allem auf sich selbst.
Gabriel erklärte und schien enttäuscht, dass er es überhaupt erklären musste: „Die Quelle entspringt in der Höhle, sammelt sich in einem Wasserbecken und der Überlauf versickert im Fels, um hier, weiter unten, wieder herauszutreten. Es scheint einen unterirdischen Kanal zu geben.“
„Und woher weißt du das so genau?“ fragte sie trotzig. „Du bist doch noch nie hier gewesen!“
Er schüttelte den Kopf, wandte sich ab und ging einfach hinein. Erika folgte ihm langsam und vorsichtig. Natürlich würde er nicht neben dem Eingang lauern, das gezogene Messer in der Hand. Sie kannte ihn doch ein wenig. Trotzdem wollte sie nicht über diese Schwelle treten. Sie kontrollierte ihren Dolch, der griffbereit im Gürtel steckte. Ihr Leben war doch in Ordnung gewesen. Sie wollte nicht, dass sich etwas änderte.
Sie blinzelte im Inneren der Höhle, denn es fiel kaum Licht hinein, außer durch die Öffnung, in der sie gerade stand. Da die Sonne gerade ihren höchsten Stand überwunden hatte, fiel ein steiler Lichtstrahl auf Gabriels Fersen, den Rest seines Körpers sah sie nur als dunklen Umriss vor der hellgrauen Wand. Er stand mit dem Rücken zu ihr aufrecht vor einem Steinbecken, in das unaufhörlich ein Wasserstrahl plätscherte.
Sie trat neben ihn. Der Boden fühlte sich glatt an unter ihren Füßen, viel glatter als alles, was sie jemals betreten hatte. Der älteste Fußboden der Welt, so schien es ihr. Und vielleicht versiegte diese Quelle wirklich niemals. Sie fröstelte in der unerwarteten Kälte des Orts.
„Darf ich dich in den Arm nehmen“, fragte Gabriel, „während ich dir mein Geheimnis erzähle?“
Sie nickte, aber weil er das ja nicht sehen konnte, trat sie neben ihn und lehnte sich an. Wieder wand er seinen Arm um ihre Schultern, in dieser Kühle angenehm warm. Sie zitterte ein wenig. Gabriel fing an zu erzählen: „Vielleicht erinnerst du dich, dass ich früher oft einen ganzen Tag verschwand?“
„Ja“, antwortete sie sacht. Sie erinnerte sich und hatte sich nie viele Gedanken darüber gemacht. Was sollte er an diesen Tagen schon tun? Zusätzliche Geschäfte machen, von denen er ihnen nichts verriet.
„Diese Tage, die nur mir gehörten, verbrachte ich hier.“
Und plötzlich verstand sie es. Alles zugleich. Er hatte sich nicht von den anderen abgesondert, um noch mehr Geschäfte zu machen als sie, sondern um nachzudenken. Er wollte allein sein. Er hatte einen Ort gefunden, ganz für sich. Sie hatte falsche Vorstellungen über ihn gehegt. Er war nicht der perfekte Mörder ohne jeglichen Zweifel. Er war ihr Ideal gewesen, dem sie nachgeeifert hatte.
„Ich verstehe selbst nicht“, sagte er, „dass ich dir das heute erst zeige. Eigentlich ist es dafür nun zu spät.“
„Ja“, bestätigte sie nur. Wie sollte sie ihm noch vertrauen? Er war ein Verräter. Sie müsste ihn an Ort und Stelle töten. Und sie konnte es noch immer nicht. Sie musste sich stärker in ihre Wut hinein steigern. Doch wie konnte sie das, mit seiner warmen Hand auf ihrem Schulterblatt?
„Margarita zeigte ich diesen Ort“, fuhr er fort.
Diese Worte bohrte er wie ein Messer in ihr Herz und rührte in der Wunde herum. Sie hatte es stets geahnt, dass Margarita ihm näher stand als sie. Nachdem sie gestorben war, hatte Gabriel zwei Tage lang nichts zu sich genommen. Er hatte so getan als würde er essen, doch Erika hatte es trotzdem bemerkt.
„Du hast dir damals sicher gewünscht“, zischte sie, „nicht sie sei gestorben, sondern eine andere. Ich zum Beispiel.“
„Ja, das dachte ich damals“, gab er gelassen zu als spiele es nach so langen Jahren keine Rolle mehr.
„Du bist verrückt“, stellte sie fest, „mir das hier und jetzt zu sagen? Willst du es mir leicht machen, dich zu töten?“
„Nein.“ Er wandte sich ihr zu, obwohl sie sich selbst auf diese kurze Distanz nur schemenhaft sehen konnten. „Ich will nur klären, wie es zwischen uns steht. Bevor ich mein neues Leben beginne.“
Erika fröstelte. Sie wusste, dass er stärker und schneller war und seine Hand niemals zögerte. Wenn er sie beseitigen wollte, würde er keinen Fehler begehen.
„Und was willst du von mir?“ fragte sie wütend.
„Ich möchte dir noch sagen, dass ich es bereue, dass ich dich stets derart ignorierte. Wenn ich dir jetzt sage, wie sehr ich dich schätze, wirst du es mir wohl kaum glauben.“
„Wohl kaum. Und was meinst du damit, dass du mich schätzst? Findest du, dass ich eine gute Mörderin bin?“
„Nein, ich finde, dass du als meine Vertraute und Verbündete mit mir kommen solltest. Ich möchte das Versäumte nachholen und dich besser kennen lernen. Und ich will auch keine Geheimnisse mehr vor dir haben.“
„Und was bringt dich zu dieser Sinneswandlung?“ fragte sie gereizt und tastete nach ihrem Dolch. Dieser Mann war hochgefährlich. Sie konnte nicht verhindern, dass sich Panik in ihrem Magen regte. Noch nie war sie einem gefährlicheren Gegner gegenüber gestanden. Dass er derart offensichtlich mit ihr spielte, missfiel ihr.
Er ließ sie los und begann herumzuwandern wie ein eingesperrter Löwe. Dann erklärte er: „Ich bin nicht sehr gut darin, über Gefühle zu sprechen.“
Ihr lag auf der Zunge ihm zu sagen, dass er es bleiben lassen solle. Sie würde ihm ohnehin nichts glauben. Er spielte doch alles nur vor! Er glaubte, sie sei eine schwache Frau, die er mit ein paar dummen Lügen weich kochen könne. Und das machte sie nun derart wütend, dass sie sich zum ersten Mal bereit fühlte, ihn zu durchbohren, um dem Schauspiel ein Ende zu bereiten.
„Als wir noch unter Mördern lebten, waren wir uns nicht sehr nahe“, fuhr er fort. „Wir sind, glaube ich, ziemlich verschieden. Ich habe dich nie verstanden, und das machte mir etwas Angst. Ich bin nie darauf gekommen, dass ich dich verstehen würde, wenn ich dich besser kenne. Aber jetzt wo ich dabei bin, ein neues Leben anzufangen, das besser zu mir passt, da frage ich mich, ob… Ich meine, verglichen mit normalen Leuten, da sind wir uns doch sehr ähnlich, und darum würde ich dich gerne mitnehmen.“ Er log. Himmel, er beschwatzte sie wie eine Jungfrau.
„Danke, sehr nett“, erwiderte Erika spitz. „Du würdest mich lieber als dein Haustierchen mitnehmen, statt mich an Ort und Stelle zu töten.“
„Ja“, sagte er einfach. „Was ist daran so schlimm? Sind wir nicht alte Weggefährten?“
„Gabriel“, sagte sie. „Wir sind uns tatsächlich sehr unähnlich. Gelegentlich mangelt es dir massiv an Feingefühl. Du kommst mir manchmal vor wie ein Ochse, der nicht mal spürt, wenn er einen Hund zertrampelt.“
„Hunde sind aber auch ziemlich weich.“ Er knackte mit den Fingerknöcheln. Erika kroch eine Gänsehaut über den Rücken. Er wusste, wie man mit bloßen Händen ein Genick brach. Ihr Genick war nicht stärker als das der vielen, die er so schon erlegt hatte.
„Aber sie jaulen.“
„Das tun sie auch dann, wenn sie keinen Grund haben.“ Er strich ihr mit dem Daumen über ihr Genick.
„Siehst du, genau das meine ich.“ Sie wich vor ihm zurück, die Hand am Dolch. Könnte sie wirklich zustechen? Erst wenn er sie ernsthaft angriff, doch dann war es vermutlich schon zu spät.
„Es ist auch nicht sonderlich geschickt von dir, das jetzt zu mir zu sagen“, konterte er.
Erika erklärte: „Was ich damit sagen wollte ist, dass ich dich auch nicht verstehe und dich ebenfalls unheimlich finde.“
„Aber das machte mich in deinen Augen doch auch ein wenig interessant, nicht wahr?“ spottete er.
„Zugegeben. Aber nun hast du dich als hoffnungsloser Narr erwiesen.“
„In wie fern?“
„Warum tötest du nicht einfach dieses blöde Kind und alles ist in Ordnung? Warum machst du alles so kompliziert?“ Im Halbdunkel lockerte sie ihren Dolch im Gürtel. Gabriel konnte dies nicht entgangen sein.
„Weil ich vielleicht doch nicht so ein trampeliger Ochse bin wie du glaubst. Ich habe mir dabei etwas gedacht. Du weißt, dass es mir nichts ausmacht, jemanden zu töten. Und du weißt, dass es mir auch nichts ausmachen würde, dich zu töten.“
Nein, das hatte sie nicht gewusst. Denn sie liebte ihn mehr als er sie. Wäre es für sie leicht ihn zu töten, dann hätte sie es schon getan, bevor sie die Höhle erreicht hatten.
„Du gibst mir also eine Chance, mit dir zu gehen, weil du aus irgendeinem Grund meinst, du würdest mich gerne näher kennen lernen?“ fasste sie zusammen.
„Ja, genau.“ Er klang erleichtert, weil sie ihn verstanden hatte.
Sie fühlte nicht das geringste Bedürfnis, ihre eigenen Gefühle und Motive vor ihm auszubreiten. Es machte keinen Sinn, diesem Ochsen ihre Liebe zu gestehen.
„Gut, ich komme mit“, entschied sie. Sie wollte nicht sterben. Vielleicht war sie sogar in ein paar Stunden schon bereit, sein Leben zu beenden und seinen Kopf dem Fürsten vor den Thron zu legen.
„Was?“ fragte er erstaunt nach.
„Das ist doch, worum du mich gebeten hast.“
„Aber willst du es auch oder versuchst du nur Zeit gewinnen?“
„Was bleibt mir anderes übrig?“
„Hast du nicht vorhin daran gedacht, mich Verräter zu töten?“
„Ach, meine Gedanken sind lange nicht so klar wie deine“, wich sie aus. „Du hattest viel länger Zeit, um dich auf diese Lage vorzubereiten.“
„Deine Gedanken sind immer klar“, erklärte er. „Wechselhaft wie der Wind, aber klar in alle Richtungen.“
„Dieses Mal nicht.“
„Sei ehrlich. Ich war es auch.“
„Du weißt es doch sicher schon.“
„Nein, was weiß ich schon von dir?“
Sie brachte es nicht über sich. Und er würde es spüren. Er war kein Ochse, er war eben doch eine Raubkatze.
„Nun?“ fragte er.
Sie zuckte die Schultern. „Mir ist es gleich, für welche Seite ich arbeite. Ich habe mich nie zum Bösen hingezogen gefühlt. Bezahlen die Guten genauso gut?“
„Sie zahlen in anderer Münze“, sagte er. Rätselhaft, denn in Quell-Tal gab es nur eine einzige Währung.
„Du meinst, sie zahlen in Naturalien?“
Er lachte leise. „So könnte man es auch nennen. Sie bezahlen in Glück und Lebenssinn.“
„Davon kann ich mir nichts kaufen.“
„Davon kannst du dir die ganze Welt kaufen“, sagte Gabriel und lachte. „Die ganze Welt, denn du wirst frei sein und die Gemeinschaft der Gottesanbeter ist deine liebe Familie.“
„Vogelfrei. Womöglich töten sie uns schon, sobald wir diese Höhle verlassen. Natas’ Leute sind überall.“
„Aber wir sind besser. Wir kennen sie und ihre Tricks, und wir sind die besten, du und ich.“
„Aber wir sind nur zwei, und sie werden uns müde hetzen, und…“
„Feige zu sein ist einer deiner großen Fehler“, stellte er fest. „Ein wenig kenne ich dich doch.“
Sie wusste, dass sie feige war. Und nun ging sie nur darum mit ihm, weil sie es war. Und so schlängelte sie sich durch das Leben und vermied alle Gefahr. Und darum wirkte sie so wetterwendisch. So wie der Wind kein festes Ziel kennt, streifte sie über die Erde und nutzte die Ritzen, die sich ihr boten, nur damit sie ihren Lauf nicht zu unterbrechen brauche.
„Und was ist unser nächstes Ziel?“ fragte sie.
„Li B und dann der König.“
Sie lachte ungläubig. „In dieser Reihenfolge?“
„In dieser Reihenfolge.“
„Kennst du ihre Welt?“
„Nicht sehr gut.“ Er griff nach ihrer Hand, und sie fühlte, dass ihre inzwischen sehr viel kälter war als seine.
„Eines möchte ich aber, dass dein Mund mir noch sagt.“ Damit zog er sie an sich, umfasste ihre Schulter und drückte ihr einen Kuss auf den Mund. Sie wurde in seinen Armen weich und war froh, dass er sie hielt, so dass sie nicht zu Boden sinken konnte. Ein Schauder von Schwäche lief durch ihren Körper.
Seine Lippen lösten sich wieder von ihren, Gabriel drückte Erika noch fester an sich und flüsterte: „Jetzt erst bin ich beruhigt. Ich hatte schon gezweifelt.“
Sie wurde wütend und wollte sich losreißen, doch er ließ sie nicht gehen. Er hatte sie nur geprüft, eiskalt mit ihr gespielt!
Er erklärte: „Ich glaube, schon seit unserer Kindheit, eigentlich schon immer, hast du mich geliebt. Und ich dummer Klotz habe mich darin gesonnt, aber es dir nie vergolten. Ein wenig habe ich dich sogar dafür verachtet, dass du mir dein Vertrauen und deine Stärke schenkst, ohne etwas dafür zu fordern. Stattdessen faszinierte mich Margarita, die Kecke, die an jedem Finger fünf Liebhaber hatte. Ich war damals jung und wollte Spaß haben. Wir waren gute Freunde, aber sie hat diese Freundschaft nicht hoch gehalten. Ich bekam von ihr wenig zurück. Als ich ihr diese Stelle hier zeigte, stapfte sie herum und machte sich über alles lustig. Du aber warst von diesem Ort verzaubert, eingeschüchtert. Wir sind uns, glaube ich, doch ein wenig ähnlich. Und darum bin ich froh, dass du mit mir kommst und wir die Chance haben, einander näher zu kommen. Wie du mich geküsst hast zeigt mir, dass ich dir vertrauen kann und dir den Rücken zuwenden darf.“
Sie sagte nichts dazu. Wenn sie zugab ihn zu lieben, war sie die Schwächere. Er wusste, dass sie ihn niemals töten würde. Doch er könnte sie töten. Das hatte er gesagt und so gemeint.