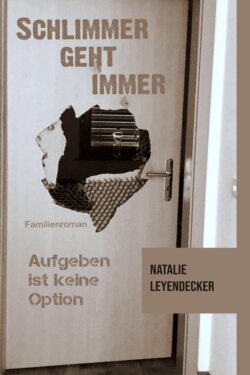Читать книгу Schlimmer geht immer - Natalie Leyendecker - Страница 5
Kapitel 3: Spurensuche
ОглавлениеWas folgte, war die Frage nach dem Warum und Wie und Wann und … ach, eigentlich gab es in meinem Kopf nur noch Fragezeichen. Warum verkaufte mein Sohn Cannabis? Wann hatte das angefangen? An wen verkaufte er das Gras und vom wem erhielt er das Dreckszeug überhaupt? Wie war er in die Kreise geraten, und woher kam das Geld? Und vor allem: Wie konnten wir ihn wieder auf den rechten Weg bringen?
Immer wieder sagte mein Vater während unseres Feuers, es müsste doch jemanden geben, irgendwen, der ihn beeinflussen konnte, der Eindruck auf ihn machte. »Kennst du nicht jemanden?«, bohrte er immer wieder nach.
Plötzlich kam mir jemand in den Sinn. Martin, mein geschätzter und geliebter Kollege, knapp sechzig, grau meliertes Haar, breitschultrig, 1,95 groß und immer in schwarzem Anzug, weißem Hemd und Krawatte. Der wäre die ideale Kontaktperson, der könnte Einfluss haben, dachte ich. Und ich hatte auch schon einen Plan.
Als ich ihn am nächsten Morgen, einem Samstag, anrief, erwischte ich ihn gerade auf einer Alm, typisch für die Schweizer am Wochenende. Die meisten wandern an ihren freien Tagen oder fahren Rad – dann geht es in die Berge oder an die Seen.
»Martin, bitte, du musst mir helfen«, sprudelte es aus mir raus, als ich ihn in der Leitung hatte. »Ich brauche dich.« Dann erzählte ich, was passiert war, vom Fund der riesigen Menge Cannabis und von der Aktion mit dem Pizzaofen. Ich endete die Geschichte mit der Mitteilung, dass wir Druck auf Jakob ausüben müssten. »Martin, ich hätte einen ganz besonderen Job für dich. Ich brauche dich als Kripobeamten«, teilte ich ihm mit.
»Als was, bitteschön?«
»Als Kripobeamten. Könntest du heute vorbeikommen und mitteilen, dass du das Gras gefunden und mitgenommen hast und auf eine Anzeige nur dann verzichtest, wenn Jakob entweder sofort nach Deutschland zieht« – (ich wusste, dass er das auf keinen Fall wollte) – »oder aber in eine Entzugsklinik geht?«
Martin war ein wenig überrumpelt, zeigte aber Verständnis und fand die Idee gar nicht so schlecht. Schließlich hatte er selbst vier Kinder, drei davon waren Jungs. Seine Frau war mit einem jugendlichen Tennislehrer durchgebrannt und in die Staaten ausgewandert. Martin kannte also das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen und sagte zu, er würde mich unterstützen. Zwar nicht heute, aber am nächsten Morgen gegen sieben Uhr, bevor er mit seinen Kindern den wöchentlichen Sonntagsbrunch abhielt.
Kurz nach dem Telefonat mit Martin kam Jakob nach Hause. Ich berichtete ihm möglichst sachlich, dass hier gerade eine Hausdurchsuchung stattgefunden habe, irgendwer habe ihn wohl verpfiffen. Es sei ein ganzer Sack Cannabis sichergestellt worden, die Ermittler hätten ihn mitgenommen, und morgen käme ein Beamter zum Verhör.
»Ja, und? Das Zeug war nicht von mir, mach mal nicht so ’n Stress. Ich hab alles unter Kontrolle«, war seine lapidare Reaktion. Auch ein ernsthaftes Gespräch mit dem Großvater schien wenig Reaktionen in ihm hervorzurufen. »Jakob, in welche Situation bringst dDu hier dDich und deine Familie? Was tust dDu dDeiner Mutter an?«, so die Reaktion meines Vaters.
Aber Jakob tat – jedenfalls nach außen – cool. »Lasst mich einfach alle in Ruhe«, brummte er vor sich hin.
Als Martin im schwarzen Anzug am nächsten Morgen in der Tür stand, war Jakob aber dann doch klein mit Hut. Trotz der frühen Stunde hatte er sich ein Hemd, Jeans und schwarze Socken angezogen. Ich hatte fast den Eindruck, er habe sogar seine Schuhe geputzt. Die beiden gingen auf die Terrasse und redeten, redeten lange – bestimmt 30 bis 40 Minuten. Durch das Fenster sah ich, dass Jakob immer wieder nickte und mein Kollege seine ernste Miene durchhielt. Irgendwann rief Martin meinen Vater hinzu und dann sprachen sie zu dritt. Sie mahnten und warnten. Eindringlich machte Martin Jakob klar, er käme nur wegen der Bekanntschaft mit meinem Vater um strafrechtliche Maßnahmen herum, und das auch nur, wenn er sofort in ein Spital ginge, um einen Entzug zu machen.
Ich war erleichtert und den Männern dankbar, unendlich dankbar. Hatte Jakob schon keinen richtigen Vater, so fand ich, durchsetzungsstarke Männer in seinem Umfeld wären gut für ihn. Er brauchte Vorbilder. Und ich als Frau konnte das nicht in allen Dingen sein. Wenn es vielleicht für ihn männlich war, Drogen zu konsumieren und zu verkaufen, so hatte ihm dieses Gespräch hoffentlich gezeigt, dass der »Beruf« Drogendealer keine Akzeptanz in der Gesellschaft findet.
Nun hoffte ich, dass Jakob sein Versprechen hielt und in die Klinik zu einer Entzugstherapie ging. Aber es klappte nicht. Gemeinsam mit meinen Eltern, seinen Cousins oder mit mir suchte er diverse Suchtkliniken auf, oftmals spezialisiert auf Cannabis. Aber alle wiesen ihn ab. Die Gründe: zu jung oder nicht wirklich süchtig. Was Jakob mache, fiele noch unter »normalen Konsum«. Nicht wirklich süchtig war sicherlich falsch. Vielleicht war er nicht körperlich abhängig, sicherlich aber psychisch.
Kurz nach dem Besuch der Großeltern hatte mich mein Neffe angerufen und berichtet, dass Jakob damit prahle, meist erst morgens gegen 5 Uhr nach Hause zu kommen. Er sei häufig nachts unterwegs, kaufe und verkaufe Cannabis. Jakob hätte es ihm stolz berichtet. Seit geraumer Zeit stellte ich mir deshalb den Wecker zweimal in der Nacht auf 2 und auf 4 Uhr morgens, denn irgendwann hatte ich festgestellt: Jakob sagte mir zwar immer brav hum halb elf „Gute Nacht“, aber danach verschwand er.
Mir war nun klar, warum er morgens nicht aufwachte. Jakob war am frühen Morgen tatsächlich todmüde. Er hatte sich in den letzten Monaten sein eigenes Leben aufgebaut, von dem ich keine Ahnung hatte. Und es fand nicht tagsüber statt. Er hatte sich gut verstellt, über lange Zeit fiel es niemandem auf. Wie viele Psychologen, Psychiater, Coaches, Lerntherapeuten, Sozialarbeiter, Heilpraktiker und Suchtberater hatte er in den letzten Jahren kennengelernt? Keiner war hinter sein Geheimnis gekommen. Keiner hatte eine Idee gehabt, was Jakob trieb und was in ihm vorging. Diese Therapeuten waren sicher viel mehr Menschen, als ihm gutgetan haben. Oft schildert er, dass er immer wieder zu Ärzten gemusst habe. Heute denke ich, wahrscheinlich war das falsch von mir. Er brauchte Hilfe, das ja. Die psychosomatischen Bauchschmerzen, die Drogen, das chronische Schulschwänzen. Ich rechtfertige es vor mir selbst, dass ich die richtige Person suchen wollte, die richtige für ihn. Das war wichtig, aber einige der Leute hätte ich nicht einschalten sollen. Die, bei denen von vornherein klar war, dass Jakob keinen Draht zu ihnen bekommen würde, die Älteren, die Spießigen, die Humorbefreiten …
Jetzt war es nicht mehr zu ändern, aber ich wollte vorsichtiger in Zukunft sein, und derweil ging Spurensuche weiter – bis tief in die Vergangenheit. Meine Freunde drängten mich, mir helfen zu lassen, und empfahlen mir immer wieder, mir einen Therapeuten, einen Coach zu suchen. »Mensch Fine, was dDu da an Last trägst, geht nicht allein, wenn dDein Ex nicht mit anpackt. S, such dDir andere Hilfe!«. Als Annette, Vivian und Evelyn mir das je ungefähr jeder sieben Mal gesagt hatten, suchte ich tatsächlich nach einemn Ccoach in meiner Nähe. Ich machte einen Termin bei Amely Wunschenstein in Zürich. Mein Ziel dabei war, die Ursachen für die Drogensucht für das Schulschwänzen zu finden. Mit ihr das herauszufinden, was all die anderen nie geschafft hatten. Denn für mich blieb die Frage: Was war schiefgelaufen, wo hatte ich als Mutter versagt?
Frau Wunschenstein erzählte ich Jakobs Geschichte, unsere Geschichte, und dabei fing ich ganz von vorne an. Mit seiner Geburt, dem eiskalten, regnerischen Tag im Dezember 2004, als der kleine »Knödel«, wie ich ihn damals nannte, zwei Wochen nach errechnetem Termin mit 4,5 kg sich mühsam in 30 Stunden auf die Welt kämpfte. »Als Jakob es endlich geschafft hatte«, erzählte ich ihr, »waren wir beide halb tot. Vielleicht habe ich deshalb eine ganz besondere Bindung zu ihm. Er war ein Kämpfer und er wurde unterschätzt.« Nach der Geburt hatte sich rausgestellt, alles war viel größer als im Bauch geschätzt und gemessen. Die Ärzte hielten ihn danach für sehr krank, seine Werte waren schlecht. Kurz nach den Weihnachtstagen war er geboren und schon am Tag danach verlegt worden von der wunderbaren idyllischen Geburtsklinik, die ich mir in der Schwangerschaft ausgesucht hatte, in ein riesiges Klinikum an einem Industriestandort. Ich sollte dort nicht aufgenommen werden. Für Jakob selbst gab es nur ein freies Bett, und das war auf der Säuglingsintensivstation, kein anderes Bett im ganzen großen Frankfurter Klinikum war frei. Ach, und Jakob kam nicht nur auf die Säuglingsintensivstation, sondern auf die Frühchenintensivstation. Nur winzige, viel zu leichte Babys waren dort. Seine Bettnachbarn wogen zwischen 500 und 700 Gramm, er dagegen 4500 Gramm plus und hatte mit 39,5 Zentimetern einen immensen Kopfumfang. Angepasst an diese Winzlinge waren auch die Windeln in Größe XXXXXS, die Kleidung in Größe 50 oder kleiner, halt Puppenkleidung. Nichts von alledem passte ihm, die Windeln reichten für eine halbe Pobacke, die Bodys passten gar nicht über seinen Kopf. Die Nahrung war auch ein Problem. Stillen war auf dieser Station verpönt, ernährt wurden die Frühchen durch Kanülen am Kopf. Das hing damit zusammen, weil die meisten zu schwach zum Saugen waren und zu wenig Personal zwischen den Jahren arbeitete, um eine individuelle Versorgung zu ermöglichen. Es war ein Albtraum! Nur für mich, oder auch für ihn?, frage ich mich oft.«
Frau Wunschenstein schluckte und notierte sich alles, und ich redete weiter, sprach mir alles von der Seele: »Aber wir kämpften, jeder auf seine Art. Mir gelang es nach viel Überzeugungsarbeit, dass das Klinikum mich doch aufnahm, wenn auch in einem Patientenbett drei Häuser weiter. Dank meines Smartphones, das alle zwei Stunden klingelte, marschierte ich mit vier Einlagen im Slip im Zwei-Stunden-Takt zu ihm rüber, um ihn zu halten und ihn zu stillen. Das halten Sie nie durch, so die Aussage der Ärzte und Pfleger. Aber ich hielt durch, und vor allem Jakob hielt durch. Fünf Tage, dann wurden seine Werte deutlich besser und er nahm zu. Ich stillte einfach fortlaufend, und die Schmerzen, die ich in Unterleib und Brüsten hatte, wurden täglich weniger. Heute erst weiß ich, wie stark ich damals war. Damals funktionierte ich, wie so oft dann auch später, als die Tragödien seiner Teeniezeit begannen. Der Vater des Kindes war bei der Geburt dabei, fing aber unmittelbar danach wieder an zu arbeiten. Die Verwandtschaft feierte Silvester, es gab nur uns zwei – Jakob und mich. Nein, nicht ganz. Juliane, eine uralte Freundin von mir, kam, sie rettete uns. Sie zog bei uns ein und organisierte von dort. Aus der Wohnung brachte sie normale M-Windeln und Kleidung in Größe 62/64 ins Krankenhaus. Sie brachte mir Snacks und Stillleinlagen, besorgte die Pumpe zum Milchabpumpen und war einfach für uns da. Vom Krankenhaus war keine Extrabehandlung zu erwarten. Bedingt durch die hohe Auslastung in der Weihnachtszeit, das wenige Personal und die Tatsache, dass Jakob auf einer Intensivstation lag, auf der alle anderen Babys viel zu schwach zum Stillen waren, wurden eben alle Säuglinge gleich behandelt.«
»Das ist schön, dass zumindest Ihre Freundin für Sie da war«, sagte Frau Wunschenstein.
»Ja, das war es«, erwiderte ich. »Juliane ist ein Mensch, der unser Leben ausmacht, es verändert. Sie feierte mit uns Silvester und brachte uns eine Wunderkerze in der Form des Buchstaben J mit, die ich bis heute noch habe. So feierten wir zu dritt. Mein ganzes Leben hatte ich den Jahresabschluss immer mit vielen Menschen verbracht, auf Partys, in Restaurants, auf Schiffen vor der Skyline in New York und auf Wolkenkratzern in Frankfurt, mit viel Delikatessen und Champagner, es war immer laut und lustig gewesen. Aber jetzt war es ganz anders, es war besinnlich. Ich feierte den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Ich war Mutter geworden und hatte das wunderbarste Kind der Welt. 2005 konnte kommen.«
»Und wie ging Jakobs Kindheit weiter?«, fragte Frau Wunschenstein. »Wie waren Kindergarten- und Schulzeit?«.
»Die Kindergartenzeit war prima, er ging unglaublich gerne in die Kita, und obwohl er schon mit zehn Monaten dorthin kam, hatte er sofort viele Freunde jeden Alters, wie immer sein ganzes Leben bisher«, berichtete ich. »Eingeschult habe ich ihn 2009 – ein Jahr früher als normal, denn er war noch fünf Jahre alt. Wir waren umgezogen, es gab keine Kindergartenplätze am neuen Wohnort. Jakob war aufgeweckt und hatte sich in den letzten Monaten in der Kita nur gelangweilt. Deshalb war klar für uns, er geht nach dem Umzug in die Schule. Wir, Jakobs Vater und ich, waren jung und unbedarft, und so wussten wir alles besser als die anderen.
Wie oft habe ich mich in den letzten Jahren an den Test vor der Einschulung erinnert, und an den Schulpsychologen im Bergischen Land, wo wir zu der Zeit wohnten. Bis heute denke ich an diesen Mann, der mir damals einen psychologischen Dolchstoß gab, der mir den Tag des Tests – unseren Tag, wir wollten feiern und essen gehen – gründlich verdorben hatte. Er machte verschiedene Tests mit Jakob. Memory, Zahlen, Buchstaben usw. Wir hatten lange gewartet, der Junge war müde, er hatte sich auf seinen Ellenbogen abgestützt und machte alles ohne große Leidenschaft. Als er fertig war, sagte der schulpsychologische Dienst: »Sie können ihn einschulen, aber egal, wann Sie ihn einschulen, dieses Kind wird in der Schule immer massive Probleme haben, es wird alles wahnsinnig schwierig werden.« Diese Worte sagte er, ohne meinen Sohn zu kennen, zu mir, vor Jakob. Es war schrecklich, ein Schlag in die Magengrube. Ich konnte nichts sagen und verließ das Zimmer mit dem Kleinen an der Hand und einem Tränenschleier vor Augen.«
An dieser Stelle meines Berichts legte Frau Wunschenstein ihre Hand auf meinen Arm und sagte: »Das tut mir sehr leid. Für Sie, aber vor allem für Ihren Sohn.«
»Ja«, fuhr ich fort, »ich habe damals nicht gezweifelt, ihn einzuschulen, auch deshalb, weil er sagte, dieses Kind wird immer massive Probleme haben. Vor allem aber fand ich es unsagbar ungerecht. Heute würde ich ihn gerne nochmals fragen, wie er damals zu seiner Einschätzung gekommen ist. Denn die zehn Jahre Schuljahre, die Jakob bislang absolviert hat, waren für ihn und für mich die Hölle. Und es war egal, in welche Schule er ging. Ob die bewegungsfreudige Grundschule auf dem Land, zu der er irgendwann nicht mehr hinwollte, morgens vor der Schule mit acht Jahren schon weglief durch die Felder, wo er sich im Unterricht immer wieder unter den Tisch legte. Oder das kirchlich und sozial engagierte Gymnasium, in das wir ihn 2013 einschulten. Die Schule, in der er nach kurzer Zeit mangelhaft hatte in Fächern wie Religion oder Geschichte, weil er sich überhaupt nicht beteiligte und sich weigerte, für Prüfungen länger als zehn Minuten zu lernen. Und bevor Sie jetzt fragen, Frau Wunschenstein, nein, er hatte kein ADHS, das war mehrfach geprüft worden, genauso wenig, wie er hochbegabt war. Er war einfach anders als alle Kinder, die ich kannte. Später, ab 2017, ging er in die Bezirksschule hier in der Schweiz, wo er die 7. Klasse wiederholte, den Stoff zwar kannte, doch mangels Lernens und Anwesenheit wegen Bauchkrämpfen und Kopfschmerzen den Schultyp nicht schaffte. Die Umschulung zur Sekundarschule folgte anschließend. Aber auch hier hatte er dieselben Beschwerden, und immer wieder versuchte ich, die Ursache herauszufinden und konsultierte Schulpsychologen, Lerncoaches und zur schulischen Verbesserung Nachhilfelehrer.«
»Und was haben diese Tests, die Untersuchungen ergeben?«, fragte Frau Wunschenstein.
»Tja«, antwortete ich, »er ist durchschnittlich intelligent, normal begabt, sozial unauffällig bzw. sozialer als die meisten seines Alters. Er hat eine hohe Auffassungsgabe, ist freundlich, aber? Eigentlich nichts. Keiner konnte mir sagen, ob er überfordert war.«
»Könnte es die Trennung vom Vater gewesen sein?«
»Wenn ich das wüsste«, antwortete ich. Der Vater ist für mich ein Mensch, der so selbstverliebt ist, dass er nie imstande war, sein eigenes Kind zu lieben. Oder irgendwann nicht mehr zu lieben, als es schwierig wurde. Als Jakob mit zwei bis drei Jahren schon ziemlich klar sagte, was er wollte, ab dann jedenfalls. Ja, zu der Zeit war es schon auffällig, er wollte zum Leichtathletiktraining gehen und dann, nach drei Malen, doch nicht mehr. Dann gefiel ihm das Reiten – auch genau drei Mal. Fußball fand er toll, er spielte es auch länger, aber die Lust zum Training war oft nicht da. Er war rastlos, wirkte auf mich immer wie ein Suchender. Bis heute glaube ich, sein Vater sieht mich in seinem Sohn, weil auch ich rastlos bin, weil auch ich die Freiheit über alles liebe und brauche. Der Vater hingegen ist ein bodenständiger Sicherheitsmensch. Er hat immer Geld auf dem Konto, träumt vom Eigenheim, ist gegen alle Risiken des Lebens versichert und hasst Überraschungen. Und Jakob? Jakob musste zum einen diese extrem unterschiedlichen Eltern jahrelang aushalten. Und wissen Sie was? Ich glaube, weil er ja die Gene von uns beiden in sich trägt, dass er auch im Inneren bis heute die Kämpfe dieser in sich vereinigten Extreme austrägt.« Und als ich sah, dass Frau Wunschenstein nickte, fuhr ich fort. »Wissen Sie, ich weiß nicht, was das Problem des Vaters war. Vielleicht war die Ursache auch, weil Jakob ihm meine Aufmerksamkeit nahm, weil der Junge mich brauchte und bis heute mehr braucht als die anderen beiden?« Ich zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Je schwieriger es mit Jakob wurde, umso aggressiver wurde sein Vater, er schmiss seine Hausaufgaben in die Mülltonne und brüllte ihn an: So wird aus dir nur Müllmann, Du kannst nichts! Bei diesen Worten zerbrach ich innerlich – ich verteidigte mein Kind, und wir hatten unendlich viel Streit. Als wir nur noch solche Szenen hatten, ging ich, brach aus dieser Höllenehe mit meinen Kindern. Und das in der Elternzeit ohne Job. Der Job war nach Berlin gegangen, wo mein damaliger Mann nicht hinwollte mit drei kleinen Kindern und einem neu gebauten Haus. Ich ging nicht, ohne vorher alles versucht zu haben, diese Ehe zu retten, aber wir haben es nicht geschafft. Er lehnte eine Eheberatung ab, und wir fanden nicht mehr zueinander; zu groß war der Abstand geworden, als dass wir ihn hätten überwinden können. Wie oft lag ich weinend auf Sofa, Sessel, Fußboden, weil mich er beschimpfte, beleidigte, demütigte. Als er es mit Jakob tat, hatte ich endlich die Kraft, einen Schlussstrich zu ziehen. Wissen Sie, Frau Wunschenstein«, fuhr ich fort. »Ich glaube, mein Ex-Mann liebt seine Kinder vielleicht schon, aber eben anders, als ich sie liebe, und wohl auch anders, als ich es mir gewünscht habe. Drei Jahre nach der Trennung gab es zwei Ereignisse, die ihn vielleicht als Vater präzise beschreiben.«
»Erzählen Sie«, sagte Frau Wunschenstein.
»Wir hatten einen Termin beim Jugendamt, um die Wochenendregelung zu besprechen. Dort teilte er unserer Sachbearbeiterin mit: »Es mag Väter geben, die am Wochenende das Leben ihrer Kinder kennenlernen wollen. Aber ich, ich bin Chirurg, ich habe wahnsinnig anstrengende Wochen, ich rette tagtäglich Leben. Ich bin nicht bereit, am Wochenende die Kinder zu Geburtstagen und Sportturnieren zu fahren. Am Wochenende ist meine Zeit, ich muss mich erholen, und die Kinder müssen dann eben mein Leben kennenlernen.« Das andere Ereignis, das ihn treffend beschreibt, ist folgendes: Wenn er Bella an den Vater-Wochenenden abholte, wollte diese häufig nicht mit und weinte. Einmal versuchte ich sie zu beruhigen und sagte zu ihr: »Vielleicht kauft Papa dir noch eine Zeitschrift Prinzessin Lillifee und ihr lest die zusammen.« Mein Ex erwiderte daraufhin schroff: Ganz sicher nicht. Ich muss meine Tochter nicht kaufen. Sie muss begreifen, dass es egal ist, ob sie will oder nicht, ich bin ihr Vater und ich habe ein Recht, sie an den Wochenenden zu sehen.« Nach diesen Worten trug er sie schreiend ins Auto. Sie war damals vier Jahre alt. Auch vor der Trennung war er kein anderer Mensch, kein anderer Vater. Ich war wirklich sehr unglücklich in meiner Ehe. Und als ich im September 2011 meinen vier Geschwistern meinen Kummer offenbarte, viele Geschichten erzählte über meine letzten Jahre, da weinte mein Bruder und sagte mir: »Fine, du musst da weg, und zwar sofort.« An dem Abend beschloss ich, mich zu trennen.«
»Das war gut, endlich«, sagte Frau Wunschenstein und ermutigte mich, weiterzusprechen.
Ich sandte ihr ein dankbares Lächeln. »Mithilfe meiner Geschwister trennte ich mich, meine Freundin Vivian packte mit mir seine Sachen, stellte sie vor die Tür und wir liessenließen die Schlösser austauschen. Ich musste das für mich so radikal machen, weil meine Leidens- und Trennungsphase schon viel zu lange ging. Zu viele Jahre hatte ich gehadert und gehofft, alles werde wieder gut. Aber da Jakobs Vater jegliche gemeinsame Therapie und Mediation verweigerte, war irgendwann klar, wir selbst konnten die Situation nicht mehr retten. Wir waren zu verschieden. Es war vorbei nach zehn Jahren, fünf gute waren dabei gewesen, der Rest war ein Albtraum für alle Beteiligten. Aber wissen Sie, wenn Psychologen heute sagen, das arme Kind musste die Trennung im Jahr 2011 verkraften, so weiß ich nicht, ob das oder nicht die Hölle davor mehr Schaden bei Jakob verursacht hat.«
»Da haben Sie recht«, unterbrach Frau Wunschenstein an dieser Stelle meinen Redeschwall. »Eine Trennung kann nicht für alles verantwortlich gemacht werden. Wann sind Sie denn hierher in die Schweiz gezogen, und wie war das für Ihren Sohn?«
»Ja das war 2017, vor zwei Jahren«, sagte ich und fuhr fort: »Es war ein Umzug, den ich mit den drei Kindern wagte, weil ich Abstand brauchte. Abstand vom Vater der Kinder, der keine Vereinbarungen, keine Grenzen einhielt – nie. Der sie mal abholte, mal nicht, mal nur einige, und immer nur dann und für so lange, wie es ihm passte, der ins Haus marschierte durch offene Terrassentüren und unser Leben kommentierte und kontrollierte. Er hatte sich ein neues Leben aufgebaut mit seiner Freundin, eine neue Wohnung bezogen und lebte sein neues Glück aus. Ich war nicht neidisch, ich hatte die Kinder, das war viel mehr wert. Aber ich hatte keine Chance, mir auch nur ein kleines Stück neues Leben aufzubauen. Durch seine Unzuverlässigkeit wurde auch ich unzuverlässig. Meine Dates platzen regelmäßig, allein in Urlaub zu fahren scheiterte daran, dass man nie wusste, ob und wann er die Kinder nahm. Ich konnte nicht mehr und musste weg – weit weg. Mein Plan wäre Australien gewesen, dort habe ich Familie, das ist das Land meiner Träume – so wie für den kleinen Tiger und den Kleinen Bären. Oder Panama – da werden Wünsche wahr. Das bei Jugendämtern, Familiengerichten und dem Vater durchzusetzen war ausweglos, aber die Schweiz, 500 Kilometer entfernt, funktionierte. Die Kinder waren damals zwölf, zehn und sieben Jahre alt, und ich ging mit ihnen weg, weit weg. Ich ließ das gemeinsam gebaute Haus zurück, Familie und Freunde. Ich brauchte einen Ort für uns vier – ohne Störfaktoren. Jakob hat sich erst gesträubt. Auch seine Lehrer verurteilten mich für diesen Schritt, aber ich war mir sicher, ein Neuanfang wäre das Beste, was ihm passieren könnte. So kam er mit, seine Freunde aus Düsseldorf besuchten uns anfangs häufig. Aber irgendwann wurde es weniger, und nach kurzer Zeit hatte er schon wieder Dutzende neue Freunde. Bei Geburtstagen bekam er in den letzten zwei Jahren rund 400 Glückwunsche – tatsächlich rund die Hälfte davon »echte Bekannte« und keine Twitter- oder Instagramm-Freunde.«
Damit endete mein Monolog, und Frau Wunschenstein sah mich an.
»Wir werden es wohl nie herausfinden, warum sich die Dinge genauso entwickelt haben, es gibt immer mehrere Ursachen, und egal, was passiert ist und was noch passiert, machen Sie sich klar, es gibt keinen Schuldigen! Niemals!«, sagte sie eindringlich zu mir.
Recht hatte sie, wir mussten nach vorne blicken, das war immer meine Devise, egal, wie schwer die Zeiten auch waren. Und als ich dort in der Praxis bei Frau Wunschenstein saß und raus auf den See blickte, dachte ich: Wir haben wirklich viel erlebt, Jakob und ich, und auch Bella und Sido. Wir haben immer das Beste draus gemacht. Der Umzug in die Schweiz war zwar eine Flucht, für mich aber in ein Paradies. Die Berge, die Seen, die ausgeglichen Menschen, das auf Praxis und Natur ausgerichtete Schulsystem, die Sauberkeit der Städte, der Service … Das Leben war viel friedlicher als in Deutschland, die Menschen gingen bewusster miteinander um. Ich liebte mein Leben hier, es war nur gerade etwas anstrengend, wie ich gerne gegenüber meinen Freundinnen in Deutschland sagte. Mir fehlte eine Perspektive für Jakob und manchmal einfach auch jemand zum Ausheulen für mich. Ich musste mir wieder mal eingestehen, dass ich mich manchmal einfach nur ausruhen wollte und mittlerweile wirklich gerne jemanden gehabt hätte, an den ich mich anlehnen könnte.