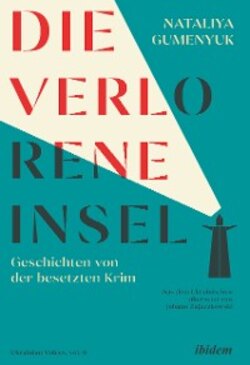Читать книгу Die verlorene Insel - Nataliya Gumenyuk - Страница 8
Vorwärts in die Vergangenheit
ОглавлениеSelbsternannte Kosaken kontrollieren die Ausweise der Passagiere, die auf die Krim reisen. Dschankoj ist der erste Halt auf der Halbinsel. Ich liege auf der oberen Pritsche eines Schlafabteils und täusche völlige Müdigkeit vor. Während ich meinen Pass hervorziehe, hebt sich mein Kopf fast unmerklich vom Kissen. Mein Smartphone ist sauber – kein einziges Foto vom Maidan ist darauf zu finden.
Ein Mann lugt in unser Abteil. Meinen Pass würdigt er kaum eines Blickes, und damit ist meine Einreise auf die Krim geglückt. Wir schreiben den 16. März 2014. Heute soll ein sogenanntes Referendum über den Status der Krim stattfinden. Der Zug fährt bis nach Sewastopol, ich steige in Bachtschyssaraj aus.
In der wichtigsten Stadt der Krimtataren gibt es weitaus weniger Anhänger des „Russischen Frühlings“1 als dessen ausgesprochene Gegner. Der Zug hat eine Verspätung von etwa 25 Minuten. Es stellt sich heraus, dass Kosaken pünktlich am Bahnhof waren, dann aber, ohne die Ankunft des Zuges abzuwarten, unvermittelt wieder abgezogen sind.
Faktisch wurde die Krim bereits erobert und besetzt. Die schlimmste Befürchtung ist eingetreten. Diejenigen, die versuchten, Widerstand gegen die Okkupation zu leisten, Aktivisten, die alles daransetzten, um die „grünen Männchen“2 – sprich: russische Soldaten – zu entlarven, wurden verprügelt und weggesperrt. Nach Lage der Dinge kontrolliert die Armee der Russischen Föderation bereits das Territorium der Halbinsel. Und obwohl über manchen ukrainischen Militärbasen noch die ukrainische Flagge weht: der Bruch ist vollzogen.
Doch am Tag der sogenannten „Abstimmung über die Unabhängigkeit der Krim“ weigern wir uns noch, diese neue Realität zu akzeptieren, und hoffen darauf, die Zeit zurückdrehen zu können.
Über dem bekannten krimtatarischen Café Musafir weht die Flagge der Krimtataren. Das Lokal liegt ein Stückchen oberhalb des Weges. Mit meinem Smartphone filme ich ein vorbeifahrendes – ein russisches – Militärfahrzeug. Ich möchte daran glauben, dass die Aufnahme als Beweis für die Präsenz ausländischer Truppen taugt.
Im Musafir arbeiten mehrere Journalisten aus verschiedenen Ländern an ihren Laptops. Ich habe eine Tarnidentität. Wahlweise gebe ich vor, eine lokale Übersetzerin oder die Freundin eines estnischen Journalisten zu sein. Mein „Freund“ war einst der jüngste Abgeordnete des estnischen Parlaments. Er war der einzige EU-Politiker, der 2004 während der Orangenen Revolution im Zeltlager auf dem Maidan lebte. Jetzt ist er einfach freiberuflicher Journalist. Ich habe die Kontakte zu den Protagonisten und werde Geschichten für den Internet-Fernsehsender Hromadske aufschreiben, und solange wir zusammenarbeiten, begleitet er mich zu allen Interviews und Treffen und schreibt Texte für estnische Medien.
Der Maidan ist gerade zu Ende gegangen und die Arbeit von Hromadske schlägt hohe Wellen. Das Bild eines Kollegen wird auf den Kundgebungen der Separatisten gezeigt – als Zielscheibe. Jetzt ist nicht die Zeit für Live-Übertragungen von der Krim; man erregt besser keine Aufmerksamkeit und behält den aktuellen Aufenthaltsort einer ukrainischen Journalistin für sich. Meine Aufgabe besteht somit weniger darin, Aufmerksamkeit zu generieren, als vielmehr darin, herauszufinden, was hier wirklich vor sich geht. Mein Kollege ist einige Tage früher angekommen und hat es geschafft, gemeinsam mit einem estnischen Fernsehteam (das nicht länger auf der Krim erwünscht ist) einige Szenen einzufangen. Er hat auch Perewalne besucht, wo er russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen gefilmt und das Material an uns weitergereicht hat. Die bewaffneten Männer mit vermummten Gesichtern hüllten sich einfach in Schweigen, und den Ortsansässigen mit ihren schwarz-
orange gestreiften Georgsbändchen3 stand auch nicht der Sinn nach einer Unterredung mit EU-Bürgern. Besagter Kollege hat auch die letzte große proukrainische Kundgebung am Tag vor dem „Referendum“ am Taras-Schewtschenko-Denkmal4 in Sewastopol verfolgt. Der gesamte Platz sei in ein Meer aus blau-gelben Flaggen getaucht gewesen.
Noch bevor ich herausfinde, wie ich zum Wahllokal gelange, erfahre ich, dass der berüchtigte prorussische Aktivist Johan Bäckman zur Unterstützung der Annexion aus Finnland auf die Krim gereist ist. Bäckman bestreitet vehement die Existenz eines unabhängigen Estlands, wurde dort zur Persona non grata erklärt und darf schon lange nicht mehr an finnischen Universitäten unterrichten. Ab Juli 2014 wird sich Bäckman selbst als offiziellen Repräsentanten der „Volksrepublik Donezk“ in Finnland bezeichnen. Damals waren solche Vertreter der „Russischen Welt“5 für uns noch Neuland.
„Gegen Mittag hatten bereits 461 Person abgestimmt. Alle sind sehr aktiv! Viel junges Volk. Ich bin nicht zum ersten Mal Mitglied einer Wahlkommission. Alle behaupten immer, dass die Jugend unpolitisch sei, aber die ersten, die ihre Stimme abgegeben haben, waren fünf junge Leute“, berichtet eine Frau, Mitglied einer sogenannten Wahlkommission im Stadtzentrum von Bachtschyssaraj. Das baufällige, einstöckige Gebäude ist größtenteils verrammelt und wurde eigens für die Wahlen auf Vordermann gebracht.
Die Frau rechtfertigt die großen Lücken im Wählerverzeichnis damit, dass zur Vorbereitung der Abstimmung nur wenig Zeit geblieben sei. Daher dürfen auch jene, die nicht auf der Liste stehen, „abstimmen“. Wir beobachten den Ablauf:
„Hier ist der Antrag von Nadija Wolodymyrowna Ionowa auf Aufnahme in die Liste.“ Es wird abgestimmt; der Antrag wird angenommen.
„Nun kommen Sie her, nehmen Sie einen Stimmzettel und wählen Sie“, fordert die Organisatorin die Frau auf.
Wenige Stunden später treffen wir im selben Wahllokal eine befreundete Journalistin mit russischem Pass. Sie erzählt uns, dass sie soeben bereits in einem anderen Wahllokal in Bachtschyssaraj ihre Stimme abgegeben hat.
„Finden Sie, dass Russland eher zum Vorbild taugt als Europa?“, fragt mein estnischer Kollege eine junge Familie, die zum Wahllokal gekommen ist.
„Natürlich, in Russland steht alles zum Besten, dort herrscht Stabilität. Die EU ist definitiv kein Vorbild, und Lettland schon gar nicht.“
„Wir sind aus Estland.“
„Estland? Auch kein gutes Vorbild. Was gibt´s da schon Gutes? Die Leute dort leben schlechter. Wir waren in Serbien, die Leute dort machen sich scharenweise aus dem Staub.“
„Serbien? Aber Serbien ist nicht in der EU.“
„Das nicht, aber sie haben ein Integrationsabkommen unterschrieben, deshalb geht das Land mit jedem Jahr mehr vor die Hunde. Und meine Freunde in Riga sind auch nicht eben begeistert: die Lebenshaltungskosten steigen, das Rentenalter ebenfalls, die Gehälter sinken. Die treiben die Menschen in den Ruin.“
Die Wahlleiterin beteuert, dass auch Krimtataren ihre Stimmen abgeben. Der Medschlis des Krimtatarischen Volkes6 hat den Boykott des „Referendums“ beschlossen. Dies bestätigt auch Achtem Tshijhos, der stellvertretende Vorsitzende des Medschlis – und zu diesem Zeitpunkt auch Abgeordneter des Bezirksrats von Bachtschyssaraj. Sein winziges Büro ist nur einen Steinwurf vom vermeintlichen Wahllokal entfernt und öffnet am Nachmittag. Da berichten die russischen Medien bereits über die erfolgreiche Abstimmung. Tshijhos spricht im Brustton der Überzeugung: „Das ist eine Provokation, eine Farce, damit wollen wir nichts zu tun haben. Hier im Bezirk Bachtschyssaraj und in einigen unserer kleineren Siedlungen haben sich die Krimtataren nicht an der Bildung von Wahlkommissionen beteiligt. Wir sind seit vielen Jahren eine feste Größe bei der Wahldurchführung auf der Krim. Zur Wahlbeteiligung muss ich nicht viele Worte verlieren – die ist natürlich gering. Den Informationen zufolge, die wir aus unserer Region erhalten haben, hat nur ein Bruchteil der über 25.000 hier lebenden Krimtataren an den Wahlen teilgenommen. Wir sind uns darüber einig, dass unsere Heimat in Gefahr ist. Dieses Gefühl lastet jedem auf der Brust – sowohl denen, die die Deportation durchlitten haben, als auch jedem Kind, wenn es sich schlafen legt. Morgen werden wir aufwachen und den Kampf um unsere Rechte fortsetzen. Die Form des Kampfes wird von der Problemlage abhängen. Doch wir, die Krimtataren, sind Bürger der Ukraine.“
Wir stehen vor einem der größten Wahllokale im Dorf Turheniwka. Ein Mann mittleren Alters mit Schiebermütze und Lederjacke stellt sich lächelnd als „Onkel Tolja“ vor. „Na aber selbstverständlich“ habe er abgestimmt.
„Und wofür haben Sie gestimmt?“
„Ja keine Ahnung, wie das alles jetzt gelaufen ist.“
„Wofür nun? Für die Vereinigung mit Russland?“
„Und wohin geht dieses Video?“
„Nach Kyjiw.“
„Oh, nein! Dann nicht. Das zeigt ihr sowieso nicht!“
„Doch, na klar, warum denn nicht?“
„Ich sage nichts. Ich habe zwar gewählt, aber jetzt weiß ich nicht, ich horche in mich hinein und frage mich, wozu das Ganze gut sein soll.“ Er zuckt mit den Schultern.
„Und was wird morgen geschehen?“
„Morgen wird ein schwerer Tag, aber die Leute werden erfahren, dass alle auf der Krim nach Russland wollen.“
Onkel Tolja ist überzeugt, dass die Krimtataren das Referendum boykottiert haben. Er führt aus: „Ihr Tschubarow7 will es nicht, er hat es verboten. Und nun hocken sie in ihren Hütten, keine Spur von ihnen in ganz Bachtschyssaraj. Ist so. Hast du hier etwa einen einzigen Tataren gesehen? Fehlanzeige. Die wollen nicht nach Russland. Die Tataren haben Angst, vielleicht zu Recht. Russland wird ihnen die Daumenschrauben anlegen. Die Ukraine fürchten sie nicht, dort herrscht Chaos, und sie hocken auf dem Basar herum, schachern, arbeiten in die eigene Tasche, geben nichts an den Staat, aber streichen ihre Rente ein. Und die kommt aus Donezk, wo die Fabriken stehen. Russland wird ihnen schon verklickern, dass man schuften muss, anstatt auf dem Basar die Zeit totzuschlagen.“
Mehr an sich selbst gewandt, überlegt er laut, was ihn an der Ukraine stört: „Wir wollen ein ganz normales Leben. Aber die pressen uns hier aus. Das Geld von den Touristen fließt nach Kyjiw, und wir sehen
keine müde Kopeke. Wenn bei euch in Kyjiw der Mindestlohn bei 2.500 Hrywnja liegt, dann sind es hier 1.000.8 Damit kommst du nicht weit. Im Fernsehen zeigen sie, dass man in Kyjiw 8.000, ja sogar 10.000 Hrywnja kriegen kann. Klar sind die dort für die Ukraine! Würden die nur mal bei uns leben. Nun, wir haben Janukowytsch gewählt, diesen Dreckskerl. Ja, wir haben für ihn gestimmt, für wen auch sonst. Hätten wir denn wissen können, was das für ein Typ ist? Die eigenen Taschen hat er sich vollgestopft.“
„Glauben Sie etwa, dass es in Russland keine Korruption gibt?“
„Keine Ahnung, aber zumindest setzt Putin jede Woche einen dieser korrupten, betrügerischen Gouverneure aus allen möglichen Oblasten vor die Tür. Unter Julija Timoschenko hatten wir zwei Stunden täglich Strom, es gab kein Benzin, Busse fuhren nicht. Und die soll jetzt eine Heldin sein? Habt ihr die dreistöckigen Hütten gesehen, die die sich gebaut haben? Wir sind hier weit ab vom Schuss, wir haben im Dreck gelebt und wir werden weiter im Dreck leben.“
In Kyjiw herrscht der Eindruck vor, dass die Krim hinter Janukowytsch stand – die Halbinsel als Hochburg jener „Partei der Regionen“, die mit dem NATO-Beitritt kokettiert und politisches Kapital aus der Sprachenfrage geschlagen hat. Wir werden den Eindruck nicht los, dass die Menschen auf der Krim nicht das gesamte Ausmaß der Korruption des Ex-Präsidenten, der durch den Maidan aus dem Amt gejagt wurde, erfasst haben. Es scheint, als kämen wir einige Jahre zu spät. Die russische Botschaft auf der Krim lautet: „Alle ukrainischen Politiker sind wie Janukowytsch. Einzig Putin ist anders.“ Ein lokaler Aktivist pflichtet bei: „Weißt du, die Leute glauben, dass der korrupte Donezker Clan sich die Krim unter den Nagel gerissen hat und dass Russland so etwas nicht dulden wird.“
Ich möchte von Onkel Tolja wissen, ob er darauf setzt, dass Moskau ganz ohne Bedingungen Geld aushändigen werde. Doch dieser gerät ins Schwärmen über die Zeiten in der Sowjetunion, als es im Dorf noch drei Traktoristen-Brigaden gab. Onkel Tolja glaubt, dass Krieg vermieden werden kann und dass alle in Frieden leben werden: „Wir – die Ukraine und die Krim – sind eine Familie. Aber es ist besser, wenn jeder seinen eigenen Weg geht. Schlimmer kann´s nicht werden.“
„Wovor wir Angst haben? Es kursieren Gerüchte über ‚ethnische Säuberungen‘, das heißt die Vertreibung der ursprünglichen Bevölkerung der Krim; man will Bedingungen schaffen, die uns zwingen, unsere Heimatstätte zu verlassen.“ In diesem krimtatarischen Haus herrscht eine völlig andere Stimmung. Eine Gruppe von Lehrern hat sich hier versammelt. Die Altersspanne reicht vom Referendar bis zum Beamten im Ruhestand. Alle Augen blicken gebannt auf den Fernseher, über den Bilder des krimtatarischen Senders ATR flimmern. Schewket9 erläutert, dass selbst das Wissen um die Funktionsweise von Propaganda nicht vor Verblendung schütze: „Manchmal fängst du an, an deinen eigenen Gedanken zu zweifeln. Angenommen, du weißt, dass die Mitglieder der Berkut (Steinadler)10 auf dem Maidan Leute verprügelt haben. Im Fernsehen aber wird der Eindruck vermittelt, die Krimtataren wären das gewesen. Sowas schaukelt sich immer weiter hoch. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das deutsche Volk geblendet von Hitler und unterstützte ihn auf einer Welle des Nationalismus, der sich zum Chauvinismus steigerte. Und das hat schließlich zum Weltkrieg geführt. Die Gehirnwäsche des russischen Volkes durch die Massenmedien ist ebenso eine Bedrohung für die gesamte Welt.“
An diesem Tag haben sich die Frauen zum gemeinsamen Gebet versammelt: „Allah schenkte uns eine Heimat, auf dass wir mit anderen Völkern in Freundschaft und Harmonie leben. Wir sind froh, dass man in der Westukraine hinter uns steht. Wir unterstützen den Maidan. Wenn wir Worte der Fürsorge und der Solidarität vernehmen, kommen wir zur Ruhe. Wir haben Allah um seinen Segen gebeten, weiterhin in unserer Heimat und in Einigkeit mit der Ukraine leben zu können. Wir haben ihn auch darum gebeten, dass er Putin ein wenig Güte und Weisheit schenken möge, auf dass er seine Truppen und Soldaten, die hierhergekommen sind, abziehe, sie lebendig und unversehrt zu ihren Familien, Müttern und Frauen zurückkehren und hier wieder Friede einkehre wie vor ihrer Ankunft.“
Der Betreiber des Café Musafir, Lenur Osmanow, findet deutlichere Worte. Er sähe es gerne, wenn die Machthaber in Kyjiw die Strom- und Wasserversorgung unterbrechen würden, um den Krimbewohnern ihre Abhängigkeit vom Festland vor Augen zu führen: „Mir ist bewusst, dass man in Kyjiw vor einem Dilemma steht: wie setzt man solche Druckmittel ein, ohne den Menschen zu schaden? Doch wir Krimtataren haben die Deportation überlebt. Wir kennen weitaus schlimmere Verhältnisse – Strom und Wasser sind ein Witz dagegen. Jede Familie hat geliebte Menschen verloren. Daher kann man wohl behaupten, dass wir einiges aushalten. Die Ukraine sollte sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, dass sie ihre eigenen Leute in diese Lage gebracht hat. Die Krim ist ein Teil der ukrainischen Wirtschaft und Gesellschaft. Wir überstehen das.“
Switlana stammt aus Sewastopol und ist Lehrerin für ukrainische Sprache und Literatur. Ihr Tonfall bei unserem Treffen ist eindringlich: „Natalija, sag mir, wie ist das möglich? Im Radio wird behauptet, dass achtzig Prozent der Krimtataren beim Referendum abgestimmt hätten. Ich glaube das nicht. Halb so viele vielleicht, aber doch nicht achtzig?“
Mir kommt die Frage nach der Funktionsweise von Propaganda in den Sinn. Ein Mensch mag vielleicht glauben, dass diese oder jene Zahl etwas frisiert oder gefälscht ist, aber dass man dermaßen dreist lügen kann, das er kann sich nicht vorstellen.
Switlana lief mir damals buchstäblich vor die laufende Kamera. Ich war gerade auf der Institutska-Straße im Zentrum von Kyjiw auf Sendung, während die Menschen in den ersten Tagen nach der Tragödie zu Ehren der Gefallenen der Himmlischen Hundertschaft11 dort Blumen niederlegten. Ihre ukrainische Aussprache ist ungemein korrekt, fast theatralisch. Damals klagte sie mit Tränen in den Augen, dass niemand auf der Krim die Wahrheit über den Maidan kenne und man hinfahren und darüber berichten müsse, bevor es zu spät sei. Schließlich, so warnte sie, würden die Bewohner der Halbinsel gegen die Ukraine aufgewiegelt. Switlanas Mann ist Chorleiter bei der ukrainischen Marine. Sie hat viele Ehefrauen von Soldaten in ihrem Bekanntenkreis. Mehrere Wochen lang standen wir vom Sender mit ihnen in Kontakt, brachten Geschichten über die Blockade von Stützpunkten und sendeten Aufrufe zur Hilfe. Doch nach dem „Referendum“ verweigerte eine Ehefrau nach der anderen den Austausch mit Journalisten: Am Montag ein Live-Interview, am Dienstag ein Treffen, am Mittwoch selbst ein Telefongespräch. Weil alles seinen Sinn verloren hat. Der Verlust der Freiheit auf der Krim wird in diesen Tagen mit jeder Stunde deutlicher spürbar.
Am Stadtrand von Sewastopol, wo Switlana lebt, gibt es so gut wie keine Cafés, und mir wird klar, dass Vertreter ihrer Generation (zumal mit ihrem Gehalt) es nicht gewohnt sind, sich auf einen Kaffee zu verabreden. Sie bittet um ein Treffen im Zentrum, unweit des Markts. Es erscheint mir nicht sehr vernünftig, mit einem Videointerview unter freiem Himmel Aufmerksamkeit zu erregen. In einer Pizzeria im Einkaufszentrum finden wir noch eine freie Ecke. Switlana hat ihre Tochter mitgebracht, die noch zur Schule geht. Das Mädchen ist erschöpft. Wir haben Mühe, uns auf das Gespräch einzustellen, zumal ich es aufzeichne. Die Unterhaltung kommt gerade in Gang, da setzt sich eine Gruppe stämmiger Bartträger an einen großen reservierten Tisch neben uns. Sie sprechen irgendeine slawische Sprache. Ich kann nicht verstehen, was genau sie hier auf der Krim treiben. Stehen sie an den Straßensperren Wache? Hat sie die Sensationslust hierhergetrieben? Oder sind sie als Erfüllungsgehilfen der Annexion hier? Ich nehme meinen Mut zusammen und frage sie nach ihrer Herkunft. Sie schlagen ein Selfie vor und antworten, dass sie aus Novi Sad kämen. Gelegentlich tauchen in den Newsfeeds zur Krim auch Berichte über Tschetniks auf – serbische Nationalisten, die Russland unterstützen. Höchste Zeit, unser Gespräch an einem anderen Ort fortzusetzen. Durch die Verzögerung bin ich für das nächste Interview bereits spät dran.
„Jurij, ich brauche Ihre Hilfe. Wir schaffen es nicht rechtzeitig zu Ihnen und ich habe eine Bitte. Wir wollen noch mit einer anderen Person sprechen, doch ihr Kind ist müde, und wir haben keinen guten Ort für unser Gespräch gefunden. Können wir vielleicht zu Ihnen kommen?“, bitte ich den mir im Grunde unbekannten jungen Mann, den mir ein Bekannter vermittelt hat. Jurij ist in der IT-Branche tätig. Von ihm will ich wissen, wie die unpolitische Jugend und die Unternehmer zu den Ereignissen auf der Krim stehen. Ich will möglichst unterschiedliche Menschen treffen, um zu verstehen, was die Menschen auf der Krim wirklich umtreibt.
Nach einer Stunde Fahrt stehen wir endlich vor dem modernen Büro. Wir sind in Eile und müssen nun zwei Gespräche, die nicht unterschiedlicher sein könnten, irgendwie unter einen Hut bringen. In diesem Moment scheint es, als wären zwei gegensätzlichere Charaktere kaum vorstellbar: Hier die leidenschaftliche Lehrerin, die stundenlang über ihren Stolz auf ihre Schüler und deren Erfolge bei den Schewtschenko-Spracholympiaden reden kann – dort der russischsprachige IT-Spezialist, ruhig und sachlich; bemüht, sich aus der Politik herauszuhalten.
„Am meisten beunruhigt mich die Polarisierung der Meinungen. Meine Freunde und ich streiten uns bis zur Heiserkeit. Bisher ist es gelungen, die persönliche Ebene bei den Auseinandersetzungen außen vor zu lassen, aber das gestaltet sich immer schwieriger“, erzählt Jurij. „Einige meiner Freunde haben die Milizen an den Straßensperren mit allem Lebensnotwendigen versorgt. Die haben das damit begründet, dass diejenigen, die uns angeblich verteidigen, doch Zigaretten und warme Kleidung bräuchten. Ich halte dann immer dagegen: ‚und vor wem beschützen die uns? Ich sehe keine Gefahr.‘ Ich sehe nur Propaganda, die uns weismachen will, dass die Benderiwtsi12 im Anmarsch sind. Das ist lächerlich. Und diese Straßensperren, die sind nichts weiter als Kriegsspielchen erwachsener Männer. Mir scheint, dass die zunehmenden Spannungen für manche nur ein Vorwand sind, um endlich die Waffen sprechen zu lassen. Ich habe aber auch Freunde, die zu den ukrainischen Stützpunkten gefahren sind und Lebensmittel durch den Zaun gereicht haben.“
Switlana wechselt in druckreifes Russisch: „Wenn ich jetzt Russisch sprechen und Mütterchen Russland als Heimat anerkennen würde, ich würde nirgendwo anecken und in der Masse aufgehen. Doch wenn ich meine Pflichten so gewissenhaft erfülle wie zuvor, sogar noch gewissenhafter, aber dabei Ukrainisch spreche, bringe ich mich und meine Familie in Gefahr. Wie kann man nur der Sprache wegen einen Krieg zwischen zwei Brüdervölkern lostreten? In den Familien hat dieser Krieg bereits begonnen; sie brechen auseinander. Heute im Bus haben sich die Leute gegenseitig zum Feiertag gratuliert. Ich ließ es darauf ankommen und fragte: ‚zu welchem Feiertag denn?‘ ‚Ja wie, wir sind doch seit heute Unabhängig!‘ Ich entgegnete: ‚Welche Unabhängigkeit?‘ – ‚Na, heute haben wir uns Russland angeschlossen.‘ Dabei zeigt ein Blick ins Wörterbuch, dass die Begriffe ‚Unabhängigkeit‘ und ‚Anschluss‘ unterschiedliche Bedeutungen haben. Doch dir steht nicht zu, diesen ‚Feiertag‘ zu verweigern. Und wenn wir für das Recht einstehen, dass Sewastopol ukrainisch bleibt, bringen sie uns einfach um…“ sie ringt um die richtigen Worte „…die schlachten uns einfach ab!“
„Sie haben gerade das Wort ‚abschlachten‘ verwendet…“
„Weil es genauso gesagt wurde! ‚Ihr Benderiwtsi gehört abgeschlachtet! Ihr Faschisten!‘ Was geht nur vor in den Köpfen der Menschen? Es zerreißt dir das Herz, wenn du solche Dinge hörst. Wir leben hier wie Geiseln, ohne zu wissen, wie wir uns verhalten sollen: reden oder schweigen. Viele haben ihre Gesinnung bereits gewechselt, manche sind geflohen, andere untergetaucht, wieder andere sind verstummt. Die Fernsehsender in Sewastopol, auf der Krim – wohin man auch schaut, überall verzerrte Informationen. Die Menschen fürchten sich davor, aufs Festland zu reisen: ‚In der Ukraine werdet ihr getötet, Faschisten haben dort die Macht ergriffen – bleibt besser auf der Krim!‘ Sowas wird ihnen eingetrichtert. Aber ich war dort, vom Faschismus keine Spur.“
Ich kann Switlanas Wut nachvollziehen. Sie sucht das Gespräch mit Kollegen und ist bestrebt, Andersdenkende umzustimmen. Doch sie befürchtet, dass sie nichts ausrichten kann. Jurij hält sich bedeckt, daher will ich wissen, ob er keine Angst verspüre: „Wovor sollte ich Angst haben? Ich gebe nur wieder, was ohnehin in aller Munde ist. Wir schlagen uns mit gesperrten Bankkonten herum. Schon vor dem Referendum konnte man kein Geld mehr abheben. Ich fürchte, dass diejenigen, die hier an die Macht gekommen sind, die Krim einfach zur Plünderung freigeben. Sie werden sich wie kleine Fürsten aufführen und den Kurs von Janukowytsch fortsetzen. Sie schnappen sich seine Villen und bauen sich noch ein paar neue dazu.“
***
Was bildest du dir ein, mein Schatz?
Willst um den Finger wickeln?
Die Mädchen woll‘n dich aber nicht,
siehst aus wie ein Karnickel!
Auf dem Basar war ich vor Kurzem,
da zeigten sie ein Märchen.
‘ne Alte hat‘n Gaul geknutscht,
Fedja hieß das Pferdchen.
Russland und die Ukraine –
oh dichter Beerenstrauch,
der Grenzmann schützt die Heimat
heuer vor der Heimat auch.
Eine Frau mit einem angehefteten Georgsbändchen tanzt und singt dabei diese Zeilen. Ein Großväterchen mit Akkordeon sorgt für die musikalische Begleitung. Eine „spontane“ Feier findet hier statt. Auf dem Nachimow-Platz in Sewastopol hat sich eine Gruppe von etwa 30 Personen, darunter vorwiegend Rentner, eingefunden. Viele tragen Fahnen mit Portraits von Putin und Medwedjew.
„Wir, die Sewastopoler, sind russische Menschen, heute sind wir das allerglücklichste Volk, und ich wünschte, alle Menschen auf dem gesamten Erdball wären so glücklich wie wir es heute sind. 23 Jahre lang hatten hier die Besatzer das Sagen, und nun kehren wir endlich heim. Wenn es von uns verlangt wird, stehen wir bereit, um Tag und Nacht zu marschieren. In dieser Stadt hat immer russische Ordnung geherrscht, Ukrainisch haben wir nie gelernt, und die Älteren konnten die Packungsbeilage ihrer
Medikamente nicht lesen. Wie ist so etwas möglich? All die Jahre mussten wir ein Wörterbuch zur Hand nehmen, um uns nicht zu vergiften und an unserer Medizin zu sterben“, ereifert sich eine Frau fortgeschrittenen Alters in Matrosenshirt und Schiffchenmütze. Eben noch hatte sie mit einem Großväterchen in Kapitänsmütze getanzt.
„Wir haben diesen Moment so lange herbeigesehnt. Alles geschieht zur rechten Zeit! Was willst du da machen?!“, ergänzt das Väterchen mit einem breiten Grinsen: „Begreif doch, Kindchen: Kyjiw wurde von Banditen erobert. Hätte man ihre Machenschaften sofort im Keim erstickt, wäre das alles hier nicht passiert. Wir alle hier wären nicht zu Russland gekommen. Während wir in Untätigkeit verharrt hätten, hätten sie uns die Nationalgarde auf den Hals gehetzt. Hätte, hätte – wenn wir nicht rechtzeitig gehandelt hätten.“
Der Mann ist an die achtzig Jahre alt. Er bezeichnet sich selbst als Sewastopoler mit russischen Wurzeln, auch wenn er seine gesamte Kindheit mit ukrainischen Halbstarken in Sibirien verbracht habe: „Wie könnte ich den Ukrainern Vorwürfe machen? Die ukrainische Sowjetrepublik war die mächtigste Republik der gesamten Sowjetunion –und ihre Kornkammer. Wenn Donezk und Luhansk doch nur einen Anführer wie unseren Aksjonow13 hätten und eine Bürgerwehr auf die Beine stellen könnten, dann könnten sie eine Schwarzmeer-Republik gründen. Doch man hat die Fürsprecher des Volkes verhaftet. Ich weiß, dort hat ihnen die Unterstützung gefehlt, und hier steht die gesamte Schwarzmeerflotte hinter uns.“
„Die Ukrainer sind ja auch ein gutes Völkchen, das schon“, fährt die Frau mit der Marinekappe fort: „Aber dann kam diese Bande daher und sorgte für Ärger. 2008 habe ich im Urlaub in den Karpaten eine Familie aus der Nähe von Kyjiw getroffen. Großartige Menschen! Wir konnten uns in jeder Sprache unterhalten. Und so friedfertig! Es gibt keinen Grund, uns in die Enge zu treiben.“
Während der Videoaufnahme erwähne ich den Umstand, dass ich aus Kyjiw komme und bei Hromadske arbeite, mit keinem Wort. Doch ich gebe auch nicht vor, gebürtig von der Krim zu stammen. Und so kommt die Gruppe auf die Beziehung zwischen der Krim und der Festlandukraine zu sprechen – auf dass man sie „da drüben“ hören möge.
„Turtschynow14 hat selbst gesagt, dass er die Russen auf die Knie zwingen, ihnen den Prozess machen und sie bestrafen wird!“, beteuert eine streng dreinblickende Frau mit Brille. Im Gegensatz zu den anderen Gesprächspartnern hat sie kein einziges freundliches Wort übrig.
„Wird Ihnen das im Fernsehen erzählt?“
„Natürlich! Ganz selbstgefällig saß der da, runzelte die Stirn und blähte seine Backen. Was glauben Sie denn, warum die Leute sich jetzt erheben? 23 Jahre haben die einfach so vor sich hingelebt, sich nicht beschwert und die Klappe gehalten. Die hatten Angst – bis jetzt.“
Wie so viele kommt sie auf die „Sprachenfrage“ zu sprechen: „Ich will Ihnen mal was klarmachen. Wir haben Spielzeug gekauft, das war nur auf Chinesisch, Englisch und Ukrainisch beschriftet. Da weißt du nicht, ob die Kreide gegen Kakerlaken ist oder ob die Kinder damit auf der Tafel schreiben können!“
Mir scheint, als hätte ich die Geschichte von der Insektizid-Kreide bereits irgendwo gehört. Ein junger Mann in Militäruniform hängt sich jetzt das Akkordeon um. Eine solche Uniform wird mir schon bald darauf erneut im besetzten Donezk begegnen.
Eine andere Frau tritt an mich heran, um ihre Meinung zu sagen: „Nach Abzug aller Steuern bleiben vom Gehalt noch 50 Dollar im Monat übrig. Davon muss man 18 Dollar nur für die täglichen Mahlzeiten abziehen. In Russland wird das anders sein.“ Die Leute bilden jetzt fast so etwas wie eine Warteschlange.
„Junge Dame, es gibt keine Probleme zwischen der Ukraine und Russland“, wirft ein stattlicher Mann mit Schnurrbart und Schiebermütze ein: „Die Menschen leben in Frieden und Eintracht, doch wenn nationalistische Ideen zum Maßstab allen Handelns gemacht werden, dann ist das nicht gut. Es hat doch niemand behauptet, dass in der Westukraine alle Menschen schlecht seien. Aber Nationalisten und Extremisten, die an die Macht kommen – was soll das bitteschön? Nehmen wir den Vorsitzenden der Partei ‚Swoboda‘, Tjahnybok, oder die Swoboda-Abgeordnete Iryna Farion, die dazu aufruft, alle Nicht-Ukrainer zu vernichten. Die beiden sagen schreckliche Dinge. Oder Jarosch,15 der allen Moskowitern16 den Krieg erklärt hat. Gut, Jarosch ist nicht an der Macht, aber er tritt bei den Präsidentschaftswahlen an! Die Ukraine kann doch in der Europäischen Union und in der Zollunion17 sein! Um Himmels Willen! Aber dann bitte ohne Nazismus und Extremismus, wie ein normaler, zivilisierter Staat. Ich glaube, dass die Leute in der Ukraine das alles früher oder später begreifen und sich davon lossagen. Dann sind einem solchen Volk Ruhm und Ehre gewiss, und ich werde mein Haupt vor ihnen verneigen!“
Das Akkordeon verstummt. Die ganze Gruppe hebt im Chor an:
Sewastopol, Sewastopol,
Stolz der Matrosen, Russen, der Deinen
oh legendäres Sewastopol,
Bollwerk wider alle Feinde!
***
Vom Nachimow-Platz aus wollen wir die Uferseite wechseln – auf die „Nordseite“, wie das Viertel in Sewastopol genannt wird. Dort befindet sich der letzte noch nicht eingenommene Stützpunkt samt der Wohnheime der ukrainischen Militärangehörigen. Die Fähre, ein öffentliches Verkehrsmittel, verkehrt von morgens bis abends und bewältigt die Strecke in einer Viertelstunde. Die meisten Passagiere sind Berufstätige auf dem Weg von der Arbeit zu den Plattenbausiedlungen am Stadtrand. Einige sind auf dem Rückweg von einem Konzert, das dem „baldigen Anschluss an Russland“ gewidmet ist. Formal ist es noch ein Tag bis dahin. Die Strecke mag zwar sehr kurz sein, doch die Vorstellung, auf dem Schiff Gespräche zu führen, behagt mir nicht. An Land kannst du einfach weggehen – hier gibt es kein Entkommen. Man hat uns den Tipp gegeben, beim Anlegen auf die Kaimauer zu achten. Vom Schiff aus soll eine riesige blau-gelbe Flagge zu sehen sein, die auf den Beton der Anlegestelle gemalt wurde – ein Symbol des gewaltfreien Widerstands, das immer wieder überstrichen und dann in monatelanger Arbeit neu aufgetragen wird. Wir versuchen zu filmen, aber in der Dunkelheit erweist sich das als unmöglich.
Am Pier erwartet uns ein ukrainischer Offizier im Ruhestand, um uns mit seinem Wagen zu seinen Bekannten zu bringen. Wir sind in Eile. Im Vorbeifahren erhasche ich einen Blick auf ein Schild: „Fliegerhorst Belbek“. Hier ist eine Brigade der taktischen Luftstreitkräfte stationiert. Der Begriff Belbek ist derzeit in aller Munde. Wie auch der Name Juli Mamtschur, Oberst der taktischen Luftwaffenbrigade des Luftwaffenkommandos „Süd“. Dieser Tage ist Belbek ein Symbol des Widerstands. Rund zwei Wochen zuvor, am 4. März 2014, rückten ukrainische Militärangehörige mit der ukrainischen Nationalflagge in den Händen und mit der ukrainischen Nationalhymne auf den Lippen unter der Führung von Mamtschur zu den bewaffneten Soldaten vor, die die Zufahrt zum Stützpunkt blockierten. Man schoss den Ukrainern vor die Füße. Im Laufe des Tages kam der Stützpunkt wieder unter ukrainische Kontrolle. Am 12. März brach jedoch ein Feuer im Stützpunkt aus, der zu diesem Zeitpunkt bereits von russischen Spezialeinheiten erobert worden war. Die Ukrainer haben es gelöscht.
Selbst jetzt, im Dunkeln, kann man noch die ukrainische Flagge neben dem Tor erahnen. Diese Nacht wird der Oberst nicht zuhause verbringen, dafür ist seine Frau Larissa vor Ort. Die Offiziersfamilie lebt in einem kleinen Zimmer im nahegelegenen Wohnheim.
Larissa hat eine direkte und bestimmte Art. Es scheint, als hätte sie ihre eigene soldatische Pflicht zu erfüllen. Ihre Stimme klingt nicht verzweifelt, dabei lassen ihre Worte anderes vermuten: „Es ist vorbei. Zu spät. Das einzige, was drängt, ist die Erlaubnis zum Verlassen des Stabs – und selbst das ist schon seit einer Woche überfällig. Alles, was die Einheit hätte bewachen sollen, ist entweder beschlagnahmt oder zerstört. Und die eigenen vier Wände zu beschützen und Menschenleben zu riskieren macht keinen Sinn. Uns ist bewusst, dass die russische Armee an den Grenzen zur Ukraine aufmarschiert. Falls es dort losgeht, wird uns niemand herauslassen, um unserer Armee zu helfen. Man hätte unsere Truppen ohnehin früher abziehen müssen. Selbst wenn es nicht 20.000, sondern nur 10.000 wären, so sind es immer noch ausgebildete Spezialkräfte.“
„Wie lauten derzeit Ihre Befehle? Was spielt sich hier gerade ab?“
„Es heißt, sie seien gerade in der ‚Entscheidungsfindung‘. So gut wie alle fühlen sich im Stich gelassen. In dieser Situation sind uns die Hände gebunden. Der Befehl, ‚den Umständen entsprechend zu handeln‘, ist eine bequeme Ausrede, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Ganz gleich, was wir tun, wir werden ohnehin als Verräter verurteilt. Der Oberst trägt die Verantwortung für das gesamte Eigentum, das bereits zerstört wurde. Aus dem Stab kann er nicht ausscheiden, außer er jagt sich eine Kugel in den Schädel. Verlässt er den Stab, wird er als Verräter behandelt. Sie wollen wissen, was in den kommenden Tagen geschehen wird? Wir reden hier von Stunden. Drei Regimenter, darunter unser eigenes, wurden noch nicht festgesetzt. Wir erwarten die baldige Stürmung. Unsere einzigen Informationen beziehen wir aus dem Fernsehen, und dabei nicht einmal dem ukrainischen. Unser Flugplatz, die Ausrüstung – alles wurde bereits zerstört. Wir sind umzingelt von bewaffneten Männern.“
Der Hoffnungslosigkeit zum Trotz wollen wir sofort in unserer Eigenschaft als Journalisten helfen. Ich frage also, welche Art von
Hilfe die Militärangehörigen und ihre Familien nach dem „Referendum“ benötigen: „Wir sehen alles nur von unserer begrenzten Warte aus. Niemand traut sich, über Flucht zu reden, das wäre feige. Aber wir sitzen einfach herum und warten, da es keine Befehle gibt. Die größte Angst haben wir davor, dass in der Ukraine ein Krieg ausbricht. In den vergangenen drei Wochen haben wir uns moralisch und physisch an die Situation gewöhnt. Es gibt jetzt nicht viel zu helfen, es sei denn, das Militär würde auf das Festland verlegt.“
„Unterkunft, Geld, wenigstens irgendwas?“
„Stellt euch vor, die Leute lassen alles stehen und liegen, ihre Möbel, alles Mögliche. Gebe Gott, dass wir wenigstens einige Koffer packen können. Wo sollen wir nur hin – aufs freie Feld? Hier hat zumindest fast jeder ein Zimmer im Wohnheim, eine eigene Wohnung, oder die der Eltern. Und dort – nichts.“
Larissa macht eine lange Pause. Dann fährt sie fort: „Ich kann nicht behaupten, dass das ukrainische Volk uns nicht helfen würde. Wir werden aus allen möglichen Gegenden des Landes angerufen und moralisch unterstützt. Tablets haben wir auch erhalten, Internet haben wir. Die einzige spürbare Unterstützung kommt vom ukrainischen Volk. Wenn wir ermutigende Worte hören, etwa im Fernsehen… dann rühren sie uns zu Tränen. So leben wir. 99 Prozent der Militärangehörigen halten zu diesem Volk. Ob das auf die Regierung zutrifft, lässt sich schwer sagen. Aber für dieses Volk werden wir weiter einstehen.“
Major Leonid Lisowyj, der Nachbar der Familie Mamtschur, bringt sich in die Unterhaltung ein: „Was hier vor sich geht? Die russischen Truppen drängen uns an die Wand. De facto befinden wir uns jetzt auf fremdem Territorium. Seit dem Referendum sind wir für sie nicht mehr als bewaffnete Banditen, die ausgemerzt werden müssen. Das muss denen in Kyjiw klargemacht werden, aber die Leitungen sind gekappt. Ich denke nicht, dass es jetzt noch Sinn macht, Waffengewalt anzuwenden. Das wäre Brudermord. Wir haben jedoch keine Verbindung zum Verteidigungsministerium. Wenn wir doch nur potente Machthaber hätten, die hierher auf die Krim, nach Simferopol, kämen, um sich hinzusetzen und zu einer Einigung zu kommen. Aber so werden wir Tag für Tag weiter zurückgedrängt.“
Major Lisowyj hat eine Entscheidung getroffen. Gebürtig stammt er aus Winnyzja. Seine Eltern leben dort, vor kurzem hat er seine Frau dorthin geschickt. Eine Unterkunft auf der Krim hat er nicht erhalten: „Auf dem Dienstweg hat mir niemand etwas angeboten. Sobald ich in Winnyzja angekommen bin, vereinbare ich ein Treffen mit dem diensthabenden Offizier und bitte ihn, mich für ein weiteres Jahr zu verpflichten. Ich würde gerne. Kommt er zu dem Schluss, dass ich gebraucht werde – dann werde ich dienen. Falls nicht, schreibe ich einen Bericht und lasse mich vom Dienst suspendieren. Und was dann? Ich weiß es nicht. Das ist Sache der Machthaber.“
So dächten Lisowyj zufolge viele der Militärangehörigen, die nicht von der Krim kämen. Die Ortsansässigen hingegen, mit Familie, Eltern, Frau, die blieben hier.
Als wir aufbrechen, registriert mein estnischer Kollege die bescheidenen Lebensverhältnisse der ukrainischen Offiziere. Überall auf den Fluren stehen große, karierte Taschen; Anzeichen für die Abreisevorbereitungen der Familien.18
Nicht nur ihre Wohnungen und Familien hindern die Ortsansässigen an der Abreise. Wiktor Wasylowytsch, der Offizier außer Dienst, der uns zu diesem Stützpunkt und diesem Wohnheim gebracht hat, sagt, dass er die Halbinsel nicht so ohne weiteres verlassen könne. Es ist noch nicht so lange her, dass sein Sohn bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Und die Person, die den Unfall zu verantworten habe, sei noch nicht verurteilt worden; der Prozess dauere noch an: „Ich verstehe einfach nicht, wie das möglich ist, und ich kann nicht zulassen, dass die Akte einfach geschlossen wird“, erklärt er leise.
In der Innenstadt treffen wir uns mit einem anderen Angehörigen der ukrainischen Marine. Seine ganze Familie stammt aus Sewastopol. Roman mimt für uns den Tourguide und führt uns durch die Stadt. Er zeigt uns das Moskauer Haus und das russische Offizierskasino, das schon sehr lange auf der Krim ansässig ist. Dabei wiederholt er gebetsmühlenartig, wie lange Russland hier schon seine Vorherrschaft ins Felsgestein meißelt: „Sewastopol, die Krim wie auch das Baltikum sind Rückzugsorte für viele Soldaten im Ruhestand. Sie haben in Russland gedient und genießen hier ihre Rente. Und nun fordern sie ein besseres Leben. Sie sind einfach auf die russischen Rentenzahlungen angewiesen. Mit der Krim oder der Ukraine fühlen sie sich in keinster Weise verbunden, deshalb unterstützen sie die Vereinigung mit Russland. Das trifft auch auf diejenigen zu, die für Unternehmen arbeiten, die mit der Wartung der Schwarzmeerflotte betraut sind. Dann gibt es noch die ‚Berufsrussen‘ aus den prorussischen Organisationen. Die jungen Menschen sind in den Jahren nach der Unabhängigkeit auf der Krim aufgewachsen, haben an ukrainischen Hochschulen studiert, sind nach Europa gereist und haben das Leben in der Sowjetunion nicht miterlebt; viele waren noch nie in Russland. Doch im Gegensatz zu den Rentnern sind sie nicht sonderlich aktiv. Denn die, die haben keine einzige Wahl verpasst.“
Die Straßen sind fast menschenleer. Auf unserem Weg zum Treffen können wir die Silhouetten der „höflichen Menschen“ erahnen – bewaffneten Soldaten, die um die Häuserblöcke patrouillieren. Einerseits ist die Versuchung groß, weitere Aufnahmen von russischen Sicherheitskräften zu machen. Andererseits ist Vorsicht geboten: die Aussicht, sich mit einem in Kyjiw ausgestellten ukrainischen Pass und dem Reisepass eines estnischen Staatsbürgers ausweisen zu müssen, ist nicht sehr verlockend. Für alle Fälle suchen wir uns einen ruhigeren Ort. Wir sind die einzigen drei Gäste in der anscheinend einzigen Bar, die um diese Zeit im Stadtzentrum noch geöffnet hat. Ein ukrainischer Sender läuft im Fernsehen. Ich will wissen, ob sie auch andere Sender empfangen. Das Mädchen hinter der Theke sagt, dass ihre Eltern zwar alle Sender empfangen, ihnen aber keinen Glauben schenken würden: „Da zeigen sie Massen von Menschen auf der Flucht, aber Sie sehen doch, dass das nicht der Fall ist.“
„Das größte Problem für die ukrainischen Seestreitkräfte und die ukrainischen Bürger auf der Krim ist die Untätigkeit der Machthaber in Kyjiw. Drei Wochen lang musste das Militär ohne schriftliche Befehle auskommen. Es gab lediglich Anrufe aus dem Verteidigungsministerium und dem Generalstab. Es hieß, wir sollen auf unseren Posten bleiben, doch was zu tun sei, konnten sie uns nicht sagen“, erklärt Roman.
Seiner Ansicht nach müsse man entweder alle Truppen abziehen oder aber sich auf Bedingungen einigen, unter denen sie hierbleiben können. Doch dazu bliebe keine Zeit: „In den kommenden Tagen werden die übrigen Stützpunkte erobert. Ohne Beistand vom Festland werden sie sich nicht halten können. Der Vorsitzende des Ministerrats der Krim hat angekündigt, dass das gesamte Eigentum auf dem Territorium der Halbinsel verstaatlicht wird – und damit auch alles, was der Marine gehört. Sie werden also alles mitnehmen, Waffen, Militärtechnik, Schiffe, die Magazinbestände, einfach alles. Aktuell liegen in der Strilezka-Bucht einige Schiffe und U-Boote, hinzu kommen einige bemannte ukrainische Schiffe am südlichen Marinestützpunkt in Donuslaw. Wenn es wie von Aksjonow angekündigt dazu kommt, dass sie ebenfalls festgesetzt werden, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Schiffe entweder preiszugeben, abzuziehen oder zu versenken. Die Leute handeln auf eigene Initiative, ohne klare Anweisungen aus Kyjiw. Das kann nicht lange gutgehen. In Nowooserne wurde bereits eine Garnison eingenommen. Mindestens die Hälfte aller Schiffe wurde seit der Unabhängigkeit in der Werft in Mykolajiw vom Stapel gelassen. Das alles setzt Kyjiw durch seine Unentschlossenheit aufs Spiel.“
Wir verabschieden uns und wollen aufbrechen. Den ganzen Abend lang redete Roman besonnen, führte Fakten an und legte Argumente dar. Doch plötzlich klingt seine Stimme verärgert, so als wäre das Wesentliche noch nicht zur Sprache gekommen: „Wie kann es sein, dass wir, eine Nation der Kosaken, uns kampflos ergeben haben? Das bekümmert mich zutiefst. Ich weiß nicht, was ihr in Kyjiw so denkt, aber hier fragen sich alle, wie ihr Leben unter Russland aussehen wird.“
„Werden Sie die russische Staatsbürgerschaft annehmen?“
„Wenn die Krim russisch wird, lässt sich das wohl nicht vermeiden. Was bleibt mir anderes übrig? Man hat uns im Stich gelassen. Von Rechts wegen hätten wir auf die Angreifer schießen müssen. Aber wir unterließen es – auch, weil die Soldaten sich nicht sicher sein konnten, ob Kyjiw hinter ihnen steht. Das russische Militär folgte den Angreifern auf dem Fuße – vielleicht hatte sich das russische Militär auch die Uniform der Volksmilizen übergezogen. Wir werden hier von einer Horde Banditen regiert werden wie in Tschetschenien und dabei zusehen, wie die Ukraine EU- und NATO-Mitglied wird.“
Roman setzt seinen Monolog fort: „Eine starke Armee, eine starke Wirtschaft – und die Krimbewohner werden selbst darum bitten, wieder ein Teil der Ukraine zu werden. Doch bis es so weit ist, werden noch viele Jahre vergehen. Vielleicht kommt es hier auch zu ethnischen Säuberungen gegen Ukrainer, und es werden mehr Menschen leiden müssen, als wenn anstelle des russischen Eindringens ein offener, bewaffneter Konflikt ausgebrochen wäre.“
Ich werde Roman ein halbes Jahr später in Odessa wiedertreffen. Seine Einheit wurde von der Krim dorthin verlegt. In Sewastopol unterhielt er sich noch in seiner Muttersprache Russisch. Nach einem halben Jahr in Odessa hat er sie vollständig abgelegt. Für ihn ist sie die Sprache der Verräter.
Auf den Dächern der Plattenbauten von Sewastopol wehen russische Flaggen. Kritiker der Annexion sind unversehens im Untergrund gelandet. In einer weiteren Plattenbausiedlung am Rande dieser Stadt, die mir gigantisch vorkommt, da wir von einem Viertel ins nächste jedes Mal mindestens eine Stunde unterwegs sind, treffen wir ebensolche Kritiker in Gestalt eines Ehepaars.
Die beiden sind Mitglieder einer evangelikalen Kirchengemeinde und haben schreckliche Angst vor dem, was noch kommen mag. Sie berichten über den Druck gegen und die Gefahren für Gläubige, die einer anderen Konfession angehören als der Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Kosaken und Berkut-Mitglieder haben einen Baptistenpriester am Checkpoint in der Nähe von Armjansk brutal zusammengeschlagen. Die Eheleute helfen gemeinsam mit anderen Gläubigen bei der Suche nach einem jungen Glaubensbruder, der offenbar am selben Checkpoint verschwunden ist. Informationen zu dem Jungen werden mündlich unter den Gemeindemitgliedern weitergegeben. Wir sind überfordert. Wie soll man das alles schaffen? Sollen wir alles stehen und liegenlassen, um nach einer einzigen Person zu suchen? Wir sind in Sewastopol und schaffen es nicht, vor Mitternacht von der Halbinsel wegzukommen. Ich notiere mir alle Telefonnummern und leite sie an die Redaktion weiter.
„Entschuldigen Sie bitte mein Krim-Kauderwelsch“19, sagt der Mann auf Russisch: „Das ist ein entsetzliches Gefühl. Ich hatte nie ein Problem mit meiner Sprache. Aber jetzt schon. Und ich möchte diesen Scharfmachern sagen: ‚Ja, es gibt ein Problem. Und ihr habt es uns eingebrockt. Danke!‘“ – das letzte Wort sagt er auf Ukrainisch.
Es gibt auf der Halbinsel immer noch Straßensperren, an denen die Papiere kontrolliert werden. Um aus der Stadt zu gelangen, haben wir beschlossen, uns mit dem Fahrer eines estnischen Geschäftsmannes zusammenzutun, bei dem wir für einige Tage in Balaklawa, einem Viertel in Sewastopol, untergekommen sind. Oleksandr war einer derjenigen, die an den Straßensperren die Ankunft des „Rechten Sektors“ erwartet haben. An dem teuren Wagen flattert ein Georgsbändchen. Ich höre fast die gesamte Strecke über nur zu und halte meinen Mund; ich bin einfach nur irgendein ukrainisches Mädchen, die Freundin des Landsmannes seines estnischen Bosses.
Mein estnischer Kollege hat im Übrigen einen konkreten Auftrag: in Simejis lebt der berühmte estnische Basketballprofi, ehemalige sowjetische Meister und seit Kurzem auch Schriftsteller Mihkel Tiks. Für seinen Ruhestand hat er sich auf der Krim niedergelassen. So wie die britischen Rentner nach Spanien auswandern, so fänden die Esten ihren Seelenfrieden eben auf der Krim, sagt er. Aus dem Fenster seines schlichten, lichtdurchfluteten Hauses hat man eine herrliche Aussicht über die Zypressen und auf das Meer.
Tiks lebt seit acht Jahren hier. Selbst in diesen stürmischen Tagen sei es an der Südküste für gewöhnlich ruhig. Es gibt keine Stützpunkte, daher sei hier nicht viel los. Dabei seien die Nachrichten beängstigend: „Hier verschwindet ein ukrainischer Soldat, da ein französischer General, dort finden sie einen toten Krimtataren. Diejenigen, die gegen die Besatzung sind, sollten besser den Mund halten, um sich nicht in Gefahr zu bringen. Es wäre besser, wenn sie die Krim verlassen.“
Tiks überlegt, wie die Krim wieder ukrainisch werden könne. Wenn das Land zu neuen Kräften komme, würden die Bewohner der Krim in fünf Jahren von alleine zurückwollen: „Im Laufe der Jahre habe ich begriffen, dass die Bewohner der Krim niemals aus eigener Anschauung erfahren haben, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedeuten. Man kann ihnen nur schwer etwas erklären, was sie noch nie selbst erlebt haben. Ich kann sogar nachvollziehen, dass die Leute die gesamte Ära Janukowytsch über alle Maßen satt haben, die Macht der Oligarchen, die allgegenwärtige Korruption, aber aus irgendeinem Grund haben die Leute beschlossen, dass Russland das alles im Griff hat“, sagt er, überrascht von seinen eigenen Worten. Es scheint, als habe er lange auf die Gelegenheit zu einem Gespräch mit einem Landsmann gewartet. Dieser Tage hat er nur wenig Kontakt zu seinen Nachbarn.
Wir befinden uns ganz in der Nähe von Jalta, weshalb wir uns zu einem kurzen Abstecher in die Stadt entschließen. Auf der Strandpromenade unterhalten wir uns mit einer Reihe von Souvenirverkäufern und Spaziergängern. In stürmischen Zeiten finden die Meinungen solcher Menschen kaum Beachtung. Auf den ersten Blick wirken sie wie gleichgültige Spießbürger. Tatsächlich aber bilden eben diese Menschen die Mehrheit. Die meisten unserer Gesprächspartner sagen, sie seien „weder dafür noch dagegen, da sich nichts wirklich geändert hat und auch nicht ändern soll.“ Unterwegs halten wir für einige Minuten am sogenannten Schwalbennest, einem Schloss, das unter Touristen sehr beliebt ist. Wir machen ein paar Fotos – und das vielleicht einzige Selfie der gesamten Reise; ein Andenken, nur für uns selbst. Touristische Aufnahmen kommen uns in diesem Augenblick besonders wertvoll vor (und tatsächlich werden in den kommenden Jahren in den ukrainischen Medien nur wenige unbelastete Eindrücke von der Krim zu sehen sein). Zurück in Balaklawa kehren wir zum ersten Mal während dieser Reise für ein Abendessen in ein Restaurant ein. Der eingeschaltete Fernseher sendet aus dem Georgs-Saal im Kreml. Die Separatistenführer, der „Volksbürgermeister“ von Sewastopol Oleksij Tschalyj, der sogenannte Regierungschef der Krim Sergej Aksjonow und der Parlamentssprecher Wolodymyr Kostjantynow unterzeichnen gemeinsam mit Putin einen „Vertrag über die Aufnahme der Krim und Sewastopols als neue Föderationssubjekte der Russischen Föderation“. Dann unterzeichnet Putin ein Dekret über den Anschluss der Krim. Ich versuche, die Emotionen der Restaurantbesucher von ihren Gesichtern abzulesen. Freuen sie sich? Sind sie empört? Das alles gemahnt an eine Szene wie aus einer Dystopie, in welcher die Menschen aus dem Untergrund unversehens in eine Bar geraten sind und nun Angst haben, das einer der anwesenden Gäste sie bloßstellt, indem er mit dem Finger auf sie zeigt und ruft: „Seht her, da sitzen die Aufständischen!“ Ich möchte von hier verschwinden. An der Mauer des Nachbargebäudes prangt ein Schriftzug: „Wer in Angst lebt, wird an der Angst zugrunde gehen.“
Wir planen unsere Rückreise nach Kyjiw. Am nächsten Tag soll ich die Eröffnungsfeier der Dokudays, eines Dokumentarfilm-Festivals über Menschenrechte, moderieren. Auf der Krim wurden zwei bekannte Regisseure des Filmkollektivs Babylon'13 – der Kameramann Jurij Gruzynskyj und Jaroslaw Pilunskyj – festgenommen. Der Vater des Letztgenannten ist ein auf der Krim bekannter Politiker, der sich offen gegen die russische Annexion ausgesprochen hat. Sie wurden am Checkpoint Tschonhar festgenommen und sechs Tage gefangen gehalten.
Aus irgendeinem Grund scheint es mir, als könnte ich nach meiner Rückkehr von der Krim berichten, was dort wirklich vor sich geht. Ich erhalte noch einige Kontakte von Aktivisten des Euromaidan auf der Krim. Unter diesen Umständen haben solche Gesprächspartner einen hohen Seltenheitswert.
Es handelt sich um zwei Schwestern. Die jüngere ist um die 65, die ältere 75 Jahre alt. Sie nennen ein gemütliches Haus am Stadtrand von Simferopol ihr Eigen. Obwohl sie wissen, dass wir es eilig haben, versuchen sie uns, wenn schon nicht zum Essen, so doch wenigstens auf einen Kaffee einzuladen.
„Natalija, jeden Tag sind wir zu den Kundgebungen gegangen, aber wir waren zu wenige“, so die Jüngere.
„Nein, dass wir zu wenige waren ist nicht der Grund für das alles; das wurde schon lange vorher entschieden“, widerspricht die Ältere.
„Hier auf der Krim hat man den Maidan nicht verstanden. Erst hinterher begann man sich dafür zu interessieren. Es gab aber auch Leute mit prorussischen Ansichten, die begriffen haben, dass der Maidan nicht gekauft war, dass die Menschen schlicht und ergreifend für ihre Rechte, ihre Ehre, ihre Würde und für die Freiheit auf die Straße gegangen sind. Erst
durch die Falschmeldungen, wonach Scharfschützen aufseiten der Opposition auf dem Maidan das Feuer eröffnet hätten, ist hier die Stimmung gekippt. Hier ist ‚Inter‘20 der beliebteste Fernsehsender. Der hat erst nach den Schüssen am 20. Februar eine etwas objektivere Berichterstattung angestimmt. Dabei hat die intellektuelle Elite in Kyjiw, ja in der gesamten Ukraine, keinen mentalen Bezug zur Krim. In Jalta etwa gibt es ein kleines Museum über die Schriftstellerin Lesja Ukrajinka, die einige Jahre auf der Krim verbracht hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob Oksana Sabuschko oder Jurij Andruchowytsch jemals dort gewesen sind. Und war es nicht Andruchowytsch, der gesagt hat: ‚Lasst uns die Krim doch abgeben!‘ Und was sagt der Autor der Schwarzen Sonne, Wasyl Schkljar? ‚Wie konnte man nur das Kiwalow-Kolesnitschenko-Gesetz aufheben!‘21 Es stimmt schon, dass das Gesetz falsch ist, doch es braucht eine einfühlsamere, flexiblere Politik. Die Liebe zu Kultur und Sprache will in den Menschen geweckt werden – und nicht mit dem Schwert aufgezwungen.“
„Das reicht jetzt!“, unterbricht sie die ältere Schwester. Sie hat Angst, dass die Jüngere sich um Kopf und Kragen redet.
„Herrgott noch eins! Das wissen doch alle!“
„Walya, willst du Nummer 15 auf der Vermisstenliste werden?“
Eine heißdiskutierte Frage ist das Verhalten Kyjiws nach der sogenannten Abstimmung. Die Jüngere befindet: „Ich für meinen Teil liebe die Ukraine so sehr, dass ich bereit wäre, Opfer zu bringen. Einen Ofen bauen, mit Brennholz heizen. Aber ich finde nicht, dass die Ukraine die Stromversorgung unterbrechen sollte. Es zahlt sich aus, die Menschen zu unterstützen, die 23 Jahre lang ihre Staatsbürger gewesen sind. Es gibt hier ja auch welche, die die ukrainische Sprache unterstützen, und das sind nicht nur ethnische Ukrainer, sondern auch russischsprachige und sogar ethnische Russen. Es ist alles so kompliziert, ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich mit dieser nicht legitimierten Regierung an den Verhandlungstisch setzen könnte. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.“
„Und worauf hofft ihr?“
„Wir setzen auf uns selbst. Und darauf, dass Aksjonow und Konsorten uns nicht hinter Gittern bringen, weil wir andere Ansichten haben…“
„Wir suchen uns Trost. Wir spazieren in unseren wunderschönen Garten. Kommt in einem Monat nochmal vorbei, dann seht ihr, wie hier alles blüht…“ – für einen Moment wechselt die Frau das Thema, dann fährt sie fort: „Aber wir wissen nicht, welche Rechte wir dann noch haben werden. Wie können wir die Bindung zur Ukraine aufrechterhalten? Sie rufen zur Evakuierung der Zivilbevölkerung auf. Aber weshalb sollten wir unsere Häuser verlassen? Erstens haben wir Angst vor Plünderungen. Zweitens ist uns nicht begreiflich, warum wir die Orte, an denen wir ein halbes Jahrhundert lang gelebt haben, überhaupt verlassen sollen.“
Die ältere Schwester ergänzt: „Ich habe 1963 mit dem Bau dieses Hauses begonnen und lebe seit einem halben Jahrhundert hier. Ich habe das alles mit meinen eigenen Händen geschaffen, gespachtelt, gestrichen – alles in der Hoffnung auf einen ruhigen Lebensabend.“
In den kommenden zweieinhalb Monaten werden die Schwestern zweimal nach Kyjiw reisen – davon einmal, um sich für die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen zu registrieren. Die Fahrt nach Kyjiw ist kraftraubend und kostet Zeit und Geld. Für die betagten Frauen von der Krim ist sie eine Bürgerpflicht und wenigstens eine Sache, das sie tun können. Sie freuen sich, in Kyjiw zu sein. Die festliche Stimmung in den Wahllokalen und die blau-gelben Flaggen, die auf der Krim zum Symbol des Widerstands geworden sind. Wir unterhalten uns vor dem Eingang zu einem Wahllokal im Zentrum der Stadt, rund einhundert Meter vom Maidan entfernt. Eine der Wahlbeobachterinnen, eine Maidan-Aktivistin, will wissen, woher die Frauen stammen: „Ihr seid von der Krim? Warum habt ihr sie nicht verteidigt?“, fragt sie in vorwurfsvollem Ton: „Hier in Kyjiw haben Frauen in Pelzmänteln Pflastersteine herausgebrochen und Molotow-Cocktails vorbereitet.“
„Was konnten wir schon groß tun? Auch wir sind auf die Straße gegangen. Nur standen uns bewaffnete Leute gegenüber“, rechtfertigt sich die jüngere Schwester. Die ältere schweigt.
Für gewöhnlich mische ich mich nicht in Gespräche ein, sondern beschränke mich auf die Rolle der Beobachterin. Doch jetzt kann ich mich nicht zurückhalten und nehme die Wahlbeobachterin zur Seite: „Ist Ihnen überhaupt bewusst, was Sie da sagen? Diese beiden Damen haben am Euromaidan auf der Krim teilgenommen. Sie sind eigens nach Kyjiw gekommen, nur um ihre Stimme abzugeben. Sie haben schon genug Sorgen. Können Sie sich vorstellen, mit welchen Gedanken sie jetzt auf die Krim zurückkehren werden?“ Daraufhin geht die Frau zu den Schwestern zurück und entschuldigt sich.
Der Zug Simferopol – Kyjiw passiert Dschankoj, den letzten Halt auf der Halbinsel. Das bedeutet, dass es keine Kontrollen mehr durch Kosaken oder Krimnasch (Die Krim ist unser)-Aktivisten geben wird. Für einige Minuten schweigen die Passagiere einfach. Sie hängen ihren Gedanken nach oder schauen auf die Bildschirme ihrer Smartphones. Dann blicken sie auf und beginnen zu reden. Schnell wird klar, dass niemand in unserem Abteil die Annexion unterstützt.
„Diese Verräter! Sie haben uns einfach fallengelassen, um einem anderen Staat zu dienen“, empört sich eine junge Frau, die, wie sich herausstellt, für die Staatsanwaltschaft in Simferopol tätig war: „Man sollte sie alle vor Gericht bringen. Sie sind Journalistin? Wissen Sie vielleicht, ob man uns dort Arbeit verschafft? Ich habe einfach meine Sachen gepackt und mich auf den Weg nach Kyjiw gemacht. Ich werde bei der Generalstaatsanwaltschaft anrufen und fragen, wo ich jetzt arbeiten soll. Ich hoffe, es findet sich eine Möglichkeit. Wo soll ich sonst hin? Ich komme zwar von der Krim, aber mit Verrätern und Eidbrechern zusammenarbeiten – niemals!“
1 Begriff aus den russischen Staatsmedien zur ideologischen Überformung der Ereignisse von 2014 auf der Krim und im Donbas (Anm. d. Übers.).
2 Euphemistische Bezeichnung für die russischen Spezialeinheiten mit Uniformen, aber ohne Hoheitsabzeichen, die für die Besetzung der Krim eingesetzt wurden. Bisweilen auch zynisch als „höfliche Menschen“ gelesen, da die Spezialeinheiten auf direkte Gewaltanwendung bei der Besetzung und auf jegliche Kommunikation verzichtet haben (Anm. d. Übers.).
3 Während des Zweiten Weltkriegs Verdienstorden für sowjetische Soldaten; seit 2014 Symbol der Unterstützung der Aktivitäten der russischen Regierung auf der Krim und im Donbas (Anm. d. Übers.).
4 Taras Schewtschenko ist ein Klassiker der ukrainischen Literatur des 19. Jahrhunderts (Anm. d. Autorin).
5 Bezeichnung der russischen Regierung für eine diffuse geopolitische und kulturelle Einflusssphäre, die den Großteil der Nachfolgestaaten der Sowjetunion umfasst (Anm. d. Übers.).
6 Exekutiv-repräsentatives Organ des Krimtatarischen Volkes; seit 2016 durch die Besatzungsbehörden auf der Krim verboten (Anm. d. Übers.).
7 Von 1995 bis 1998 stellvertretender Vorsitzender des Obersten Sowjets der Autonomen Republik Krim. Seit November 2013 Vorsitzender des Medschlis des Krimtatarischen Volkes (Anm. d. Autorin).
8 Im März 2014 entsprachen 1.000 Hrywnja dem Wert von 120 US-Dollar (Anm. d. Autorin).
9 Name aus Sicherheitsgründen geändert. Im Folgenden habe ich die Namen meiner Gesprächspartner geändert oder auf eine Angabe verzichtet. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die nach wie vor auf der besetzten Krim leben, und in Fällen, in denen diese Personen identifiziert und ihre Aussagen sie in Gefahr bringen könnten. Personen des öffentlichen Lebens sowie diejenigen, die auf eigenen Wunsch ihre Geschichte erzählen möchten (beispielsweise die Verwandten von politischen Gefangenen), werden hingegen namentlich im Buch genannt (Anm. d. Autorin).
10 Mittlerweile aufgelöste, auf Janukowytsch eingeschworene paramilitärische Spezialeinheit der ukrainischen Sicherheitskräfte; maßgeblich verantwortlich für die Mehrzahl der zivilen Todesopfer auf dem Maidan (Anm. d. Übers.).
11 Populäre Bezeichnung in der Ukraine für die mehr als 100 Todesopfer der Proteste auf dem Maidan (Anm. d. Übers.).
12 Ich bemerke, dass auf der Krim wie auch in russischen Fernsehsendern das Wort „Banderiwtsi“ wie „Benderiwtsi“ ausgesprochen wird. Es geht hier schon lange nicht mehr um Bandera – der Wortschatz der Propaganda ist ein Thema für sich (Anm. d. Autorin). „Banderiwtsi“ ist eine abwertende Bezeichnung für Ukrainer im Allgemeinen oder Menschen aus der Westukraine im Speziellen und spielt auf den ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera (1909-1959) an (Anm. d. Übers.).
13 Sergej Aksjonow, ehemaliger Abgeordneter des Parlaments der Autonomen Republik Krim und Vorsitzender der prorussischen Partei „Russische Einheit“, gilt als einer der Drahtzieher hinter dem völkerrechtswidrigen Referendum über die Abspaltung der Krim von der Ukraine (Anm. d. Übers.).
14 Oleksandr Turtschynow. Nach der Flucht von Wiktor Janukowytsch vom 23. Februar bis zu zur Amtseinsetzung von Petro Poroschenko am 7. Juni 2014 Übergangspräsident der Ukraine (Anm. d. Autorin).
15 Dmitrij Jarosch. 2014 der Anführer der nationalistischen Bewegung „Rechter Sektor“ (Anm. d. Autorin).
16 „Moskaly“ im ukr. Original. Abwertende Bezeichnung für Menschen aus Russland (Anm. d. Übers.).
17 Seit 2015 Eurasische Wirtschaftsunion. Mitgliedstaaten: Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Weißrussland (Anm. d. Übers.).
18 Am 22. März 2014 verteidigte die 204. Brigade der taktischen Luftwaffe unter dem Kommando von Juli Mamtschur in Eigenregie den Stützpunkt A-4515, der schlussendlich durch russische Besatzungstruppen und unbekannte bewaffnete Einheiten eingenommen wurde. Nach der Stürmung wurde Mamtschur von russischen Militärangehörigen verschleppt. Anschließend wird Mamtschur berichten, dass er drei Tage in Isolationshaft festhalten wurde. Russische Soldaten hätten versucht, ihn zum Übertritt in die russische Armee zu bewegen. Am 26. März 2014 verließ Mamtschur gemeinsam mit fünf weiteren gefangenen Offizieren unter der Eskorte russischer Sturmgewehre die Krim. Seine Einheit wurde nach Mykolajiw verlegt. Von 2014 bis 2019 war Mamtschur für die Partei „Block Petro Poroschenko“ Abgeordneter in der Werchowna Rada (Anm. d. Autorin).
19 „Surshyk“ im ukr. Original. Als Surshyk wird eine informelle Mischsprache aus Ukrainisch und Russisch bezeichnet (Anm. d. Übers.).
20 Im Besitz des zum prorussischen Meinungsspektrum zählenden Oligarchen Dmytro Firtasch. Während des Maidan überwiegend regierungs- und kremlfreundliche Berichterstattung (Anm. d. Autorin).
21 Populäre Bezeichnung für das Gesetz „Über die Grundlagen der staatlichen Sprachenpolitik“, die auf die Namen zweier prorussischer Abgeordneter zurückgeht. De jure garantiert das 2012 angenommene Gesetz die Nutzung „regionaler Sprachen“ in der Ukraine. De facto hat das Gesetz Russisch in einigen Regionen zur zweiten Amtssprache gemacht und nach Ansicht von Kritikern die staatliche Unterstützung für die ukrainische Sprache eingeschränkt. Unmittelbar nach dem Maidan stimmte die Werchowna Rada für die Aufhebung des Gesetzes – ein Vorgang, den sich die russische Propaganda zunutze machte (Anm. d. Autorin).