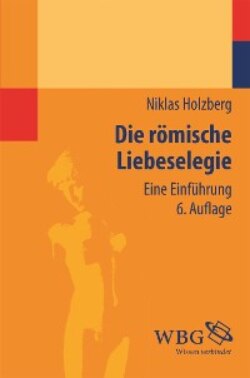Читать книгу Die römische Liebeselegie - Niklas Holzberg - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Literarische Entstehungsvoraussetzungen
ОглавлениеFür die Amores-Dichtung des Gallus, Properz, Tibull und Ovid wird allgemein der Begriff „römische Liebeselegie“ verwendet. Dadurch kann der Eindruck entstehen, es handle sich hier um eine eigene Gattung. Doch wir haben es nur mit der Sonderform einer solchen, also einem Gattungstyp, zu tun. Das elegische Gedicht ist als literarisches Genre bereits seit der Mitte des 7. Jahrhunderts nachweisbar und thematisch keineswegs auf Erotik beschränkt. Inhaltlich bildeten die ersten Elegien eine Art Gegenstück zum Epos, da das poetische Ich, das in der erzählenden Gattung als Person hinter seinem Stoff zurücktreten mußte, hier Gelegenheit bekam, seinen Gedanken zu den verschiedensten Lebensfragen direkt Ausdruck zu verleihen. Unter solchen Bekundungen persönlicher Anliegen herrscht in den ältesten uns überlieferten Elegien die Ermahnung und Belehrung vor. Kallinos von Ephesos und der Spartaner Tyrtaios (beide um 650 v. Chr.) fordern in elegischen Gedichten, die bei Symposien gesungen und von dem aulós, einer Art Flöte, begleitet wurden (für die römische Elegie gilt das nicht mehr), ihre Landsleute zu tapferem Kampf gegen die Feinde auf. Das für die Anfänge der Gattung besonders charakteristische paränetische Sprechen ist dann auch noch ein Merkmal der Amores-Dichtung. Dort haben mahnendes Zureden mit dem Zweck des Werbens um die Gunst der bzw. des Geliebten und erotodidaktische Unterweisung des Lesers, der Freunde des poeta/amator und der puella bzw. des Knaben ihren festen Platz.
Der Gattungsname freilich weckte bei den Römern nicht primär Vorstellungen von einem Gedicht, das Paränese und erzieherisches Einwirken auf den Rezipienten artikuliert. Etwa seit dem Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. gebrauchte man das Wort Elegie (griech. zunächst élegos, dann elegeia) im Sinne von „Klagegesang“. Dies ist jedoch nichts weiter als eine volksetymologische Ableitung von e e légein (griech. „’Wehe, wehe!’ rufen“), zu der es wahrscheinlich deswegen kam, weil das Versmaß der Elegie, das aus einem daktylischen Hexameter und einem daktylischen Pentameter bestehende elegische Distichon (griech. elegeîon), in Griechenlands klassischer Zeit für Grabepigramme verwendet zu werden pflegte. Wie in der Antike allgemein üblich, wurde eine Gattung nicht nach inhaltlichen, sondern nach formalen Kriterien, also im Hinblick auf das Metrum, definiert. Thematisch bot die frühe griechische Elegie zur Bezeichnung als Klagegesang keinen Anlaß, da sie als solcher, soweit wir wissen, nicht fungierte; der Gattungsname ist möglicherweise mit dem armenischen Wort elegn verwandt, das „Flöte, Schilf“ bedeutet. Doch in der römischen Liebeselegie spielt Klage eine beherrschende Rolle, da die Gedichte oft von leidvollen Erfahrungen des Ich-Sprechers mit der Person, die er liebt, ihren Ausgang nehmen. Dazu paßt es, daß in Ovids Gedicht Am. 3.9 der poeta/amator aus Anlaß des Todes Tibulls die personifizierte Elegie dazu auffordert, flebilis („klagend“) ihr Haar zu lösen (V.3).
Inwieweit die Amores-Dichtung in ihrem Umgang mit der erotischen Thematik an die Tradition der griechischen Elegie der archaischen, klassischen und hellenistischen Epoche anknüpfte, läßt sich nicht mehr eindeutig feststellen, da uns viele Texte wichtiger Vorläufer der römischen Elegiker nur in wenigen Fragmenten oder gar nicht überliefert sind. So wissen wir z.B. nicht, ob die in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. von Mimnermos von Kolophon verfaßten Elegien, die von den Alexandrinern in einer Sammlung mit dem Titel Nanno, dem Namen einer Flötenspielerin, vereint wurden, von den Liebeserfahrungen des Ich-Sprechers mit dieser Frau erzählten. In den erhaltenen Bruchstücken ist Erotik lediglich Teil allgemeiner Reflexionen über Jugend und Vergänglichkeit, verbunden mit der Aufforderung – wieder stoßen wir auf paränetisches Sprechen –, die Liebe zu genießen, solange es sich altersmäßig schickt. Der Amores-Dichtung näher verwandt sind die erotischen Gedichte in der unter dem Namen des Theognis überlieferten Elegiensammlung, die in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. oder vielleicht schon hundert Jahre früher entstand. Aber diese Elegien, in denen es um Knabenliebe geht, haben nur den Umfang von Epigrammen. Interessanter für die Entwicklung der erotischen Elegie ist Antimachos von Kolophon mit seiner Ende des 5./Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr. entstandenen Gedichtsammlung Lyde. Dabei handelte es sich vermutlich um eine Aneinanderreihung von Mythen überwiegend erotischen Inhalts und mit tragischem Ausgang. Antimachos, der das Werk Lyde, seiner verstorbenen Frau, widmete, gab damit offenbar hellenistischen Elegikern wie Hermesianax von Kolophon (um 300 v. Chr.) und Philetas von Kos (um 320–270 v. Chr.) die Anregung, Geschichten von unglücklich Verliebten des Mythos im Rahmen umfangreicher Katalogelegien zusammenzustellen. Die erotischen Erlebnisse mythischer Gestalten erscheinen bei den römischen Elegikern, vor allem bei Properz und Ovid (deren Vorläufer auch hier Gallus gewesen sein dürfte), häufig als exemplarische Entsprechungen oder als (bisweilen ironisch gefärbte) Gegenbilder zu den erotischen Erfahrungen des Ich-Sprechers, der die Bezugnahme meist durch einen kurzen Verweis oder eine Anspielung, ganz selten aber auch durch ausführliches Erzählen der von ihm angeführten Sage kenntlich macht.
Die bekannteste hellenistische Katalogelegie, die nur in Bruchstücken erhaltenen Aitia („Erklärungssagen“) des Kallimachos (ca. 310–249 v. Chr.), übte auf die römischen Elegiker u.a. deshalb einen besonders großen Einfluß aus, weil durch sie die bei Antimachos erreichte Form dieses Gattungstyps erheblich verfeinert, ja eigentlich überwunden wurde. Der Verfasser der Lyde trat als Erzählerfigur offenbar nur am Anfang und am Ende seines Katalogs von Mythen in Erscheinung und präsentierte diese in der unpersönlichen Darstellungsweise des Epos sowie in der Sprache dieser Gattung. Die persona des Kallimachos dagegen war in den Aitia – das lassen die Fragmente noch erkennen – wie das Ich in einem römischen Elegienbuch ständig gegenwärtig und verwendete eine Diktion, die zum Vorbild für die gesamte klassische und nachklassische römische Dichtung werden sollte. Reich an Stilnuancen, literarischen Anspielungen und Pointen, ersetzte diese Sprache archaisches Pathos durch Witz und Ironie. Im Prolog zu den Aitia, in dem der Erzähler sich zu seinen Stilprinzipien äußert, sagt er einmal, er werde kritisiert, weil er „nicht einen einzigen, fortlaufenden Gesang vollendet habe entweder zur Verehrung von Königen oder auf Helden der früheren Zeit“, sondern sein Wort nur „über eine kleine Strecke rolle wie ein Kind“ (Frg. 1.3–6 Pf.). Alan Cameron hat gute Gründe dafür vorgebracht, daß Kallimachos sich hier von der episierenden Erzählweise des Antimachos, nicht vom Epos selbst absetze (1995, 303ff.). Aber die römischen Dichter, die wie Kallimachos die kunstvoll ausgearbeitete Kleinpoesie als die für sie ideale Form von Dichtung wählten, verbanden dies dann doch mit der Erklärung, sie zögen das kurze Gedicht dem Epos vor. Nachdem erstmals Vergil eine solche Erklärung, die die Literaturwissenschaft recusatio („Weigerung“) nennt, abgegeben hatte, und zwar an exponierter Stelle in seinem Eklogenbuch (6.3–5), wurde sie auch zu einem wichtigen Element in der Poetik der Elegiker. Bei Properz und Ovid ergreift der poetalamator sogar mehrfach – meist wie bei Kallimachos im Prolog zu einem Buch – die Gelegenheit, die Entscheidung für den Verzicht auf die Abfassung eines Epos zu begründen.
Die Aitia des Kallimachos wirkten aber nicht nur stilistisch und darstellungstechnisch auf die römische Liebeselegie, sondern auch strukturell und motivisch. Den von ihm abgelehnten „fortlaufenden Gesang“ des Antimachos, den er vermutlich als eintönig empfand, ersetzte der Dichter der Aitia offenkundig durch einen bunten Kranz von Mythen, in dem die einzelnen elegischen Erzählungen einerseits selbständige narrative Einheiten bildeten, andererseits nach einem sorgfältig durchdachten Bauplan aneinandergereiht und intratextuell durch zahlreiche offene und versteckte Bezüge miteinander verknüpft waren. Wir werden dieses Strukturprinzip bei der Analyse der römischen Elegiensammlungen, die wie die Aitia linear gelesen sein wollen, wiederfinden. Da das Werk des Kallimachos, in dem religiöser Kult, Brauchtum und Namen mythologisch erklärt wurden, auch mehrere erotische Geschichten enthielt, ergab sich für den Dichter die Gelegenheit, handelnde Personen von ihren Liebeserfahrungen und ihren erotischen Gefühlen erzählen und darüber reflektieren zu lassen. Beim Vergleich der einschlägigen Textabschnitte, die in den Fragmenten erhalten sind, mit den Gedichten der römischen Elegiker zeigen sich mehrere thematische Berührungen. So hat z.B. das griechische Vorbild für Catulls bereits erwähntes Gedicht, in dem die Locke der Berenike spricht (c. 66) – es ist bei Kallimachos ein Abschnitt am Ende von Buch 4 der Aitia (Frg. 110 Pf.) –, ein für die Amoras-Dichtung besonders wichtiges Motiv aufzuweisen: die Situation der Trennung des elegischen Ich von der Person, die es liebt. Bei Properz, Tibull und Ovid kann der poeta/amator von der puella z.B. dadurch getrennt sein, daß sie ihm ein Rendezvous bei sich zu Hause verwehrt und er deshalb, auf der Schwelle vor ihrer Tür liegend, als exclusus amator seine Klage in Form eines Paraklausithyron (griech. für „Klage an der Tür“) ertönen läßt. Dem entspricht es, wenn die Locke, die Berenike zum Dank für die Wiederkehr ihres Gatten von einem Feldzug den Göttern geweiht hat und die als Sternbild an den Himmel versetzt wurde, ihre Sehnsucht nach der Herrin in einer mit erotischen Ausdrücken und Motiven durchsetzten Elegie artikuliert.
In der Situation des exclusus amator befinden sich auch mehrfach die Ich-Sprecher der erotischen Epigramme, die uns in Buch 5 und 12 der Anthologia Palatina überliefert sind. Schon die Gedichte aus hellenistischer Zeit – die wichtigsten Verfasser sind Asklepiades von Samos (geb. ca. 320 v. Chr.) und wiederum Kallimachos, ferner Poseidipp von Pella (um 275 v. Chr.) sowie die beiden aus Gadara stammenden Dichter Meleager (ca. 130–60 v. Chr.) und Philodem (ca. 110–46 v. Chr.) – enthalten die meisten Motive antiker erotischer Poesie, die wir auch aus den römischen Elegien kennen. Sie gehen teilweise auf die Neue Komödie des 4./3. Jahrhunderts v. Chr. zurück. Dort finden wir z.B. die Liaison eines jungen Mannes aus gutem Hause mit einer Hetäre, und dem Typus dieser Frau entsprechen dann sowohl die weiblichen Figuren, denen die Ich-Sprecher der Epigramme ihre Liebe schenken, als auch die puellae bei den römischen Elegikern. Überdies spielen Frauen wie die Heliodora Meleagers und die Xanthippe Philodems in den Epigrammen, in denen sie auftreten, eine ganz ähnliche Rolle wie die Cynthia des Properz oder Ovids Corinna. Wir können also eine Art „Stammbaum“ der Figur der elegischen puella erstellen, der mindestens bis zu den Hetären bei Menander zurückreicht, und gewinnen dadurch ein wichtiges Argument für die bereits kurz angesprochene These, daß Frauengestalten wie Cynthia poetische Konstrukte sind.
Das erotische Epigramm, in der spätklassischen Epoche der griechischen Literatur entstanden und wie die Elegie zunächst vermutlich beim Symposion vorgetragen, wurde im Hellenismus zusammen mit den Epigrammen über andere Themen zur Buchpoesie. Dadurch sowie aufgrund der Tatsache, daß das elegische Distichon als Versmaß die anderen für Epigramme verwendeten Metren fast ganz verdrängte, wurde die Gattung zur kleinen Schwester der Elegie. Aus der in byzantinischer Zeit zusammengestellten Anthologia Palatina wissen wir, daß es die in Buchform publizierte Sammlung ausgewählter Epigramme verschiedener Dichter, wie sie hier vorliegt, schon in der hellenistischen Epoche gab. Denn das Gedicht AP 4.1, eine Elegie von 58 Versen, ist die Vorrede Meleagers zu dem Kranz, einer nicht lange nach 100 v. Chr. von ihm redigierten Anthologie von Epigrammen, die er und andere Dichter verfaßt hatten. Untersuchungen Kathryn Gutzwillers (1998) haben wahrscheinlich machen können, daß Meleager auf Epigrammsammlungen zurückgreifen konnte, die von den Autoren selbst herausgegeben wurden, und daß diese nach Prinzipien strukturiert waren, die denjenigen augusteischer Gedichtbücher vergleichbar waren. Es spricht also viel dafür, daß die römischen Elegiker sich Anregungen für die Anordnung ihrer Gedichte nicht nur von den Aitia des Kallimachos, sondern auch von den hellenistischen Epigrammbüchern holten.
Bei dem Vergleich der römischen Liebeselegie mit archaischen, klassischen und hellenistischen Dichtungen in elegischen Distichen stehen wir, was unsere Kenntnis der griechischen Texte betrifft, mit den frühen erotischen Elegien, den erotischen Mythen in Katalogelegien und den erotischen Epigrammen wenigstens auf einigermaßen sicherem Boden. Fast gar nichts dagegen wissen wir über elegische Liebesgedichte griechischer Autoren, die im Umfang in etwa mit den römischen Elegien übereinstimmten und in denen wie in den erotischen Epigrammen ein poeta/amator von seinen Erfahrungen in der Beziehung zu einer Frau oder zu einem Knaben erzählte. Hatte man zeitweise geglaubt, daß sie gar nicht existiert hätten, so ergibt sich jetzt aufgrund von Papyrusfunden immerhin die Möglichkeit, daß Gallus, Properz, Tibull und Ovid auch diese Art von Gedicht in der griechischen Literatur vorfanden. Zwar stammen die Reste von vier Elegien, die wir in P. Oxy. 2884, 2885 und 3723 lesen, aus Buchrollen des 2. Jahrhunderts n. Chr., aber es gibt gute Gründe für die Datierung der Texte in hellenistische Zeit. Freilich läßt der lückenhafte Zustand der Gedichte nur eines erkennen: Äußerungen des elegischen Ich über seine eigenen amores bilden offenbar nur einen ganz schmalen Rahmen für breites Entfalten der jeweils einschlägigen mythischen Analogie. Bei den römischen Elegikern dagegen ist das Verhältnis zwischen den beiden Formen elegischen Sprechens in der Regel genau umgekehrt.
Vielleicht bildet eine frühe römische Elegie, das berühmte Carmen 68 des C. Valerius Catullus (ca. 84–55 v. Chr.), eine Übergangsstufe von den hellenistischen Elegien, in denen das Analogisieren großen Raum einnimmt, zu der augusteischen Amores-Dichtung. Gewiß, wie der poeta/amator hier seine Liebe zu einer Frau mit der Trauer um den Tod seines Bruders, mit seiner Freundschaft zu dem Gedichtadressaten Allius und mit dem heroischen Mythos zu einer gedanklichen Einheit verschmilzt, zeigt deutlich Verwandtschaft mit Elegien des Properz, die ein ähnlich dichtes Motivgewebe aufweisen. Aber mit Recht bemerkt Denis Feeney zu dem Catull-Gedicht: „What actually happens in 68? A man provides a house, a woman arrives – the rest is analogy and reflection, nested within the expression of thanks to Allius“ (1992, 35). Allein schon die Tatsache, daß man sich in der Forschung bis heute nicht darüber einig ist, ob hier eine einzige Elegie vorliegt (was m.E. der Fall ist) oder der Text in mehrere Gedichte zu zerlegen ist, zeigt deutlich, daß Carmen 68 nicht auf jeden Leser so wirkt, als sei es wirklich aus einem Guß. Das kann natürlich vom Dichter beabsichtigt sein – wer das Gedicht nicht, wie es meist geschieht, biographisch interpretiert, kann darin ein experimentelles Spiel mit der Gattung erkennen –, aber die Möglichkeit, daß Catull direkt und ganz ernsthaft an Elegien wie die auf den Papyri erhaltenen anknüpfte, läßt sich nicht gänzlich von der Hand weisen.
Carmen 68 ist das letzte Gedicht in einer Reihe von vier Elegien Catulls, c. 65–68, die zusammen mit 48 Epigrammen in elegischen Distichen (c. 69–116) ein geschlossenes Ganzes bilden. Das kann man allein schon daran erkennen, daß es im ersten und letzten Gedicht um die Übersendung von Versen des Kallimachos an den jeweiligen Adressaten geht (65.16 und 116.2: carmina Battiadae). Was uns hier vorliegt, ist offenbar das älteste erhaltene römische Gedichtbuch, in das ausschließlich elegische Distichen aufgenommen sind. Zwar sind die Carmina Catulls in einem einzigen Liber überliefert, aber von den bisher vorgelegten Analysen des Aufbaus der Sammlung sind diejenigen am überzeugendsten, die zu folgendem Ergebnis kamen: Catull verteilte seine Gedichte auf drei Bücher, die c. 1–60, 61–64 und 65–116 als thematische Einheiten voneinander trennten, und publizierte sie als Trilogie. Buch 1, das wie Buch 2 und 3 im ersten Gedicht auf die Musen Bezug nimmt (1.10, 61.2, 65.2f.), ist Cornelius Nepos gewidmet, besteht aus Epigrammen in verschiedenen Metren und trägt überwiegend jambischen Charakter, stellt also Invektive, Spott und derbe Erotik in den Vordergrund. Das Thema Hochzeit und Ehe dominiert in den vier langen Gedichten des zweiten Buches, die alle einen Bezug zu dem Gedichttyp des epithalamium („Hochzeitsgedicht“) herstellen und sich offenbar an einen Manlius Torquatus als Adressaten wenden, und Buch 3, dessen erstes Gedicht (wahrscheinlich) den Redner Q. Hortensius Hortalus anspricht, vermischt elegische mit jambischer Thematik. Die hier vollzogene Kombination von elegischen und epigrammatischen Gedichten könnte sich an das Vorbild hellenistischer Bücher mit Gedichten in elegischen Distichen anlehnen. Denn in Meleagers Kranz wurde, wie wir gesehen haben, die Reihe der Epigramme durch ein Gedicht eingeleitet, das von seiner Länge her als Elegie zu bezeichnen ist.
Da die Gedichtgruppen 1–60 und 65–116, also die Bücher 1 und 3, mehrere carmina enthalten, in denen der „ich“ “ Sagende von seinen Liebeserfahrungen mit einer Lesbia und einem Juventius berichtet, und da diese Gedichte mit Elegien des Properz, Tibull und Ovid motivisch verwandt sind, lohnt es sich, einen kurzen Blick darauf zu werfen. In dem überwiegend jambischen Buch 1 kommt es immer wieder vor, daß der poeta/amator der Person, die er liebt, Vorwürfe macht und gleichzeitig die eigene persona lächerlich erscheinen läßt. Das hängt damit zusammen, daß er ganz offensichtlich weder bei Lesbia noch bei Juventius die volle Erfüllung seiner erotischen Wünsche findet. Gleicht er schon hierin einem elegisch Liebenden, so auch darin, daß er, besonders in seinem Verhältnis zu Lesbia, die wie die puellae der Amores-Dichtung Züge einer Hetäre trägt (und von der biographischen Interpretation ohne zwingende Gründe mit Clodia Metelli gleichgesetzt wird), eine Sprech- und Handlungsweise an den Tag legt, die auf die zeitgenössischen Leser feminin wirkte. In c. 16 spricht er davon, daß ein Furius und ein Aurelius ihm unter Verweis auf seine „vielen tausend Küsse“ (milia multa basiorum) unterstellt hätten, er sei „kein richtiger Mann“ (male mas). Er reagiert darauf zum einen mit der priapischen Androhung der irrumatio und pedicatio (orale und anale Penetration), die, weil sie wie eine übertriebene Trotzgebärde wirkt und weil von der Ausführung nichts gesagt wird, den Vorwurf erst recht bestätigt. Zum anderen sagt er, an sich gehöre es sich für einen rechtschaffenen Dichter, castus („sittsam“) zu sein – damit meint er das Verhalten eines Mannes, wie es die römische Gesellschaft fordert –, aber Verse von der Art, wie er sie schreibt, müßten nun einmal molliculi („weichlich“) und parum pudici („allzu wenig sittsam“), also „unmännlich“ sein, da sie sonst nicht erotisch stimulieren könnten. Wir erfahren also etwas über die Wirkungsabsicht, die mit der Charakterisierung des poeta/amator als vir mollis („weichlicher Mann“) verbunden ist, und das erscheint wichtig, da auch die Ich-Sprecher der Amores-Dichtung diese Rolle spielen. Ich komme darauf zurück (S. 17).
In den Gedichten in elegischen Distichen, die ursprünglich das Buch 3 bildeten, nimmt der poeta/amator immer noch die von Furius und Aurelius gerügte unmännliche Haltung gegenüber Lesbia und Juventius ein und macht der Geliebten und dem Knaben auch wieder Vorwürfe. Aber er kompensiert seine Position der Schwäche durch den wiederholten Verweis auf etwas, das er allein für sich in Anspruch nimmt und das ihn offenbar „stark“ erscheinen lassen soll, weil er damit römischen Wertvorstellungen entspricht: seine Zugehörigkeit zu einer Welt, in der Ehe, Familie und Freundschaft noch etwas gelten. In dem Eröffnungsgedicht des Buches (c. 65) hören wir zum ersten Mal von einem Bruder des Ich-Sprechers und vernehmen die Klage über den Tod dieses Familienangehörigen. Damit ist nicht nur der gelegentlich klagend-pathetische und in diesem Sinne „elegische“ Ton des Buches 3 erstmals zum Klingen gebracht, sondern auch ein Leitmotiv vorgestellt: Immer wieder ist in den nachfolgenden Gedichten von familiären Banden und Beziehungen die Rede, und zwar entweder mit dem elegischen Pathos des Bekenntnisses zu dem damit verknüpften Ethos oder mit jambischem Spott über Menschen, denen dieses Ethos fehlt, weil sie z.B. Inzest treiben. Eng damit zusammen hängt es, daß der Ich-Sprecher Lesbias Untreue mehrfach mit Wertbegriffen konfrontiert, die Wohlverhalten in Ehe und Familie sowie im Verhältnis zu Freunden bezeichnen. So erklärt er der puella z.B. einmal vorwurfsvoll, er habe sie einst „nicht wie das gemeine Volk die Freundin, sondern wie ein Vater seine Söhne und Schwiegersöhne“ geliebt (c. 72.2f.). Oder er gebraucht bei der Charakterisierung seines Verhaltens gegenüber Lesbia Begriffe wie pietas, fides und bene facere (c. 76). Dadurch entsteht eine Spannung zwischen der Gegenwelt, in der sich sowohl der poeta/amator als auch die hetärenhafte Geliebte zusammen mit ihren Liebhabern – z.B. einem fellator namens Lesbius (c. 79) – bewegen, und der heilen Welt der römischen Werteordnung, der der poeta/amator ebenfalls angehören möchte. Was Catull damit aussagen will, ist schwer zu entscheiden, zumal Gedichte, die diese Spannung erzeugen, mit solchen vermischt sind, die entweder einfach derb-obszön oder ausgesprochen komisch oder beides sind. Doch nicht die Wirkungsabsicht dieses Dichters, sondern die der römischen Elegiker steht in diesem Buch zur Debatte.
Gallus, Properz, Tibull und Ovid stellen uns allerdings vor ein ähnliches Problem: Auch sie lassen nämlich, indem sie offenkundig an Catull anknüpfen, ihre personae unter Verwendung römischer Wertbegriffe von erotischen Erfahrungen sprechen. Dabei gehen sie sogar so weit, die Beziehung des poeta/amator zu der puella (bzw. dem Knaben in Tib. 1.4, 8 und 9) auf die Grundlage eines regelrechten Wertesystems zu stellen. Das ergibt sich daraus, daß der elegisch Verliebte im Gegensatz zu Catulls persona sein ganzes Dasein dem Dienst Amors und dem Dichten über dieses Dasein weiht. Er errichtet sich auf diese Weise eine alternative Existenz, in der die moralischen Werte der Welt, in der ein junger Römer aus gutem Hause normalerweise lebt, entweder unverändert oder unter umgekehrten Vorzeichen gelten. So kommt es, daß der elegische poeta/amator sein Lieben und Dichten nicht nur in ethischen Kategorien der privaten Welt von Ehe, Familie und Freundschaft beschreibt, sondern auch Begriffe aus dem Bereich des öffentlichen Lebens, vor allem demjenigen des Militärwesens, in seiner Sprache der Erotik als Metaphern verwendet. Die Konsequenz, mit der er dabei verfährt, gibt Anlaß dazu, von einer elegischen Gegenwelt und dem in ihr geltenden elegischen System zu sprechen. Zum Verständnis dieses Systems muß man vor allem drei elegische Grundhaltungen kennen: Liebe wird als Dauerzustand, als Lebensform in Konkurrenz zur normalen römischen Lebensform und als Sklavendienst gesehen. Dazu nun kurz das Wichtigste:
1. Liebe als Dauerzustand (foedus aeternum): Analog zur Institution der Ehe, die auf Lebenszeit geschlossen wird, soll die Bindung des poeta/amator an seine puella, mit der er in freier Liebe zusammensein möchte, nach seinem Wunsch bis zu seinem Tode währen. Bei Tibull z.B. hofft er darauf, daß seine Delia bei ihm ist, wenn er stirbt (1.10.59f.):
te spectem, suprema mihi cum venerit hora,
te teneam moriens deficiente manu.
Dich möchte ich anschauen, wenn meine letzte Stunde kommt, dich halten im Sterben mit ermattender Hand.
2. Liebe als Lebensform in Konkurrenz zur normalen römischen Lebensform: Der poeta/amator findet keine Erfüllung in den üblichen beruflichen Tätigkeiten, die in der römischen Oberschicht, also bei den Senatoren und Rittern, besonderes Ansehen genießen – z.B. der des Soldaten oder Kaufmanns –, sondern unterzieht sich Mühen, wie sie sonst von einer Alltagsbeschäftigung gefordert werden, ausschließlich im Bereich der Liebe und stellt somit z.B. die militia amoris („Kriegsdienst in der Liebe“) über das Handwerk des wirklichen Soldaten, was sich bei Properz wie folgt liest (1.6.27–30):
multi longinquo periere in amore libenter,
in quorum numero me quoque terra tegat.
non ego sum laudi, non natus idoneus armis:
hanc me militiam fata subire volunt.
Viele gingen bei lange andauernder Liebe gerne zugrunde; als einen von ihnen möge auch mich die Erde bedecken. Ich bin nicht für den Ruhm, nicht geeignet für die Waffen geboren: Dies ist der Kriegsdienst, den ich – so will es das Geschick – auf mich nehme.
3. Liebe als Sklavendienst (servitium amoris): Wie ein Sklave ordnet sich der poeta/amator dem Willen der puella als seiner domina (Herrin) unter, obwohl die römische Geschlechterordnung ihm in der Beziehung zu einer Frau die dominierende Rolle zuweist. So bittet z.B. der Ich-Sprecher in Ovids Amores in seiner ersten Rede an die Frau, die ihn „erbeutet hat“ (1.30.5f.):
accipe, per longos tibi qui deserviat annos;
accipe, qui pura norit amare fide.
Nimm mich, der ich dir lange Jahre Sklavendienste leisten will; nimm mich, der ich mit reiner Treue zu lieben verstehe.
Wie man sieht, beruhen die unter Punkt 1 und 2 genannten Grundhaltungen des poeta/amator gegenüber der Liebe darauf, daß er die für einen römischen Mann geltenden Normen auf seine Gegenwelt überträgt, während die dritte Grundhaltung eine Umkehrung dieser Normen innerhalb der Gegenwelt voraussetzt. Doch alle drei Grundhaltungen haben gemeinsam, daß der Mann in einer freien erotischen Beziehung zu einer Frau nicht die Rolle spielt, die, wie noch gezeigt werden soll (s.S. 19ff.), von einem Römer erwartet wurde, sondern eine von den zeitgenössischen Lesern als feminin eingeschätzte Handlungsweise an den Tag legt. Bei alledem handelt es sich um Motive erotischer Poesie, wie sie sich schon in griechischen Texten über die Liebe eines jungen Mannes aus gutem Hause zu einer Frau finden, die entweder Hetäre ist oder hetärenhafte Züge trägt, also etwa in der Neuen Komödie oder im hellenistischen Epigramm. Auch die erotischen Gedichte Catulls weisen motivische Entsprechungen auf. Aber nur die Elegie des Gallus, Properz, Tibull und Ovid kennt die Organisation dieser Motive als Wertesystem einer erotischen Gegenwelt, und nur bei diesen Dichtern wird die Gegenwelt permanent zu den Normen der realen römischen Welt in Bezug gesetzt. Es ist daher jetzt zu zeigen, wie die soziale Wirklichkeit aussah, die der zeitgenössische Leser im Hintergrund der Bühne, auf der die Elegiker ihre Gegenwelt errichteten, erkennen konnte.