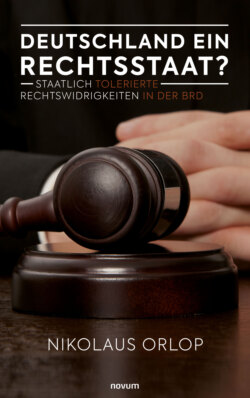Читать книгу Deutschland ein Rechtsstaat? - Nikolaus Orlop - Страница 9
ОглавлениеRichterliche Verstöße im Arbeitsrecht
Das Arbeitsgerichtsverfahren ist ein gesonderter Gerichtszweig des Zivilverfahrens und regelt die Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, wobei das Ziel dieser Gerichte ist, ein streitiges Arbeitsverhältnis nicht durch ein Gerichtsverfahren zusätzlich zu belasten. Aus diesem Grunde ist ein zwischen den Parteien geschlossener Vergleich nicht nur vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht, sondern auch eine durchaus erstrebenswerte Beendigungsmöglichkeit in diesem Gerichtsverfahren. Oberster Grundsatz des Arbeitsgerichtsverfahrens sollte und müsste allerdings sein, dass es sich dabei um ein objektives Gerichtsverfahren handelt, bei dem der Richter ausschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften den Sachverhalt abschließend beurteilt und nicht eine der beiden streitenden Parteien bevorzugt.
1. Richter als Sozialpolitiker
Es gibt zwar immer wieder Anwälte, vor allem solche, die in der Regel ausschließlich Arbeitnehmer vor den Arbeitsgerichten vertreten und behaupten, der Arbeitgeber habe vor diesem Gerichtszweig keinerlei Chancen. Das ist zwar grober Unsinn, weil im Allgemeinen ein objektiver Vorsitzender Richter den Arbeitnehmer, der vielleicht eine Bevorzugung erhofft, von vornherein darauf hinweist, dass es sich hierbei um ein objektives Gerichtsverfahren handelt. Ein korrekter Richter würde darauf hinweisen, dass ausschließlich die Sach- und Rechtslage den Ausgang des Verfahrens bestimmen. Dennoch sind häufig Richter oder Richterinnen anzutreffen, die dazu neigen, den Standpunkt des Arbeitnehmers etwas positiver und auch wohlwollender zu sehen.
In diesem Sinne äußerte sich auch ein Richter am Arbeitsgericht Hamburg ganz offen und unmissverständlich. Er erklärte nämlich vor laufender Kamera ungeniert, ihm gehe es bei der Arbeitsgerichtsverhandlung nicht um Rechtsprechung. Er wolle vielmehr in der von ihm geleiteten Gerichtsverhandlung ausschließlich Sozialpolitik für die Schwächeren in unserer Gesellschaft betreiben.
Was mit diesem Arbeitsrichter in der Justiz in Hamburg geschah, ist nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass ein derartiger Vorsitzender Richter nicht nur gegen den absoluten Grundsatz der Objektivität in der Justiz verstößt. Für ihn war auch der verfassungsrechtliche Grundsatz der Gewaltenteilung ganz offensichtlich ein Fremdwort.
2. Richter nötigt zum Vergleichsabschluss
In ähnlicher Weise verhielt sich ein Richter am Arbeitsgericht München, der dafür bekannt war, dass er mit der Verfahrensordnung und wohl auch dem materiellen Arbeitsrecht offensichtlich Schwierigkeiten hatte. Wenn bei einem arbeitsgerichtlichen Termin die Parteien im Sitzungssaal erschienen, begann er sofort mit dem Satz: „Ich mache nur Vergleiche“. Sollte sich dann aus verständlichen Gründen einer der Parteienvertreter, in der Regel der Arbeitgebervertreter, weigern, ging der Richter soweit, die Parteien ins Beratungszimmer zu nötigen, um hier, ohne Anwesenheit der notwendigen Öffentlichkeit, über eine vergleichsweise Beendigung des Rechtsstreits zu verhandeln und die Parteien förmlich zu einem Vergleichsabschluss zu zwingen.
Dieser Richter hatte, einmal unterstellt, dass ihm die Verfahrensordnung zumindest in den Grundzügen bekannt war, die Regelungen des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG), einen diesbezüglichen Sachverhalt zu erforschen, gründlich missverstanden. Dieses Gesetz befasst sich, wie schon der Name sagt, mit dem allgemeinen Schutz des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitgeber durch Kündigung das Arbeitsverhältnis beenden möchte.
Nach § 9 KSchG kann der Richter, wenn dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses trotz Unwirksamkeit der Kündigung nicht mehr zuzumuten ist, das Arbeitsverhältnis auf Antrag auflösen. Gleichzeitig spricht das Gericht dem Arbeitnehmer eine angemessene Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes zu. Viele Arbeitsrichter vermitteln allerdings den Eindruck, wegen des laufenden Rechtsstreits zwischen den Parteien sei die Fortsetzung des Vertragsverhältnis dem Arbeitnehmer in der Regel sowieso nicht mehr zuzumuten. Sie arbeiten deshalb häufig auf eine Beendigung mit einer Abfindung hin. Dies hat einerseits für den Richter den immensen Vorteil, in einer Verhandlung den Rechtsstreit insgesamt zu beenden, andererseits muss das Gericht keine Entscheidung mehr treffen, die durch ein Berufungsurteil des Landesarbeitsgerichtes wieder aufgehoben werden könnte. Und die Anwälte werden vom Gesetzgeber zusätzlich belohnt, indem sie bei Vergleichsabschluss neben den normalen Gebühren eine zusätzliche Vergleichsgebühr erhalten.
In dieser Weise wird, manches Mal fast in Form einer Nötigung, die eine Partei, meistens der Arbeitgeber, zum Abschluss eines Vergleiches gezwungen, obwohl sie eigentlich die berechtigte Auffassung vertritt, z. B. eine Kündigung ordnungsgemäß wirksam und völlig zu Recht ausgesprochen zu haben.
Diese Art eines Gerichtsverfahrens hat mit der Rechtsstaatlichkeit der Justiz nichts mehr gemein. Hier wird eine Partei gezwungen oder richtiger gesagt, genötigt, sich zu etwas zu entscheiden, das sie berechtigterweise nicht wollte. Weigert sich der Arbeitgeber dennoch, einem Vergleichsabschluss zuzustimmen, riskiert er in aller Regel, ein unterliegendes Urteil hinzunehmen. Damit wird entweder das Arbeitsverhältnis fortgesetzt oder die Berechtigung der Kündigung muss erst in einem langwierigen Verfahren, unter Umständen in drei Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht, mit enormen finanziellen Kosten durchgeführt werden.
3. Richter bevorzugt bewusst eine Partei
In einem Fall waren die Parteien zwar mit dem Abschluss des Vergleichs und der Höhe der Abfindung einverstanden. Dennoch wollte der Vorsitzende Richter aus unerfindlichen Gründen dem Arbeitnehmer zu einer höheren Vergleichssumme verhelfen.
Der Arbeitgeber hatte einem Baupolier mit einem Monatsgehalt von ca. 4.000 DM aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen gekündigt. Dabei war ihm aber der Fehler unterlaufen, dass die schriftliche Kündigung dem Arbeitnehmer erst nach Ablauf der sechs Monate zugegangen war. § 1 KSchG, der die soziale Rechtfertigung einer Arbeitgeberkündigung darstellt, ist praktisch ein gesetzliches, frei kündbares Probearbeitsverhältnis. Hier kann der Arbeitgeber, abgesehen von einer Sittenwidrigkeit, das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer noch frei kündigen.
Durch den Ablauf dieser Sechs-Monat-Frist hatte dieser Polier den gesetzlichen Kündigungsschutz jedoch erworben, so dass ihm nur noch gekündigt werden konnte, wenn ein bestimmter berechtigter Grund vorlag. Er erhob somit zulässigerweise Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht, hatte aber bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden, bei dem er sich offensichtlich wohler als bei dem früheren fühlte. Die Klage hatte somit lediglich den Sinn, von dem früheren Arbeitgeber zulässigerweise wenigstens eine Abfindung für den Verlust des alten Arbeitsverhältnisses zu erhalten. Vor dem Gerichtstermin trafen sich der Kläger und der Anwalt des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer erklärte, mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und mit der vom Arbeitgeber angebotenen Abfindung in Höhe von 1.000 DM einverstanden zu sein.
Im Gerichtssaal teilten beide daraufhin dem Vorsitzenden Richter der Kammer mit, der Kläger sei mit der angebotenen Abfindung von 1.000 DM einverstanden, der Vergleich müsse nur noch protokolliert werden. Bei einem monatlichen Gehalt für einen Polier von 4.000 DM, einer Abfindungssumme von einem halben Monatseinkommen und einer Betriebszugehörigkeit von lediglich sechs Monaten war damit die vom Arbeitgeber angebotene Abfindungssumme von 1.000 DM absolut korrekt. Dies ergibt sich auch aus § 1a Abs. 2 KSchG, wo die Höhe der Abfindungssumme gesetzlich festgelegt ist.
Aus völlig unerfindlichen Gründen erklärte aber der Vorsitzende Richter, mit der Höhe der Abfindungssumme sei er nicht einverstanden. Sie müsste in jedem Fall bei 1.500 DM liegen. Dabei hätte dem Richter klar sein müssen, dass der zu vereinbarende Vergleich – außer er wäre sittenwidrig – eine ausschließliche Vereinbarung zwischen den Parteien ist. Als dem Arbeitgeber-Anwalt schließlich der Geduldsfaden riss, erklärte dieser, der Richter möge seine Richterrobe ausziehen, sich eine Anwaltsrobe besorgen und könne dann mit dem Beklagtenvertreter über die Höhe verhandeln. Das Verfahren endete damit, dass es in einem späteren zusätzlichen Streittermin bei der Abfindungssumme von 1.000 DM blieb. Der neue Termin war völlig unnötig und hatte Gericht und Anwaltskanzlei lediglich zusätzliche Zeit und Kosten verursacht. Die Parteien müssen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und die Abfindungshöhe einig sein (vorausgesetzt, dies ist alles nicht sittenwidrig). Die Aufgabe des Richters ist es in diesem Fall lediglich, den abgeschlossenen Vergleich ins Gerichtsprotokoll zu diktieren, damit er sich in den Akten befindet und das Verfahren beendet ist.
Was hat ein derartiges Verhalten des Richters noch mit einem unparteilichen, objektiven rechtsstaatlichen Gerichtsverfahren zu tun, wenn er sich anmaßt, lediglich die Situation der einen Partei zu verbessern?
4. Richter missachtet gesetzliche Vorschrift
Manche Richter (oder Richterinnen) sind nicht gewillt, sich an gesetzliche Vorschriften und die dazu ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung zu halten. Leider muss man als Anwalt immer wieder feststellen, dass dieses Richterverhalten kein Einzelfall ist.
Eine Richterin am Arbeitsgericht, noch dazu eine besonders qualifizierte Juristin, erklärte in einem Arbeitsgerichtsverfahren im Streittermin, in dem in aller Regel unmittelbar das Urteil erlassen wird: Der Beklagtenvertreter einer Münchner Firma hätte bei seiner Begründung einer personenbedingten Kündigung noch zusätzlich vortragen müssen, wie oft am Tag der mittlerweile kranke Arbeitnehmer die schweren Zementsäcke tragen musste. Auf die Bitte des Arbeitgebervertreters um eine kurze Schriftsatzfrist zur Beantwortung erwiderte die Richterin, eine Schriftsatzfrist werde nicht gewährt. Das Gericht werde sofort mit einem Endurteil entscheiden. Es war somit klar, dass dies natürlich zu Ungunsten des Arbeitgebers ausgegangen wäre. Die Richterin begründete ihre Haltung mit dem Hinweis, die Vorschrift des § 139 ZPO (richterlicher Hinweis an die Parteien, wenn diese etwas übersehen haben) gelte nicht für Rechtanwälte, schon gar nicht für Fachanwälte für Arbeitsrecht, die so umfassend informiert sind wie der betreffende Anwalt.
Der Rechtsanwalt erklärte daraufhin in der Sitzung, er würde keinen Antrag stellen. Damit war das Gericht praktisch gehindert, eine endgültige Endentscheidung zu fällen. Es hätte lediglich ein Versäumnisurteil erlassen können. Die Frau Vorsitzende erwiderte daraufhin treuherzig (unter großem Gelächter aller Anwesenden im Sitzungssaal): „Herr Rechtsanwalt, Ihr Verhalten, keinen Antrag zu stellen, ist prozessual unanständig“.
Abgesehen von der durchaus humorvollen und witzigen Äußerung der Gerichtsvorsitzenden muss das Verhalten aber dennoch entschieden kritisiert werden. Diese Richterin war nicht nur eine gute Juristin, was von allen, die mit ihr zu tun hatten, so gesehen wurde. Sie befand sich permanent in einem Irrtum über diese Vorschrift mit der richterlichen Hinweispflicht (§ 139 ZPO). Denn der Bundesgerichtshof hatte schon längst mehrfach entschieden, dass auch ein Fachanwalt für Arbeitsrecht etwas übersehen kann, genauso wie sich im Übrigen auch ein Richter irren bzw. etwas übersehen kann. Da die besagte Richterin einerseits eine hervorragende Juristin war, andererseits auch im Allgemeinen als nicht überheblich angesehen werden konnte, bleibt die Frage, was sie zu dem Verhalten veranlasste. Weshalb legte sie die Gesetzesnorm bewusst falsch aus und ignorierte einfach die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH? Liegt hier einfach nur eine richterliche Willkür vor? Oder sollte man sagen, der Richter in der deutschen Justiz ist so unabhängig, wie es das Richtergesetz betont, dass er auch Gesetze und Rechtsprechung frei auslegen kann?
5. Richter begeht Rechtsbeugung
Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich bei demselben Arbeitsgericht, allerdings unter einem anderen Richter, der noch einen Schritt weiter ging.
Ein Arbeitgeber hatte seinem Bauarbeiter wie üblich zu Beginn der Winterzeit gekündigt mit dem Versprechen, ihn eventuell im kommenden Frühjahr wiedereinzustellen. Als sich die Wiedereinstellung verzögerte, verklagte der Arbeitnehmer verständlicherweise den Unternehmer, ihn wieder zu beschäftigen. Da ein unmittelbarer Anspruch auf Weiterbeschäftigung nicht bestand, kam der klägerische Anwalt im letzten Termin auf die Idee, die eventuell nicht ordnungsgemäße Betriebsratsanhörung beim Ausspruch der Kündigung als Anspruchsgrundlage zu benutzen. Die Kündigung mit der erfolgten Betriebsratsanhörung lag mittlerweile über neun Monate zurück, so dass auf diesen Gesichtspunkt von der Beklagtenseite bei der Klageerwiderung verständlicherweise nicht eingegangen worden war.
Der Arbeitsrichter erklärte darauf hin, er werde die Begründetheit der Arbeitnehmerklage auf die bestrittene Betriebsratsanhörung stützen. Eine vom Beklagten erbetene kurze Schriftsatzfrist, dieser klägerische Einwand sei überraschend, lehnte der Richter ab. Als sich der Beklagtenanwalt daraufhin weigerte, einen Antrag im Termin zu stellen, damit der Richter es unterließ, eine endgültige Entscheidung zu fällen, erklärte dieser dem Anwalt, für die Beklagtenseite völlig überraschend: „Der Antrag auf Klageabweisung ist bereits in Ihrem vorbereitenden Schriftsatz gestellt worden.“
Für den Nicht-Juristen muss hierbei festgehalten werden, dass im Zivilverfahren, vor den Amtsgerichten, Arbeitsgerichten usw. so wie auch bei den Strafgerichten der Grundsatz der Mündlichkeit gilt. Alle für das jeweilige Verfahren notwendigen Anträge sind nur wirksam, wenn sie im Termin mündlich gestellt und anschließend im Protokoll des Gerichts niedergelegt worden sind. Schriftsätze sind nur ein vorbereitender Vortrag. Dem Vorsitzenden Richter war dies alles natürlich bekannt. Dennoch erließ er ein Urteil zugunsten des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, ohne dass im Termin ein wirksamer Antrag gestellt worden war. Dieser schwerwiegende Verfahrensfehler des Arbeitsrichters in der ersten Instanz wurde zwar vor dem Landesarbeitsgericht München in der Berufungsverhandlung wieder korrigiert, allerdings nur auf Druck des Beklagtenvertreters.
Dennoch muss das Verhalten des Arbeitsrichters als eine schwerwiegende Rechtsverletzung gewertet werden. Hierbei handelte es sich nicht nur um eine reine Willkürmaßnahme, sondern um eine eindeutige strafbare Rechtsbeugung. Denn dem Vorsitzenden Richter am Arbeitsgericht München war der Grundsatz der Mündlichkeit vor den Arbeitsgerichten sehr wohl bekannt. Er wusste darüber hinaus auch, dass Schriftsätze, die vor den Arbeitsgerichten zur gegenseitigen Information von beiden Parteien gewechselt werden, ausschließlich provisorischen Charakter haben. Da er sein Urteil völlig zu Unrecht zugunsten der einen Partei und zu Lasten der anderen Partei gefällt hatte, war es somit eindeutig eine strafbare Rechtsbeugung. Sie hätte eigentlich von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden müssen. Eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung wurde aber nicht erstattet, weil sie in so gut wie allen Fällen erfolglos ist. Denn die Gerichte, bis hin zum Bundesgerichtshof, sind der Auffassung, geringe „Rechtsbeugungen“ seien nicht zu verfolgen.
Eine strafbare Rechtsbeugung im Sinne von § 339 StGB war eindeutig gegeben. Der Richter wusste, dass er damit einseitig unter Verletzung der gesetzlichen Vorschriften eine Partei bevorzugt und die andere benachteiligt. Die genannte Vorschrift (§ 339 StGB) stellt unmissverständlich fest: „Ein Richter, (der) sich … zugunsten … einer Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft“. Es ist wirklich skurril, dass ein Richter einerseits die anzuwendenden Gesetze ebenso wie die Strafgesetze genauestens kennt, sich aber dennoch ohne Skrupel einfach nicht daranhält und gegen die Gesetze verstößt.
6. Kein gerichtliches Interesse für Flüchtlinge
Wie mit Flüchtlingen vor Gericht umgegangen wird, zeigt ein Rechtsstreit Ende des Jahres 2020.
Ein afghanischer Flüchtling, vor den Taliban mit seiner gesamten Familie über den Iran und die Türkei nach Deutschland geflohen, hat mittlerweile ein bleibendes Aufenthaltsrecht. Er hat sich integriert, spricht gut Deutsch, hat die Gesellenprüfung im Fliesenlegerhandwerk sehr erfolgreich absolviert und ist nunmehr bei einer oberbayerischen Fliesenlegerfirma tätig. Gut erzogen, immer pünktlich und hilfsbereit, liefert er hervorragende Arbeiten ab, die ihm großes Lob bei den Auftraggebern seines Chefs einbringen. Der möchte ihn sogar zum Vorarbeiter befördern. Dennoch wird er von diesem Arbeitgeber, bei dem er nur 14 Monate angestellt ist, fortlaufend in den monatlichen Abrechnungen betrogen. Nachdem er aus diesem Grunde selbst kündigt, erhält er von dieser Firma, die ihn offensichtlich ungern verliert, aus Verärgerung über die Kündigung des Arbeitnehmers eine fristlose Kündigung, die derart abwegig ist, dass selbst ein Rechtsunkundiger dies sofort erkennen würde.
Das Arbeitsgericht München lässt sich zur Terminierung einer Güteverhandlung (vorgeschrieben zwei Wochen bei Kündigungen nach § 61a ArbGG) fast zwei Monate Zeit. Den ausführlichen Klageschriftsatz wegen der unwirksamen fristlosen Kündigung und der klägerischen Nachzahlungsforderung von fast 10.000 Euro nimmt das Gericht offensichtlich nicht zur Kenntnis. Der Beklagtenvertreter darf im ersten Termin seine wenig überzeugende Klageerwiderung ausführlich vorlesen. Ohne auf die gesetzlich vorgeschriebene Erörterung der Sach- und Rechtslage (§ 54 ArbGG) überhaupt nur annähernd einzugehen, erklärt die Vorsitzende Richterin, der Klageschriftsatz sei unverständlich und die Ansprüche des Klägers seien alle verfallen.
Laut Arbeitsvertrag hatten die Parteien ausdrücklich vereinbart, dass der gesetzliche Mindestlohn (statt 18 € nur 9,35 €) nicht verfallen kann. Stattdessen ist das Gericht lediglich an einem Vergleichsabschluss interessiert. Der Flüchtling wird von der Vorsitzenden sogar noch bedrängt, den Vergleichsvorschlag doch sofort anzunehmen, obwohl sein anwaltlicher Prozessvertreter fortlaufend und sehr deutlich davon abrät.
Das spätere Gerichtsprotokoll weist ebenfalls gravierende Mängel auf. Die im Termin anwesende Beklagte wird nicht aufgeführt. Dass der Kläger den Beklagtenschriftsatz erst im Termin übergeben bekommt, das Gericht ihn aber bereits vorher per Fax erhalten hat, ist für das Gerichtsprotokoll völlig unwesentlich. Der gerichtliche Hinweis im Termin, die Klage sei unverständlich und die Forderung verfallen, ist für die Kammer des Arbeitsgerichts München in der Protokollabschrift identisch mit der gesetzlich vorgeschriebenen ausführlichen Erörterung der Sach- und Rechtslage.
In einem solchen Fall hat die Partei wenigstens noch die Möglichkeit, das Verhalten der Richterin im Rahmen ihrer Amtstätigkeit durch ihren Dienstvorgesetzten, den Präsidenten des Arbeitsgerichts, mittels einer Dienstaufsichtsbeschwerde überprüfen zu lassen. Aber selbst das bleibt erfolglos. Dieser weist die Partei höflich, aber bestimmt darauf hin, dass § 26 Richtergesetz zwar die Dienstaufsicht über den Richter/die Richterin regelt, der ordnungsgemäße Ablauf des Verfahrens und der Rechtsstreit insgesamt aber eine Einheit bilden würden. Deswegen entfalle eine Dienstaufsicht, da andernfalls die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt würde.
Dafür hatten die ersten Richter des neu geschaffenen Bundesgerichtshofes unter ihrem Vorsitzenden schon gesorgt. Sie hatten das von ihnen konzipierte Richtergesetz auf Veranlassung des damaligen Justizministers so verfasst, dass Maßnahmen und Vorwürfe gegen Richter wegen der Vorkommnisse im Dritten Reich, aber auch bei allen sonstigen Verfahren gegen Richter ausgeschlossen sind.
Ein Antrag im laufenden Arbeitsgerichtsverfahren, die Richterin wegen Befangenheit abzulehnen, bringt ebenfalls nichts, zumal der betreffende Bescheid nach der Verfahrensordnung auch nicht angreifbar ist. (Der Antrag des Klägervertreters, die Vorsitzende Richterin wegen Befangenheit abzulehnen, war letztlich nur dadurch erfolgreich, dass sich die Richterin wegen Befangenheit selbst ablehnte.) In einem derartigen Rechtsstreit, wie dem geschilderten, kann die Partei nur noch hoffen, vielleicht in der nächsten Instanz einen objektiven Richter zu finden, der den Rechtsstreit nach den gesetzlichen Regelungen entscheidet.
Diese Aufzählung von Gesetzes- und Rechtsverstößen vor den Arbeitsgerichten ließe sich beliebig fortsetzen und würde den Leser nur ermüden. Bei derartigen Gesetzwidrigkeiten wird sicherlich auch der nicht unberechtigte Einwand erfolgen, dazu sei der Rechtsanwalt als rechtskundiger Jurist schließlich da, der solche Verstöße monieren und Abhilfe schaffen kann. Das ist richtig. Dieser Einwand verkennt jedoch die Tatsache, dass die Verhandlungen vor den Arbeitsgerichten, ebenso wie vor den Amtsgerichten, in zivilen Streitigkeiten ohne anwaltlichen Beistand – im Gegensatz zu den höheren Instanzen – von den Parteien selbst geführt werden können. Dabei können allerdings solche aufgezählten Verstöße fatale Folgen für die eine oder andere Partei haben, ohne dass sie – mangels erforderlicher Kenntnisse der Parteien – korrigiert oder moniert werden können.