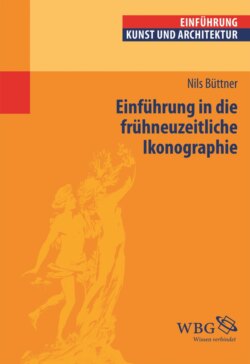Читать книгу Einführung in die frühneuzeitliche Ikonographie - Nils Büttner - Страница 10
|19|II. Bilder sehen und verstehen 1. Jerusalem ist überall
ОглавлениеJe genauer der einstige Kontext eines Werkes bestimmbar ist, desto besser gelingt zumeist die historisch fundierte Interpretation. Die systematische Rekonstruktion zeitgenössischer Vorstellungen und Erwartungen, wie des historischen Bildungshorizonts der Künstler und ihres Publikums, gilt deshalb heute als Voraussetzung der Deutung eines Kunstwerkes (Schütze 2005). Die sorgsame Berücksichtigung der zeitgenössischen episteme kann zugleich vor dem Irrtum bewahren, jedem aus der historischen Distanz rätselhaft anmutenden Werk zu unterstellen, dass es absichtsvoll als Rätsel verfertigt oder schon von den Zeitgenossen als solches verstanden wurde (Arnulf 2002).
offensichtliche Symbolik
Um die zahlreichen symbolischen Implikationen der so naturgetreu ins Bild gesetzten Motive in den religiösen Historienbildern Jan van Eycks zu charakterisieren, führte Erwin Panofsky in seinem Buch Early Netherlandish Painting 1953 den Begriff der „versteckten Symbolsprache“ ein, des „disguised symbolism“. Dieser Begriff etablierte sich in der kunstwissenschaftlichen Literatur, die sich auf den Spuren Panofskys auf die Suche nach verborgenen Symbolen machte. Die Formulierung ist unglücklich gewählt, denn sie unterstellt den Bildern fälschlich geheimnisvolle und geheime Inhalte. Dabei war das Denken in Analogien, in vergleichenden Bildern und symbolischen Bezügen eine im Mittelalter weit verbreitete Praxis. Es steht außer Frage, dass das Verständnis der symbolischen Gehalte eines Bildes gewisse Kenntnisse erforderte, doch war deren Sinnbildlichkeit keineswegs versteckt. Denn viele derartige Bilder waren an öffentlichen Orten zu sehen, in Rathäusern genauso wie in Kirchen. Es gab Bilder in unterschiedlichsten Medien, Formaten und Materialien, die in unterschiedlichsten Kontexten standen. Manche waren spezifischen Gruppen vorbehalten, andere appellierten an sehr weit gefasste Personenkreise. Manche Bilder waren in privatem Eigentum und Gebrauch, andere gehörten sozialen Gruppen oder Körperschaften. Trotz dieser Vielfalt hatte sich im Mittelalter ein überschaubares und verhältnismäßig fest umrissenes Themenspektrum etabliert. Man folgte weithin der von Horaz in seiner Ars poetica (128f.) gegebenen Empfehlung, besser ein vertrautes Thema zum wiederholten Male darzustellen, als etwas gänzlich Neues zu erzählen. Immer wieder wurden Personen und Ereignisse der Heilsgeschichte dargestellt. Hinzu kamen die aus der antiken Mythologie und dort vor allem den Metamorphosen Ovids entlehnten Themen. Außerdem wurden historische Ereignisse, Schlachten und Siege dargestellt, wobei Weltgeschichte und Heilsgeschichte als untrennbare Einheit verstanden |20|wurden. Dieses Geschichtsbild hatte schon im Mittelalter dafür gesorgt, dass Ereignisse der profanen Geschichte problemlos darstellbar waren und oft neben und mit Ereignissen der Heilsgeschichte dargestellt wurden.
Gemäß der in der Vormoderne weit verbreiteten Idee „Jerusalem ist überall“ (Ehbrecht 2001), finden sich immer wieder auf Altarretabeln im Kontext des Heilsgeschehens Abbildungen identifizierbarer Städte. Die Bürgergemeinde einer Stadt verglich sich dem Himmlischen Jerusalem, und tatsächlich war das ewige Jenseits ein fester Bestandteil der in jedem Gottesdienst beschworenen Gemeinschaft der Lebenden und der Toten. Auch darf man nicht vergessen, dass die Glaubensvorstellung die vorhandenen Reliquien mit der geistigen Gegenwart der jeweiligen Heiligen verband. Christus selbst war im Rahmen einer Messfeier nach der Transsubstantiation in Gestalt der Hostie und des Weines leibhaftig anwesend. Dem Heiligen war dadurch ein fester Platz im Diesseits zugewiesen und dem Diesseits sein Platz in der Heilsgeschichte, die nicht als etwas Vergangenes wahrgenommen wurde. Gottes Schöpfungsplan bestimmte die Gegenwart, wie auch Gott allgegenwärtig war. Der gemalte Ausschnitt der sichtbaren Welt, in dem die heiligen Figuren gezeigt waren, visualisierte in religiösen Bildern mithin die unzweifelhafte Bedeutung des heilsgeschichtlichen Geschehens für das Hier und Jetzt.
Sehen und Hören
Im Bereich des christlichen Themenkreises hatte sich seit dem Mittelalter ein fester Kanon an Bildern und Motiven etabliert, die stetig reproduziert und variiert wurden. In Wandbildern und Altarwerken, die bis zur Reformation alle Kirchen schmückten, wurden immer wieder Christus und das von ihm ausgehende Heil visualisiert. Es wurden sein Leben und Sterben ins Bild gesetzt, genauso wie die Legenden Mariens und jener Heiligen und Märtyrer, die den rechten Glauben verbreitet hatten oder gar für ihn gestorben waren. Diese Bilder wurden seit dem Mittelalter als Medium der Glaubensunterweisung verstanden und eingesetzt. Entsprechend vielzitiert war das berühmte Diktum von Papst Gregor dem Großen, dass Bilder nützlich seien, „damit jene, die nicht lesen können, wenigstens aus den Erscheinungen auf den Wänden entnehmen können, was sie aus den Büchern nicht verstehen würden“ (Registrum XI, 10, Ed. Norberg II, 874; Hecht 2014, 63f.). In eine ähnliche Richtung zielte der Sentenzenkommentar des hl. Thomas: „Es gab eine dreifache Begründung für die Einführung der Bilder in der Kirche. Zuerst wegen der Unterweisung der Ungebildeten, die durch die Bilder gleichsam wie durch besondere Bücher unterrichtet werden. Zweitens, damit das Geheimnis der Fleischwerdung und die Beispiele der Heiligen stärker im Gedächtnis wären, wenn sie täglich vor Augen stehen. Drittens, um die Neigung zur Andacht anzuregen, die durch das Gesehene wirksamer angeregt wird, als durch das Gehörte“ (Hecht 2012, 250). Vor allem die vielzitierten Worte Gregors dürfen dabei allerdings nicht dahingehend missverstanden werden, dass Bilder vor allem für jene hergestellt worden seien, die nicht lesen und schreiben konnten. Im Gegenteil entstanden Bildwerke aller Art auch und vor allem für die Angehörigen der Bildungsschichten, allen voran für den Klerus.