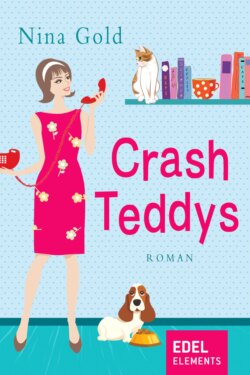Читать книгу Crash Teddys - Nina Gold - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Im Haus
der Ahnungslosen
ОглавлениеIn Köln-Mülheim steht ein kleines rotes Ziegelhaus, das sich halb verschämt an andere Ziegelhäuser lehnt, die allesamt rauh verputzt oder verklinkert sind und einen auf arielrein machen. Die Besitzer dieser vollverkleideten Reihenhäuser sind stolz darauf, »dat man da nur mal eben mit ‘em Schlauch drüberspritzen muß«. Nicht so unser Ziegelhaus, das sich stellenweise mit Moos und Schimmel schmückt. Es ist sandig rot und so alt, wie es eben alt ist, also fast achtzig Jahre. Die Stiegen sind steil und knarzig, die Räume verwinkelt, das Dach ein Buckel, auf dem nachts die Katzen patrouillieren und tagsüber Hagelschauer von Tauben niedergehen. Wir lebten dort zu viert, das heißt eigentlich zu fünft, denn ein Toter gehörte auch dazu. Das ist jetzt genau ein Jahr her, scheint mir aber Lichtjahre entfernt.
WG-Mitbewohner Nummer eins: Lämmlein, der viel zu spät, nämlich neun Jahre nach ‘68 geborene Revoluzzer, der am liebsten »alle, die nicht endlich mitziehen bei einer humanen Umgestaltung unserer Gesellschaft, an die Wand stellen würde«. Was er bevorzugt seinem Totenschädel Dignity, Mitbewohner Nummer zwei, erklärte. Der hörte nämlich weise grinsend zu und war sein treuster Begleiter. Lämmlein hatte Dignity während seiner kurzen, aber tiefschwarzen Gruftiephase aus einem Armengrab ohne Namen freigeschaufelt und mit Corega-Tabs von Kalkablagerungen befreit. Er ließ ihn in einem Turnschuhregal leben und kutschierte ihn in seinem hustenden Opel Kadett regelmäßig in der Gegend herum, damit Diggy die allgemeine Lage in Augenschein nehmen konnte.
Lämmlein heißt eigentlich Martin und ist gelernter Chemielaborant ohne Job. Damals schlug er sich als Zigarettenpromoter durch, was uns kartonweise Rauchwaren einbrachte. Ansonsten kiffte er sich gern die Hirse zu und experimentierte mit bedenklichen, selbstgemixten und leider sauguten Drogen. Wir liebten Lämmlein auch deshalb, weil er gern und gut spülte – mit Wurzelbürste und Kraftaufwand, also ganz anders als der übliche Y-Chromosomenträger, der Teller lediglich sanft badet oder sie nur andeutungsweise abstaubt und dafür auch noch kuhäugige Anbetung erwartet. Außerdem sorgte Lämmlein für erstaunlich saubere Toiletten.
Lämmleins flammende Reden gegen die allgemeinen und speziellen Arschlöcher dieser Welt ersetzten uns an so manchem Abend die üblichen schlaffördernden alkoholischen Erfrischungsgetränke. Einmal fiel ich vor lauter Erschöpfung sogar vom Stuhl, während er seine Pläne für vierhundertstöckige Hochhäuser erläuterte, »in denen man die Menschen zusammensperrt, damit sie sich mal wieder umeinander kümmern. Nix da, Eigenheim und Tür zu, die sollen mal wieder was miteinander zu tun kriegen. Arschlöcher ...«
Lämmleins eigentliche Wunde ist allerdings seine Mutter, eine konsequente, man könnte sagen professionelle Alkoholikerin, die sich nicht liebt, ihn nicht liebt und die Welt allgemein zum Kotzen findet. So eine Mutter kann dazu führen, daß jemand die ganze Welt zum Brennen bringen will und gleichzeitig Wert auf den Knick im Sofakissen legt. Typischer Fall von moderner Seelenspaltung, könnte man sagen. Wir Mädels wußten das, nur Martin-Lämmlein reagierte auf die Erwähnung seiner verkorksten Erzeugerin und seiner Macken stets mit frühkindlichstem Trotz, weshalb wir ihn einfach Lämmlein tauften und das Thema schleunigst fallenließen. Therapie für den Hausgebrauch war unsere Sache nicht ... oder, na ja, meine manchmal schon. Leider! Gelegentlich komme ich eben ins Grübeln, von wegen Papa, Mama, Freud und so.
Wie Frauen nun mal sind, ahnten wir natürlich damals schon, daß Lämmlein eines Tages an sich selbst verglühen würde. Vor allem Marusha, Mitbewohnerin Nummer drei. Mit knapp einundzwanzig Jahren meldete sich die Polin ohne exakt nachweisbares Elternhaus auf eine unserer Anzeigen (»Wohngemeinschaft sucht politisch korrekte Genossin – gezeichnet, Lämmlein«) in der Stadtzeitung. Soeben ihrer harten Punk- und Metalphase entwachsen, den Bauchnabel frei und ein grimmiges »Tach« auf den Lippen, erschien sie mit Sack und Pack auf unserer morschen Türschwelle – eine Großstadtindianerin, kampferprobt und zäh. Als Sammlerin für die Aktion Sorgenpunk – »Hasse ma ‘en paar Groschen« – hatte sie sich auf Kölns Straßen durchgeschlagen und den Winter in einem besetzten Haus in der Nähe der Weyerstraße verbracht – eine Punk-WG der härteren Gangart, die sie ohne bleibende Schäden und mit dem festen Vorsatz no more drugs überlebte. Im In-Treff Stadtgarten schmiß sie bald darauf die Frittenbude, indem sie ungeschälte Kartoffelstücke in die Friteuse haute, um sie ein paar vollblöden Szene-Touristen als American potatoe skins auf die Theke zu klatschen. Ihr »Mayo oder Ketchup?« bellte sie so entnervt, daß die Szenetouris ihren Einbruch in die Welt der wahren, stets schlechtgelaunten Szenehelden mit astronomischen Trinkgeldern wiedergutzumachen versuchten. Das führte allerdings dazu, daß Marushas Bauchnabel bald einem Abschlagsieb glich, so durchlöchert war er von Piercingringen, in die sie jede überschüssige Kohle sofort umtauschte.
Marushas weiches, herzförmiges Gesicht steht in merkwürdigem Gegensatz zu ihrem martialischen Outfit, das an archaische Stammesrituale erinnert. Ihrer eisblaugesträhnten, halblangen Haare wegen gleicht sie in meinen Augen »den schmerzensreichen, heilig-nüchternen Märtyrerinnen aus dem kalten Osten«, weshalb ich sie schon bald »Die Madonna aus der Eisdiele« nannte. Es sind diese Widersprüche in ihrem Wesen, die sie so reizvoll machen. Es ist möglich, sie dabei zu überraschen, wie sie einer selbstgezogenen Sonnenblume polnische Schlaflieder vorsingt, so rauh und kehlig, daß es einem das Herz zerreißt.
Und nun zu Shahi, Mitbewohnerin Nummer vier und, meistens jedenfalls, meine allerbeste Freundin. Obwohl, Kumpanin trifft es eher, denn ihr verdanke ich die Verstrickung in diverse, nicht ganz legale Aktivitäten.
Shahi ist eine verwöhnte, in Deutschland geborene Inderin mit klotzreichen Eltern von hohem Nervkaliber. Sie wünschten sich eine höhere Tochter mit Tussitugenden und besten Heiratschancen, durften statt dessen aber ein zickendes Girlie der Extraschärfe ihr eigen nennen, was sie zu gelegentlichen Panikanfällen und Wutausbrüchen veranlaßte, mit denen sie den Anrufbeantworter unserer WG füllten. Und eines kann ich euch sagen: Indische Wutausbrüche haben eine würzigere Klangart als deutsch-bleischwere Kummerergüsse. Hot and spicy. Achtet beim nächsten Besuch in einem indischen Restaurant einfach genau auf die nervenzerfetzend gemütliche Wirkung einer Endloskassette voll Sitargezupfe und Schrammelgesang, und ihr wißt, um welche Tonlage es sich handelt.
Shahi ist die multikultigste Menschenmischung, der ich bis dahin begegnet war. Dank karamelfarbener Haut und Mandelaugen sieht sie beneidenswerterweise aus wie die indische Tempeltänzerin aus einem Hollywoodschinken à la ›Der Tiger von Eschnapur‹. Dazu trägt sie meist einen Modemix aus bauchfreien Designerteilen, Plüschboas und Springerstiefeln, alles im Wert eines deutschen Mittelklassewagens. Als waschechtes Yuppiekind der Achtziger – ach ja, Shahi war die Älteste in unserer WG und der lebende Beweis dafür, daß man mit sechsundzwanzig immer noch ’ne Mattscheibe haben kann – liebt sie dekadente Einkaufsorgien, was sie allerdings nicht davon abhielt, den trashigen Neunzigern zu huldigen, indem sie ihr Zimmer mit den grellbunten Postern einer waschechten indischen Dschungelpartisanin schmückte.
Ganz die Tochter reicher Eltern trödelte Shahi einfach durch den Tag, vernachlässigte ihr Designstudium und lud mich häufig zum Shopping ein. Ab und zu sperrten ihre Eltern ihr allerdings die Plastikknete – aus pädagogischen Gründen, versteht sich –, was bei Shahi regelmäßig einen indisch-deutschen Wutausbruch à la »Scheiße, ich bin voll pleite und weiß nicht, wo ich Kohle für die Miete herkriegen soll« verursachte. »Willkommen im 21. Jahrhundert«, antwortete ich dann, »du bist mit deinen Problemen nicht allein, Prinzessin. Fünf Millionen Arbeitslosen geht es nicht anders. Zeit, das Leben mal ernst zu nehmen.« Doch alles, was ich darauf zu hören bekam, war: »Dito, du Nervtusse.« Und damit hatte sie nicht mal unrecht.
Ich war nämlich chronisch pleite, obwohl ich einen schlechtbezahlten Job nach dem anderen begann. Oder besser gesagt: Ich schmiß einen Job nach dem anderen, denn der richtige war einfach nicht dabei. Immerhin legte – und lege ich auch heute noch – Wert darauf, nicht meiner Mom zur Last zu fallen. Aus reinem Eigennutz übrigens, denn sie ging mir schon so genug auf den Zeiger, von wegen, was ich ihr alles so zu verdanken hätte, seit dem Tag, als ihre Fruchtblase und ich in ihr Leben geplatzt seien. Streiten ist unser Hobby, und im Erzeugen von Schuldgefühlen ist Mom unschlagbar. Ich halte es deshalb gern mit den Spice Girls, ›Get a job, get a life‹, was da heißen soll: Ohne eigene Arbeit und Knete kannst du dir Eigenständigkeit und Sinnsuche in die Haare schmieren, Baby, da wird nichts draus. Nur, wo liegt der Sinn der Arbeit oder besser: Welche Arbeit macht für mich Sinn? In jenem Sommer wußte ich das nicht. Und meine Mitbewohner auch nicht, weshalb wir unser Haus »Das Haus der Ahnungslosen« tauften.
Eine Sache war mir allerdings klar: Ich wollte etwas, das mit Häuserbau oder mit Schauspielerei zu tun hat. Was weiter kein Wunder ist, da ich der Sproß einer Bauunternehmerin und eines britischen Straßenkünstlers (Nachname unbekannt) bin. Letzterer nahm in den swinging seventies insofern am deutschen Straßenverkehr teil, als er mit seiner politisch-grotesken Szenencollage ›Hamlet fucks Hitler‹ durch die Gegend fuhr. Very british und total plemplem. Weshalb er nebenher jobben mußte, was er zeitweise auch auf einer Baustelle tat, wo er dann die Tochter des Bauunternehmers, also Mom, kennenlernte, mit ihr einen Sommer lang das Bett im Kornfeld aufschlug, um dann in das Nichts zu entschwinden, aus dem er gekommen war, und das, bevor meine Mutter ihm mitteilen konnte, daß ich, die Frucht ihrer Flowerpowerphase, in ihrem Bauch zu reifen begann.
Das einzige Lebenszeichen, das Mom danach jemals von ihm erhielt, war eine Postkarte. Fünf Jahre später und ohne Absender. Sie zeigte ein Aquarell eines wunderschönen englischen Herrenhauses aus dem 18. Jahrhundert inmitten einer Hügellandschaft. »Still want a palace, princess? Hope you got it. Robin«, stand da in schwungvoller Schrift.
Mom schenkte sie mir, weil ich die Briefmarke mit der Frau mit Krönchen darauf liebte. Als ich fünfzehn war und, wie sie meinte, reif genug, um zu verstehen, was für ein unverbesserlicher Spinner mein Vater gewesen sei, verriet sie mir, daß Robin mein Vater, der Straßenkünstler, ist. Von diesem Zeitpunkt an verehrte ich die Postkarte wie ein Heiligenbildchen und stellte mir vor, daß mein mysteriöser Dad der Besitzer des abgebildeten Kastens sein müsse, nicht weil ich scharf auf Geld war, sondern fest davon überzeugt, daß ich etwas Besonderes und völlig anders als Mom sei.
Geboren im Zeichen der Fische und aszendiert vom Zeichen der Löwin bin ich ein – mindestens – zweiseeliges Geschöpf, hin und her gerissen zwischen meiner gründelnden Wassernatur, sensibel und dem Künstlerischen zugeneigt, und meiner energiegeladenen, klauenbewehrten Sonnenseite, die, typisch löwisch, der Nachwelt gern etwas Palastartiges hinterlassen würde. »Seht her, das habe ich geschaffen.« Meine Mutter, Bauunternehmerin seit dem frühen Tod ihres Vaters, hatte nach eigenen Angaben stets beide Hände – »und das sind zu wenige« – voll zu tun, mich mit den Füßen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Sanft ging sie dabei nicht gerade vor.
Auch während des vergangenen Sommers hörte sie nicht auf, immer wieder meinen »Rücksturz zur Erde« in Angriff zu nehmen: Ich hatte nach einem Studium der Philosophie ein weiteres der englischen Literatur geschmissen. Sie vermittelte mir Jobs, die so gar nicht mein Film waren. Wie etwa der Schnarchposten bei einer Bauzulieferungsfirma, der mich dazu verpflichtete, Wärmedämmplatten, Bettungsmodule oder Hydraulikbeton-Vibratoren in hoher, aber angemessener Stückzahl zu bestellen, zu listen und an Baustellen weiterzuexpedieren. Und bei allem Spaß muß man sich doch ehrlich fragen: Wie lange kann sich ein Mensch mit Türfuttern, Muffen oder Doppelnippeln beschäftigen, ohne dabei einen Dachschaden zu kriegen?
Womit ich nun endlich an einem ganz normalen Frühlingsmorgen angelangt bin, der typisch für meine damalige Seelenlage war.