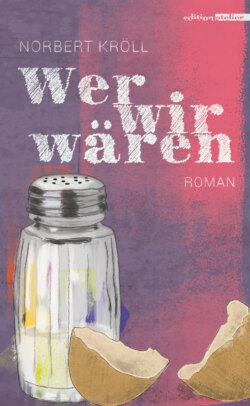Читать книгу Wer wir wären - Norbert Kröll - Страница 10
FÜNF
ОглавлениеZuerst dachte ich, es wäre eine Begleiterscheinung eines epileptischen Anfalls, aber dieser Gedanke blitzte nur sehr kurz auf und war schon wieder in den Tiefen der Deutungsmöglichkeiten verschwunden. Wenn man etwas zum ersten Mal erlebt, also etwas, das wirklich neu ist … klar, wenn man das Leben genau betrachtet, stellt man recht schnell fest, dass alles, jeder einzelne Moment, wie schön oder beschissen er auch sein mag, neu ist, weil kein Blick dem anderen gleicht, weil kein Ablauf, auch wenn er noch so ähnlich ausgeführt werden mag, exakt dieselben Bahnen beschreibt, weil der Wind niemals gleich bläst, der Staub niemals auf dieselbe Art und Weise zu Boden fällt, man die Arme niemals völlig gleich bewegt, weil die Muskeln sich von Tag zu Tag verändern, die Zellen sich erneuern und die Gefäße im Körper sich anpassen an ein Wachstum oder ein Austrocknen oder eine Aktivität oder den Schlaf oder eine zelluläre Anpassung stattfindet an die Umwelteinflüsse, denen man ausgesetzt ist. Und vom atomaren Bereich habe ich hier noch gar nicht gesprochen. Das Zittern, das Vibrieren der Atome, es läuft niemals gleich ab, weil die Temperaturen sich stetig ändern, die Positionen sich verschieben, weil die Materialien arbeiten, je nachdem, welchen Einflüssen sie ausgesetzt sind, weil die Meere nicht stillstehen und die Platten sich ineinander verkeilen, weil die Erde bebt, weil sie lebt, weil sie durchs Weltall schießt und die Galaxie sich mit ihr dreht. Alles ist neu, auch im langweiligsten Job, in der unromantischsten Beziehung, im ereignislosesten Lebensabschnitt eines Menschen, wenn man sie sehen könnte, diese feinen Verschiebungen, dann … aber man kann sie nicht sehen.
Wenn man also etwas, das tatsächlich neu ist, zum ersten Mal erlebt, also – wenn man so will – etwas Bedeutendes, weiß man nicht, wohin damit. Bei mir war es so. Ich versuchte es einzuordnen, aber stellte sogleich fest, dass der Ordner Klaus’ epileptische Anfälle dieses Ereignis nicht aufnehmen konnte. Weil ich mittlerweile wusste, wie seine Anfälle vonstattengingen. Sie verliefen meist sehr ähnlich, damit kannte ich mich aus. Die Nervenzellen im Gehirn, erklärte mir Klaus, nachdem ich das erste Mal einen seiner Anfälle mitbekommen hatte und er wieder bei sich war, würden sich unkontrolliert entladen. Auch sein Vater sei davon betroffen. In seiner Jugend, erzählte Klaus, habe er seinen Vater gehasst. Von der Mutter hatte er die fein gezogenen Lippen, die dunklen Augen, das dichte Haar und die zierlichen Ohren geerbt, vom Vater eine Krankheit. Freilich, sagte Klaus, hatte es nicht lange gedauert und er hätte gewusst, dass diese Beschuldigungen zu nichts führten, er hätte ihm alsbald verziehen, wo es im Grunde, so sehe er es jetzt, ja gar nichts zu verzeihen gab, weil ihm sein Vater von vorneherein nichts angetan hätte, außer vielleicht die Tatsache, dass er ihm, mithilfe seiner Mutter, Leben eingehaucht hatte. Ja, murmelte Klaus, er sei ihm gegenüber nicht fair gewesen, wobei, so denke er nun, die Aufgabe eines Kindes auch nicht sein könne, fair zu seinen Eltern zu sein.
Klaus war abwesend. Manchmal nur für einen Augenblick – für einen Augenblick zu lange, würde ich meinen –, andere Male jedoch für einige Sekunden bis zu einer halben Minute, meistens aber zehn Sekunden plusminus zwei. Die Zeiten habe ich ein paar Mal mit dem Handy gestoppt, denn die Absencen kamen häufig vor, manchmal sogar mehrmals am Tag, je nachdem, ob er genug geschlafen und seine Tabletten genommen hatte. Lamotrigin, Levetiracetam, Valproinsäure, Topiramat und in Ausnahmefällen durfte es auch Ethosuximid sein, jedoch nicht mehr als zweitausend Milligramm am Tag. In einem eigenen Regal im Bad bewahrte er die Packungen auf, eine kleine Ration davon stets in seinem Rucksack. Er zeigte sie mir. Pillen in verschiedenen Größen, Formen und Farben. Bisweilen kam es mir so vor, als ob er die Medikamente nach Herzenslaune untereinander mischte, bald diese, bald jene Tablette einwarf, je nachdem, welches Verpackungsdesign ihn gerade mehr ansprach. Es sei völlig egal, sagte er mit einem Schulterzucken, wenn ich ihn darauf ansprach, die können ohne Probleme kombiniert werden. Bekam er einen Anfall, wobei ich es eher einen Ab-fall nennen würde, spielten in seinem Gehirn die Nerven verrückt, sie feuerten unkontrolliert, seine Persönlichkeit schien sich nach außen hin abzuschalten, von ihm abzufallen, das Bewusstsein entglitt ihm, Klaus war angreifbar, auf Pause.
Er hielt inne, verharrte in seiner gerade eben noch ausgeführten Tätigkeit, sein Blick meist starr auf einen Punkt fixiert, der sich, so dachte ich, irgendwo außerhalb des Raumes (außerhalb des Bewusstseins, des Universums?) befinden musste. So ist das eben bei Künstlern, könnte man meinen, sofern man ihn nicht gut kannte. Die schauen dann, auf der Suche nach einer schöpferischen Eingebung, halt schon mal für ein paar Sekunden in eine unbestimmte Ferne, und wenn sie von diesen Tagträumen zurückkehrten, sind sie inspiriert genug, um weiter an ihrem Werk zu arbeiten, es zu verfeinern, ihm den letzten (nicht selten genialen) Schliff zu verleihen. Dazu würde dann auch das Zucken der Augenlider passen. Man könnte hineindichten, dass Klaus Ausschau hält, dass er mittels eines Supermanblicks durch die Wand vor ihm sehen könnte und dann noch durch die nächste Wand und die nächste und die nächste, und weil er dort so viel sieht, dahinter, also hinter dem Vorhang, hinter den materiellen Erscheinungen unserer Welt, könnte man fast meinen, deshalb und nur deshalb zuckten seine Lider, als ob sie das Gesehene durch diese Bewegung verarbeiten und ans Gehirn weiterleiten könnten. Das Erröten und Schwitzen, der erhöhte Herzschlag, es fügte sich stimmig in die Annahme, der Künstler sei von den Eindrücken, die er von der anderen Seite vernommen habe, gewiss derart überwältigt, dass sein Körper nicht anders könne, als zu schwitzen, dass seine Haut nicht anders könne, als zu erröten, dass, wenn man die Welt so sehe, wie sie ein echter Künstler sieht, man wahrscheinlich gar nicht anders reagieren könne, da müsse man für kurze Zeit alleine schon aus Ehrfurcht vor dem Wunder des Lebens in sich gehen, wegtreten, abschalten und – ja, wieso nicht? –, beten. So die Meinung eines Laien.
Ich solle mir keine Sorgen machen, sagte Klaus, als er meinen offenen Mund und den sorgenvollen Blick wahrnahm. Seit seiner Kindheit würden ihn die epileptischen Anfälle begleiten. Er habe Tonnen an Material darüber gelesen, habe an Selbsthilfegruppen teilgenommen, habe sich in etlichen Foren im Internet mit Leidensgeschwistern ausgetauscht, habe sich von spezialisierten Ärztinnen und Ärzten beraten lassen, sich mit einigen Studierenden der Medizinischen Fakultät unterhalten, mit anderen Worten: Er sei über seine derzeitige Lage äußert gut informiert.
Klaus gab einen Bruchteil seines Wissens über Epilepsie in einem halbstündigen Crashkurs an mich weiter. Es genügte, um meine Ängste zu besänftigen und mich mit seinen Aussetzern, die bald die spitzen Kanten des Außergewöhnlichen eingebüßt hatten, anzufreunden. Sie gehörten zu ihm, wie sein Lachen zu ihm gehörte, seine bedachte Art, den einen Fuß vor den anderen zu setzen, sein forschender, stets neugierig-kindlicher Blick.
Als ich Klaus nach den Weihnachtsferien wieder in Wien in seiner Wohnung antraf, dachte ich im allerersten Moment, sein eigenartiges Verhalten wäre die Begleiterscheinung eines epileptischen Anfalls. Von dieser Auslegung nahm ich nach einigen Minuten Abstand. Diesmal war es definitiv anders. Fast alles an Klaus war anders, verändert; er war nicht mehr das Original. Vielleicht war es in Kärnten zurückgeblieben. Vielleicht hatte jemand einen fehlerhaften Klon erstellt. Wäre es Anfang April gewesen, hätte es ein schlechter Aprilscherz sein können. Vielleicht sogar ein guter. Aber es war nicht Anfang April, sondern Anfang Januar, und es gab noch keine menschlichen Klone, zumindest keine, von denen ich etwas wusste.
Da stand er, weniger als einen Meter von mir entfernt, und sagte etwas, das ich nicht vergessen werde, das ich nicht vergessen kann, weil es der Anfang war von alledem, und ich mir wünschte, es hätte ihn nicht gegeben, dass der Anfang, der echte, dort geblieben wäre, wo er gewesen war, nämlich in der Ästhetik-Vorlesung im Hörsaal der Universität, dass die Person, die ich dort kennengelernt hatte, dieselbe Person geblieben wäre, dass sie in den Weihnachtsferien nicht aufgehört hätte zu existieren.
»Hast du aufgepasst«, sagte er, »als du gekommen bist, hast du aufgepasst, dass dir niemand folgt?«
»Wer soll mir denn gefolgt sein?«, fragte ich mit einem schiefen Lächeln.
»Na, die Kuttenträger«, sagte er. »Manchmal haben sie diese braunen Kutten an, mit den Kordeln um die Hüften, du weißt schon, aber das ist dann schon die doppelte Tarnung, die Tarnung der Tarnung, verstehst du?«
»Wie bitte?«
»Na, in Wahrheit haben sie drunter die schwarze Priesterkleidung an. Oben drüber die braunen oder weißen oder grauen Kutten, damit man denkt, dass das ganz normale Brüder sind, also Franziskaner oder Zisterzienser, Benediktiner, Minoriten, Dominikaner und so weiter, mit der Kapuze hinten dran, das kennst du bestimmt, aber das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Denn unten drunter, ja, da versteckt sich dann das Dunkle.«
Klaus ging zum Fenster, öffnete es, beugte den Oberkörper über den Rahmen und das Fensterbrett, schob den Kopf bedrohlich weit ins Freie und spähte zur Straße hinab; er schien dort nach etwas – oder jemandem – Ausschau zu halten.
»Klaus, soll das ein Witz sein?«, fragte ich. »Wenn ja, kannst du bitte damit aufhören?«
Er kam zurück ins Wohnzimmer, sofern man in diesem Fall von einem Zurückkommen sprechen kann.
»Aber das ist doch kein Witz«, sagte er und deutete mit dem Zeigefinger zum geöffneten Fenster. »Die wollen ja, dass ich alleine damit dastehe. Wenn du so willst, ist das der Witz an der ganzen Sache, ja. Das planen die doch, schon von Anfang an haben sie das so geplant. Dass mir nämlich keiner glauben wird, das haben sie mir prophezeit. Vor zwei Tagen nämlich bin ich unten gewesen bei der Bank um die Ecke, und da hab ich sie das erste Mal gesehen. Und gleich hab ich gewusst, dass die schon immer dagewesen sind, dass ich nur zu dumm gewesen bin, um sie zu erkennen. Seit Jahren müssen sie mir schon gefolgt sein. Ich habe einfach kein Auge dafür gehabt. Ich hätte sie längst sehen können, verstehst du? Aber die haben sich eben gut zu tarnen gewusst. Blöd sind sie nicht, das muss man denen lassen, blöd sind sie echt nicht. Aber gemein sind sie, die lenken das alles vom Hintergrund aus, die Fäden haben sie alle fein säuberlich in der Hand, an jedem Finger einen Strick und damit ziehen sie das Geschehen der Welt in die Richtung, die sie haben wollen.«
»Äh, entschuldige Klaus, hallo?! Ich kann dir leider echt nicht folgen«, sagte ich mit gerunzelter Stirn. »Was bitte soll das?«
»Was es soll, fragst du? Was es soll? Ja, aber siehst du denn nicht? Es verläuft alles nach deren Plan. Dass du mich fragst, was das soll, das haben sie doch eingefädelt. Dass ich jetzt so dastehe, als würde ich etwas Unverständliches von mir geben. Wo doch alles klar ist. Das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, dass ich die Zusammenhänge erkennen kann. Bei der Bank nämlich, es war genau der Moment, als ich meine Karte in den Schlitz gesteckt habe, um Geld abzuheben, da habe ich sie draußen stehen gesehen, die beiden Männer in Schwarz, oder war es Braun oder Grau, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls habe ich beim Automaten sofort auf Abbruch gedrückt, weil ich gewusst habe, dass, wenn ich den Code eingebe, sie mich haben würden, verstehst du? Den Zugang hätten sie gehabt zu allem, was ich davor gemacht habe, und zu allem, was noch kommen mag. Ich sage nur Erbschaft, mein Lieber, darauf sind sie nämlich aus. Im Geheimen die Strippen ziehen, damit alles so verläuft, wie sie es haben wollen. Das Geld soll fließen, hin zum Vatikan soll es beständig fließen. Ich habe immer geglaubt, dass die Bankiers die Strippen in der Hand haben, dass die das Geschehen der Welt lenken mit ihren Geldtransfers und den Waffenlieferungen und den an den Haaren herbeigezogenen Lügen, die zu Kriegen und damit zu noch mehr Geldflüssen führen, aber dass die Bankiers in Wahrheit ja auch an etwas glauben, das größer ist als Geld, nämlich nicht an den lieben Gott, sondern komischerweise an die Kirche, und dass die genauso hinters Licht geführt werden, auf diese Idee musste ich ja erst einmal kommen. Dass die genauso versklavt sind, dass die, die versklaven, ohne es zu wissen, zu den Versklavten werden, ist mir gekommen, als ich bei dem Automaten auf Abbruch gedrückt habe. Mit dieser Handlung habe ich meine Freiheit wieder zurückerlangt. Denn die gebe ich so schnell nicht her. Da musst du auf der Hut sein, auch bei den Zigarettenautomaten darfst du die Karte nicht reinstecken, sogar das genügt denen, um dich an sie zu binden. Immer einen Schritt voraus musst du denen sein, ja, auch auf die Fingerkuppen musst du achtgeben. Am besten immer Handschuhe tragen, wenn du, wenn es denn sein muss, bei einer Tastatur deinen Geheimcode eingibst. Die scannen sonst deine Fingerabdrücke, das ist dir hoffentlich bewusst? Solltest du keine Handschuhe dabeihaben – irgendwann wird ja auch wieder Sommer, nicht wahr –, also dann ballst du einfach deine Hand zu einer Faust und drückst mit den Knöcheln am Ende des Handrückens die Zahlenkombination rein. Das geht, habe ich gestern auch gemacht, denn nachdem ich auf Abbruch gedrückt habe, bin ich draufgekommen, dass ich ja trotzdem Geld brauche, und dann habe ich die Karte wieder hineingesteckt in den Schlitz und mit dem Knöchel den Code eingegeben. Da haben sie ihre Gesichter verzogen, draußen vor der Schiebetür, die zwei Herren in Schwarz.«
Klaus’ Monolog kam zu einem abrupten Ende. Er schaute mich fragend an. Wollte er von mir wissen, ob ich ihm folgen konnte? Der Wasserhahn in der Küche tropfte leise und in gleichmäßigen Abständen. Aus der darüber liegenden Wohnung vernahm ich das Poltern von Kinderfüßen, die rennend den Raum durchquerten. Durch das geöffnete Fenster drang das Brummen eines Linienbusses, der von der Haltestelle abfuhr. Ich spürte, wie dessen akustische Vibrationen durch die Luft bis in meine Brust drangen. Wie sie mir den Atem nahmen. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, schaute nach links und rechts, als stünde dort jemand, der mir die verborgene Bedeutung dieser Situation entschlüsseln könnte. Mittlerweile war ich mir absolut sicher, dass Klaus’ Verhalten nichts mit einem epileptischen Anfall zu tun haben konnte, dass es mehr oder weniger sogar sein genaues Gegenteil sein musste, da er während der Anfälle meist verstummte und abwesend wirkte, nun aber sehr aktiv und im Zweifel munterer erschien als noch vor wenigen Wochen.
Ich verabschiedete mich von Klaus mit einer Notlüge. Ich müsse schnell zu einer Vorlesung, die hätte ich fast vergessen. Noch nicht gehen, sagte er, ich solle hierbleiben, sonst würden sie bestimmt Verdacht schöpfen. Ich schüttelte nur den Kopf, sagte, dass es mir leidtue, drehte mich um und hielt kurz inne, um mich zu fragen, ob ich nicht doch besser bei ihm bleiben sollte. Mein Hals fühlte sich trocken an. Ich könnte um ein Glas Wasser bitten. Nochmals schüttelte ich den Kopf, wie um mir zu sagen, dass ich hier sofort raus müsse. Ich machte ein paar Schritte und schloss, ohne mich noch einmal umzudrehen, hinter mir die Tür. Klaus’ Stimme drang gedämpft durchs Schlüsselloch und den schmalen Spalt zwischen Tür und Fliesenboden. Er sprach mit sich selbst. Die Worte waren nicht verständlich. Es war ein monotoner Singsang. Darauf achtend, kein Geräusch von mir zu geben, presste ich das linke Ohr gegen das Holz.
»… haben sie ihn nicht erwischt«, murmelte er. »Hoffentlich nicht. Das war halt schon auffällig. Dass er da mitten am Tag bei mir vorbeischaut und dann nach zehn Minuten schon wieder verschwindet. Die werden dahinterkommen, ganz bestimmt, dann sind sie mir wieder einen Schritt voraus. Nicht gut wäre das, gar nicht gut. Ich muss Albert warnen, hätte ihn nicht gehen lassen sollen, er hätte nicht so schnell gehen dürfen. Das darf mir nicht nochmals passieren. Dass sie ihn auch noch erwischen, nein, das wäre schlecht, denn ich hab …«
Genug. Ich beschloss, dass ich genug gehört hatte, stieg langsam die Treppen nach unten und verließ das Gebäude in eine Welt, die ich nicht mehr kannte. Was war mit ihm geschehen? Mein Herz pumpte schnell. Ich spürte einen steigenden Druck in meinem Kopf, das Pulsieren der Adern an meinen Schläfen. Meine Hände rutschten in die Tasche, um eine Zigarette und das Feuerzeug hervorzuholen. Rauchend stand ich da, mit dem Oberkörper an die graue Hausmauer gelehnt. Was, um Himmels willen, war nur mit ihm geschehen? Ich konnte es nicht einordnen, kramte mein Mobiltelefon hervor, rief Klaus’ Mutter an. Sie hob nicht ab. Auf den Anrufbeantworter wollte ich nicht sprechen. Das konnte ich nicht. Sobald der Piepton erklang, pflegte ich stets in eine Art Mund- oder Wortstarre zu verfallen. Wenn ich aber doch sprach, kamen Sätze heraus, die keinen Sinn ergaben und kaum verständlich waren. Das wollte ich ihr ersparen. Bei Elisabeth brauchte ich es erst gar nicht zu versuchen. Sie war in der Arbeit, brachte Kindern, die noch kaum etwas verstehen, oder Jugendlichen, die gerade nichts verstehen wollen, oder Pensionisten, die leider nichts mehr verstehen können, die Bedeutung der Pinselstriche der alten Meister näher. Ich würde ihr am Abend in Ruhe den Vorfall schildern. Dann wäre da noch Klaus’ Schwester Martha. Ja, sagte ich mir, sie könnte ich anrufen. Das wäre möglich. Vielleicht weiß sie etwas über Klaus’ Zustand, das ich nicht weiß. Doch ich zögerte. Nach all den Jahren waren wir nicht miteinander warm geworden. Vor etwa einem Jahr versuchte ich ihr in einem unserer seltenen Gespräche zu verdeutlichen, dass es absolut keinen Grund gäbe, mich andauernd mit schrägen Blicken zu bedenken. Sie meinte, man werde sehen. Freilich hatte sich nichts geändert, ihr kühler Gesichtsausdruck war kühl geblieben und ich hatte nach und nach die Hoffnung aufgegeben, dass ich zu ihr durchdringen könnte. Und wofür auch?, hatte ich mich gefragt. Sie ist kaum bei ihren Eltern und wohnt weit genug von Wien entfernt, ich werde einfach damit leben müssen, dass es Menschen gibt, die mich nicht leiden können. Es kostete mich einige Überwindung, Marthas Nummer zu wählen, doch von wählen war genau genommen keine Rede. Als ich ein Kind gewesen war, hatte es noch recht lange gedauert, bis man alle Ziffern mithilfe der Wählscheibe bis an den Anschlag gedreht hatte, dazwischen konnte man es sich locker anders überlegen und den Vorgang beenden, noch bevor das Telefon auf der anderen Seite der Leitung zu klingeln begonnen hatte. Telefonieren ist heute kein Anwählen mehr, sondern zuerst ein Anwischen, gefolgt von einem Andrücken.
»Albert? Was willst du.«
»Hallo, Martha«, sagte ich, doch dann wusste ich nicht mehr weiter. Die Hand, die das Mobiltelefon hielt, zitterte.
»Hallo?«, fragte Martha. »Hast du mich unabsichtlich angerufen?«
»Nein«, stammelte ich, »nicht unabsichtlich. Es ist nur, ich …«
»Albert, sag, was du zu sagen hast, oder ich leg auf.«
Ich schluckte oder versuchte zu schlucken.
»Es geht um Klaus.«
»Sind seine Anfälle etwa stärker geworden?«, fragte sie. Ihre Stimme hatte sich verändert. Der genervte, zynische Unterton war verschwunden.
»Nein«, antwortete ich, »das ist es nicht.«
»Was dann?«
»Wenn sich das so leicht sagen ließe. Ich weiß auch nicht. Er scheint völlig verwirrt zu sein und redet sinnloses Zeug.«
»Das macht er doch sonst auch.«
»Mag sein«, sagte ich, »diesmal ist es jedenfalls anders.«
»Wie anders? Jetzt sprich doch endlich Klartext!«
»Na, er redet andauernd von Verfolgern, von irgendwelchen Priestern, die ihm an den Kragen oder an sein Geld wollen. Es klingt komplett verrückt. Als ob er ein anderer Mensch wäre. Am Anfang habe ich noch gedacht, er macht einen Witz, aber er hat nicht damit aufgehört, verstehst du?«
Es war lange still am anderen Ende der Leitung. Durch den Hörer vernahm ich das Klicken eines Feuerzeugs, ein Inhalieren und kräftiges Ausatmen.
»Das ist sicherlich eine Art Performance«, sagte Martha schließlich.
»Das glaube ich nicht«, entgegnete ich.
»Ich schon. In den Ferien hat er mir von der Performance-Klasse erzählt, da nimmt er gerade interessehalber an einem Seminar teil.«
»Das weiß ich doch«, sagte ich gereizt, »aber das hat damit nichts zu tun.«
»Bist du dir sicher?«, fragte sie. »Er hat irgendetwas von bewegten Skulpturen gesprochen, von Menschen, die in bestimmten Positionen einfrieren und verschiedenste berühmte Skulpturen nachstellen. So was in der Art. Temporäre Skulpturen hat er es genannt. Vielleicht stellt er gerade eine Figur dar und übt, oder was weiß ich. Hat er nicht in ein paar Wochen sein Diplom? Soviel ich weiß, werden kurz davor ja alle verrückt.«
Ihre Stimme war wieder ins Zynische abgerutscht. Ich dachte kurz darüber nach und fragte mich, ob sie womöglich recht hatte. Klaus hat, als wir uns kurz vor Weihnachten noch mal getroffen hatten, lange über die Erkenntnisse aus diesem Seminar erzählt. Dass es eigentlich keinen Sinn mehr mache, eine Plastik zu erschaffen, wenn sie bereits in seiner perfektionierten Form, als menschlicher Körper, vorhanden wäre, und zwar mehrere Milliarden Male über die ganze Erde verteilt. Dass wir selbst – ohne es zu wissen – das größte Kunstwerk wären. Schon von Anfang an formvollendet. Dass wir nur einfrieren bräuchten in einer bestimmten Körperhaltung und somit alles schon vorhanden wäre, dass die Haltung alles erzählen würde, die Vergangenheit des Menschen verraten und die zukünftige Entwicklung vorwegnehmen, dass alle Informationen zu jedem Zeitpunkt abrufbar wären, sobald man sich auf eine Position einlassen, sie in sich aufnehmen, sie verkörpern würde. Was, wenn Klaus sich nicht nur in Haltungen, sondern darüber hinaus auch in Charaktere hineinzuversetzen versuchte? Wenn er eine Figur, einen ganz bestimmten Typus Mensch kopiert hatte, um ihn über das Ausagieren in Form zu bringen? Was, wenn er vorhin einfach nur geübt hatte, sich in eine lebendige Sprachmaske hineinzuversetzen, um sie sozusagen an mir auszuprobieren?
»Bist du noch da?«, fragte ich.
»Nicht mehr lange«, sagte sie.
»Unter Umständen«, sagte ich, »hast du sogar recht.«
»Sag den Satz noch einmal«, sagte sie, »aber diesmal, ohne das Wort sogar zu erwähnen. Und wenn du schon dabei bist«, fügte sie hinzu, »dann kannst du auch das Unter Umständen streichen.«
»Ja, du hast recht«, sagte ich, und ich wünschte mir in diesem Augenblick, obwohl ich es nur ungern zugeben wollte, nichts anderes. Martha sollte recht haben. Was sie sagte, sollte stimmen. Sie soll doch die Wahrheit sagen. Bitte. Ich bitte darum. Ich bitte darum, damit ich daran glauben kann. Ich hörte sie noch etwas sagen, doch da ich das Mobiltelefon nicht mehr zum Ohr hielt, war das Gesagte kaum verständlich. Es interessierte mich auch nicht. Ich hatte gehört, was ich hören wollte. Alles war in Ordnung. Ich würgte Martha ab, indem ich, nicht ohne eine gewisse Befriedigung zu verspüren, den linken Daumen aufs rote Symbol drückte, sie wegwischte, sie abwählte. Der Lärm der Stadt kehrte zurück in mein Bewusstsein. Ja, alles war in Ordnung. Der Linienbus fuhr in die Haltestelle ein. Die Türen öffneten sich surrend. Ich stieg ein. Es piepste. Die Türen schlossen sich. Die Gummidichtungen quietschten. Ich hielt mich an einer gelben Schlaufe fest. Der Bus fuhr mit einem Ruck los. Morgen würde ich wieder bei Klaus vorbeischauen. Denn alles war in bester Ordnung.