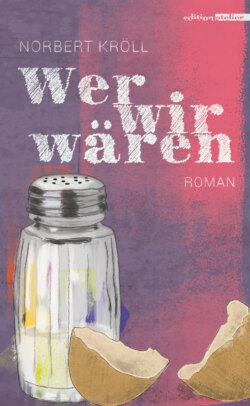Читать книгу Wer wir wären - Norbert Kröll - Страница 9
VIER
ОглавлениеIch kannte Klaus seit knapp einem Jahr, als eine Einladung zu seiner Geburtstagsparty im Posteingang meines Mailprogramms erschien. Er hatte in den letzten Wochen schon mehrmals davon gesprochen. Es würde die Party des Jahres werden, scherzte er. Und damit mochte er recht haben, aber ich hatte gerade keine Lust auf Menschen, das heißt: Menschen zu sehen, mit Menschen zu reden, Menschen kennenzulernen. Natürlich wusste Klaus Bescheid. Ich hatte ihn noch am selben Tag davon in Kenntnis gesetzt, was mit meinem Bruder geschehen war, und er hatte mir – so gut es telefonisch möglich war – beigestanden, wobei es nicht darum ging, mir beizustehen, ich sollte Leander beistehen, so sollte es sein, aber wie kann man einem Menschen helfen, wenn man selbst nicht weiß, wie diese Situation am besten anzupacken ist? Andererseits war es nicht so, dass es Leander besser ging, wenn ich ihm die ganze Nacht lang die Händchen hielt. Das machte ohnehin schon meine Mutter. Außerdem war er mit seinen neunzehn Jahren alt genug, selbst zu schlafen, er war ja auch alt genug, sich selbst zu töten oder es zumindest zu versuchen. Trotz alledem, sagte ich mir, wäre es wohl nicht angebracht zu feiern. Gleichzeitig ärgerte es mich, dass Leander mit seiner lächerlichen Tat in den Ablauf meines Lebens eingriff, auch wenn es sich bloß um so etwas Unbedeutendes wie eine Geburtstagsparty handelte. Ich stand nicht an seiner Seite, wenn er etwas zu feiern hatte, warum sollte ich dann an seiner Seite stehen, wenn es ihm schlecht ging? Wann hatte er mich das letzte Mal angerufen? Wann ich ihn?
Es war früher Nachmittag, als ich Klaus anrief, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Er sprach nicht viel, was ich aber zwischen seinen Worten wahrnahm, sagte mir etwas, das nur ohne Worte zu sagen war. Klar würde er sich sehr freuen, wenn ich zu seiner Feier käme. Er fragte mich nicht, und gerade weil er mich nicht drängte, verspürte ich den Drang, ihm diese Freude zu bereiten. Wir waren inzwischen so etwas wie beste Freunde, auch wenn wir diesen Ausdruck niemals in den Mund genommen hatten. Wir wussten es. Das genügte.
So kam es, dass ich wenige Stunden später tatsächlich vor Klaus’ Wohnungstür stand, in meinen nervös zittrigen Händen ein in Zeitungspapier eingewickelter Roman, der, so fand ich, bereits viel zu lange ungelesen in Vaters altem Musikzimmer gestanden hatte: Sanfter Asphalt. Ich kannte das Buch nicht und hatte daher keine Ahnung, ob es gut war. Laut Mutter hatte es kurz vor Vaters Tod den Weg in sein Bücherregal gefunden. Grund genug, so dachte ich, um anzunehmen, dass es einer gewissen literarischen Anforderung entsprach. Man konnte sich, so hatte ich es mir gerne vorgestellt, Vaters Bücherregal wie einen Filter vorstellen, der für ihn Unbrauchbares sofort wieder ausspuckte. Insgeheim war Vater darauf stolz gewesen, auf die Auswahl seiner Bücher und nicht minder auf die klassische Musiksammlung. Schade, dass er sie nicht mitnehmen konnte. An Klaus’ Tür stehend fragte ich mich, ob dieses Buch, wenn mein Vater es denn gelesen hätte, einen fixen Platz in seinem Regal bekommen hätte, um mit der Zeit den Staub des Alltags aufzunehmen, oder, wie so viele andere Romane auch, dem ungewissen Schicksal eines öffentlichen Bücherschranks übergeben worden wäre. Vielleicht würde es mir Klaus beantworten können. Ich klopfte an die Tür, drehte das Buch in meinen Händen und las auf der Verpackung die Schlagzeilen des gestrigen Tages. Jemand hatte jemanden aus Eifersucht erstochen. Ich hätte eine andere Doppelseite zum Einwickeln verwenden sollen. Nun war es zu spät. Klaus würde es hinnehmen müssen. Bevor ich noch länger darüber nachdenken konnte, rief jemand von innen, dass die Tür offen sei. Ich schaute an mir hinab. Täuschte ich mich oder war mein Bauch etwas runder, größer geworden? Mit der Handfläche strich ich das T-Shirt glatt. Es bewirkte nichts. Ich trat ein.
Die Party war, wie man so schön sagt, bereits in vollem Gange. Durch die Tür sah ich ins Wohnzimmer. Klaus stand dort mit dem Rücken zu mir und unterhielt sich lebhaft mit einem seiner Studienkollegen, den ich von der Diplompräsentation her kannte. Aus den Boxen drang ein monotoner, treibender Beat. Ich betrat den Raum, nickte einigen Leuten zu, die ich vom Sehen her kannte und tippte Klaus auf die Schulter. Er drehte sich um. So sah Klaus aus, wenn er sich freute. Genau deshalb war ich gekommen. Bei diesem Anblick war es schwer vorstellbar, dass einem nicht das Herz aufging. Dann hörte er auf, sich zu freuen, schaute mich mitfühlend an und umarmte mich lange.
»Alles Gute«, flüsterte ich in sein Ohr.
»Es wird schon wieder«, sagte er.
»Schon möglich«, sagte ich, »es ist mir einerlei.«
»Komm schon«, meinte er, »lass uns heut Abend nicht negativ denken, okay?«
»Okay.«
Wir lösten uns aus unserer Umarmung und schauten einander an.
»Okay?«, fragte er abermals, da er in meinen Augen den Rest eines Zweifels entdeckt haben mochte.
»Ja doch«, sagte ich und versuchte zu lächeln. »Lass uns feiern!«
Der Studienkollege hatte sich inzwischen einem anderen Gesprächspartner zugewandt. Ich überreichte Klaus das Geschenk. Er bedankte sich, las die Schlagzeile der Zeitung, lachte und fragte mich, ob dies Rückschlüsse auf den Inhalt zulasse. Ich zuckte mit den Schultern. Er riss das Zeitungspapier in zwei Hälften, sagte, dass er den Autor nicht kenne und fragte mich, woher ich es habe.
»Aus dem Shop im Wien Museum«, log ich. »Keine Ahnung, wie es ist. Ehrlich gesagt habe ich es wegen der Fotos gekauft, die darin sind. Schau mal rein.«
Er öffnete das Buch, las die Widmung, die ich ihm auf die erste Seite geschrieben hatte, und umarmte mich gleich nochmals. Dann erst blätterte er durchs Buch.
»Es kommen keine Menschen auf den Fotografien vor«, sagte er.
»Vielleicht kann der Autor sie nicht ausstehen«, witzelte ich.
»Vielleicht«, meinte Klaus. »Oder es könnte genau andersrum sein.«
»Möglich«, sagte ich. »Oder er hat die Fotos reingetan, damit er nicht so viel schreiben musste.«
Klaus schmunzelte, las die ersten paar Zeilen und bewegte dabei stumm seine Lippen.
»Es wird den vordersten Platz in meinem Regal für die zu lesenden Bücher bekommen«, sagte er. »Komm, hol dir was zu trinken. Bier und Weißwein schwimmen im kalten Wasser in der Badewanne. Die guten Getränke befinden sich im Kühlschrank.«
»Die guten?«, fragte ich.
»Du weißt schon, Gin, Pernod, so Zeugs halt.«
»Wenn das so ist«, sagte ich, »dann findest du mich nebenan.«
Ein Pärchen stand hinter mir und wartete darauf, Klaus zu gratulieren. Ich grüßte sie und ging in die Küche. Die Musik schwappte etwas gedämpft vom Wohnzimmer durch die Tür. Das Licht war gedimmt, ich fühlte mich das erste Mal seit ein paar Tagen wohl in meiner Haut und dachte tatsächlich nicht an Leander, dachte nicht daran, was für ein Idiot er war, dass er es einfach nicht lassen konnte, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass sich nichts geändert hatte.
Eine junge Frau öffnete den Kühlschrank und griff mit der linken Hand nach einer Gin- und mit der rechten nach einer Tonic-Flasche, zog sie aus dem Regal und stellte sie unsanft auf dem Küchentisch ab. Etwas an ihrer Erscheinung – oder war es die Art, wie sie sich bewegte? – sprach mich an. Sie hatte kurze braune Haare, dunkle, von einer dünnen Brille umrahmte Augen und markante, fast männlich konnotierte Gesichtszüge. Sie trug ausgewaschene Jeans-Shorts und ein bauchfreies Top, wie es zurzeit wieder in Mode war. Aber es war nicht nur ihr Aussehen, das mich innehalten ließ. Vor mir stand ein Mensch, dachte ich, der sich sicher war. Woran ich das zu erkennen glaubte? An ihrer Art, sich aufzurichten, an der Art, wie sie das Glas vor sich abstellte, die Flaschen aufschraubte, die Flüssigkeiten vermischte. Ein Mensch, der wusste, wer er war und was er tat und warum. Von dieser Sorte gab es nicht viele. Klaus mag einer davon gewesen sein. Mich zählte ich jedenfalls nicht dazu. Vielleicht hielt ich mich deshalb gerne in der Nähe solcher Menschen auf, damit etwas von ihren Qualitäten auf mich abfärbte. Was ich wusste, war Folgendes: Ich wollte diese Frau kennenlernen und einen Gin Tonic trinken. Beides befand sich zwei Meter vor mir.
Beim Sprechen vergaß ich, wer ich war, woher ich gekommen war, wohin ich gehen wollte, was gestern passiert war und was morgen zu erledigen wäre. Da war nur noch das Sprechen, das Erzählen, das Sich-Mitteilen. Es funktionierte aber nur, wenn auf der anderen Seite jemand stand, der die Gabe hatte, zuzuhören, still dazusitzen, von Zeit zu Zeit zu nicken und im richtigen Augenblick gezielte Fragen zu stellen. Es funktionierte nur, wenn man im Gesicht des Gegenübers eine Teilnahme wahrnahm, ein Sich-Hingeben und Fallenlassen, wenn die Augen des Zuhörenden zwei große leere Becken waren, die derjenige, der den Mund öffnete, mit seiner Flut an Sätzen, mit seinen Geschichten, Erlebnissen und Sorgen füllen konnte.
Nun hatte ich also, obwohl ich mir vorgenommen hatte, Leanders Tat an diesem Abend auszuklammern, doch über ihn gesprochen. Meine halbe Lebensgeschichte, und damit in einigen Nebensätzen auch die meines Bruders, habe ich dieser Frau in groben Zügen nähergebracht. Gerade war ich dabei, ihr zu erzählen, dass ich womöglich zu wenig für ihn dagewesen war und dadurch nichts von seinem Vorhaben mitbekommen habe, dass die Schuld sicherlich auch …
»Die Schuld?«, unterbrach sie mich.
»Ja, die … äh, ja, das hat vielleicht auch mit mir …«
»Du glaubst doch nicht im Ernst«, hakte sie nach, »dass du für die Tat deines Bruders verantwortlich bist?«
»Na ja«, stammelte ich, führte das Getränk zum Mund und sog am Röhrchen, um etwas Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. »So zugespitzt würde ich es nicht formulieren. Er war mir immer … irgendwie war er mir immer … na gut, die Wahrheit ist: Er war mir egal. Ziemlich egal. Manchmal sogar scheißegal. Ich schätze, dass das einen Menschen beeinflusst, oder etwa nicht?« Ich wunderte mich, dass ich einem fremden Menschen gegenüber so offen über meine Familienangelegenheiten sprach und schob den Umstand auf den Alkoholspiegel, als sie mich fragte, wie alt Leander sei.
»Neunzehn«, sagte ich, »warum?«
»Glaubst du nicht, dass er, sofern er nicht unter Drogeneinfluss stand, wusste, was er tat?«
»Wahrscheinlich«, sagte ich. »Die Vergangenheit funkt halt rein, die kann man nicht so rausnehmen, oder? Wir sind doch das Produkt unserer Erfahrungen. Und wenn keine Verbindung mit dem Bruder existiert, ist das auch ein Eindruck, der sich einschreibt. Aber egal, es war falsch von ihm.«
»Ja?«
»Natürlich«, gab ich zu verstehen. »Man kann doch nicht einfach … es kann doch nicht jeder, der Lust hat, seinem Leben ein Ende zu bereiten, dieses Vorhaben in die Tat umsetzen.«
»Man kann«, sagte sie. »Es wäre schade, das steht außer Zweifel, aber man kann.«
»Wie kannst du das so sagen?«
»Weil ich aus Erfahrung spreche«, sagte sie. »Ich hatte es nicht leicht in meiner Kindheit, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Was ich sagen will, ist, dass man einem Erwachsenen durchaus freistellen kann, diesen Schritt zu wagen. In hundert Jahren wird, zumindest in unserer Gegend, niemand mehr daran zweifeln.«
»Also ich weiß nicht«, sagte ich.
»Dann halt in fünfhundert oder in tausend Jahren. Es wird passieren.«
Die Bestimmtheit, mit der sie ihre Aussagen tätigte, schüchterte mich ein und imponierte mir zur selben Zeit. Sie hat eine Meinung, dachte ich, das muss man ihr lassen. Mit gekreuzten Beinen saß sie am Küchentisch, den linken Fuß an der Lehne eines Stuhls abgestützt. Sie sog den letzten Rest des Mischgetränks in ihren Mund und schüttelte das Glas, sodass die Überbleibsel der Eiswürfel gegen den Rand klimperten. Sie erhob sich, ging zum Kühlschrank und mischte sich ein neues Getränk. Meine Aufmerksamkeit legte sich auf ihren halb entblößten Rücken. Die Wirbel, über die sich ihre Haut spannte, waren deutlich zu erkennen. Noch einen? Wie bitte? Ob ich auch noch einen wolle? Ein kurzer Blick auf mein Glas verriet mir, dass es so gut wie leer war. Ich zeigte es ihr und nickte. Wir hatten unsere Gläser, seit wir die ersten vorsichtigen Worte miteinander ausgetauscht hatten, bereits dreimal gefüllt und waren nun beim Pernod angekommen.
»Und die Schuld«, fuhr sie fort, nachdem sie wieder auf dem Tisch Platz genommen hatte, »dieses Wort, ich mag es nicht. Warum sprichst du nicht von Verantwortung?«
Ich hoffte, dass dies bloß eine rhetorische Frage gewesen war, und wartete darauf, dass sie weitersprach, was sie dann zum Glück auch tat.
»Jeder Erwachsene«, sagte sie, wenn ich mich nicht täuschte, bereits leicht lallend, »sollte sich selbst gegenüber Verantwortung tragen. Bei Kindern ist das klarerweise etwas anderes. Aber bei einem Erwachsenen? Das heißt natürlich nicht«, fügte sie mit erhobenem Zeigefinger hinzu, »dass man ihnen keine Hilfe anbieten sollte. Ich selbst habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen. In hundert Jahren – ich weiß, ich wiederhole mich –, aber in hundert oder in fünfhundert oder meinetwegen in tausend Jahren wird es völlig normal sein. Ach was, es sollte jetzt schon normal sein! Ich denke nämlich, dass es als Freund, Freundin oder Bruder, als Eltern oder als Geschwister und so weiter, ich denke, dass es da Grenzen gibt. Natürlich können wir jemandem, der Probleme mit der Bewältigung seines Lebens hat, beistehen, aber das geht meiner Ansicht nach nur bis zu einem gewissen Grad und nicht weiter. Denn sei mal ehrlich, welches Kind, auch wenn es erwachsen ist, hört schon auf seine Eltern?«
»Also ich höre auf meine Mutter«, sagte ich und fügte ein unsicheres Manchmal hinzu.
»Dann sind deine Eltern eine Ausnahme. Dann bist du eine Ausnahme.«
»Ich sagte nicht, ich höre auf meine Eltern, sondern ich höre auf meine Mutter. Mein Vater spricht nicht mehr.«
»Warum nicht?«
»Weil er damit beschäftigt ist, drei Meter unter der Erde zu liegen und zu verfaulen.«
Sie lachte. Dann hörte sie auf zu lachen.
»Schon in Ordnung«, sagte ich. »Er ist gestorben. Das passiert manchmal bei älteren Menschen, weißt du?«
In ihr Gesicht hatte sich Verwunderung gelegt, sie schüttelte den Kopf, wie um etwas loszuwerden, und schien nachzudenken. Und ich schaute ihr beim Denken zu.
»Aber was«, fragte ich schließlich, »wenn es sich umgekehrt verhält? Was, wenn du eine Ausnahme darstellst?«
Ich hätte gerne gewusst, was es mit ihrer Familie auf sich hatte, spürte aber, dass es nicht der richtige Moment war, um danach zu fragen. Im Grunde wollte ich gar nicht mehr reden. Ich wollte, ja, ich wusste längst, was ich wollte …
In diesem Moment betrat Klaus pfeifend und sichtlich gut gelaunt die Küche, in der es mittlerweile ziemlich eng und heiß geworden war.
»Ah«, sagte er, »und du bist?«
»Du kennst sie nicht?«, fragte ich. Klaus schüttelte den Kopf. »Das ist …« Da wurde mir bewusst, dass ich sie noch nicht nach ihrem Namen gefragt hatte.
»Ich bin Elisabeth«, sagte sie und streckte Klaus die rechte Hand entgegen. »Anna hat gemeint, dass es kein Problem wäre, wenn ich mitkomme. Ich nehme an, du bist das Geburtstagskind? Gratuliere!«
»Danke«, sagte Klaus und schüttelte ihre Hand. »Sie ist fein.«
»Wer?«, fragte sie. »Anna?«
»Nicht wer«, sagte Klaus grinsend, »sondern was! Ich meine deine Hand. Es fühlt sich gut an, sie zu halten.«
Ich bildete mir ein, dass Elisabeth rote Wangen bekam, wobei es durchaus auch von der in diesem kleinen Raum stehenden feuchten Hitze herrühren konnte.
»Das ist eine ungewöhnliche Aussage«, meinte sie. »Ich nehme an, dass ich mich bedanken kann?«
»Es war nicht als Kompliment, sondern als Feststellung gemeint«, sagte Klaus trocken. »Aber natürlich kannst du dich bedanken. Nur vergiss bitte nicht: Es fühlt sich ebenso gut an, über die papierne Haut der Hände von alten Menschen zu fahren.«
»Aha«, machte sie. »Dann werde ich mich vielleicht doch nicht bedanken.«
»Wie du meinst«, sagte Klaus und ließ ihre Hand los. »Es ändert nichts daran, dass es so ist.«
Elisabeth schien sich nicht sicher zu sein, wie sie darauf reagieren sollte, und schaute mich hilfesuchend an.
»Und du, Albert?«, fragte er. »Fühlst du dich wohl?«
»Ja«, sagte ich, »sehr sogar.«
»Das freut mich«, sagte er, und zu Elisabeth gerichtet fügte er hinzu: »In einer anderen Welt würdet ihr gut zueinander passen, denn auch Albert hat eine weiche Haut. Schau doch!« Er nahm meine Hand und strich mir mit den Fingerkuppen über den Handrücken. An meinen Unterarmen stellten sich die Haare auf. Ich hoffte, dass Elisabeth es nicht gesehen hatte, und fragte mich gleichzeitig, was so schlimm daran gewesen wäre. Behutsam legte Klaus meine Hand auf Elisabeths nackten Oberschenkel, dann prostete er mir zu und schlenderte weiter ins ebenso gefüllte Schlafzimmer, wo er mit einem Happy Birthday empfangen wurde. Ich fühlte nach Elisabeths Haut. Klaus hatte absolut recht, es tat gut, sie zu berühren.
»Also das ist vielleicht ein schräger Typ«, sagte Elisabeth und deutete mit dem Daumen ins Schlafzimmer.
»Schräg«, sagte ich, »ja, das ist er. Im nicht betrunkenen Zustand ist er nicht ganz so … nun ja, er ist jedenfalls anders.« Ich überlegte fieberhaft, was ich mit meiner Hand anstellen sollte, fand aber keine befriedigende Lösung. Sie dort noch länger zu belassen, wäre komisch, sie wegzunehmen vielleicht ebenso.
»Aber was hat er mit in einer anderen Welt gemeint?«, fragte sie.
»Keine Ahnung«, sagte ich, »er redet oft verrücktes Zeug. Vielleicht habe ich ihn deshalb so gern.«
»Ach so«, sagte sie, »jetzt verstehe ich! Ihr beide seid …«
»Wie?«, schoss es aus mir hervor. »Nein, das hast du falsch verstanden!« Ohne dass ich es bewusst gewollt hätte, nahm ich die verschwitzte Hand von ihrem Oberschenkel. »Wir sind nicht«, stammelte ich, »wir sind nur … also wie soll ich das sagen?« Und da sprach ich es das erste Mal laut aus: »Er ist mein allerbester Freund, nichts weiter.«
»Ach so«, sagte sie, »na dann.«
»Na dann«, wiederholte ich, verspürte den Drang, etwas zu unternehmen, aber verharrte, als wäre ich plötzlich gelähmt, in meinen Bewegungen. Wir saßen nebeneinander, schauten eine Zeit lang geradeaus und sagten nichts. Ich fühlte mich peinlich berührt und fragte mich weshalb. Es gab nichts, sagte ich mir, wofür ich mich schämen müsste. Etwas knackte in meiner rechten Schulter. Ich interpretierte es als willkommenes Zeichen, nahm einen kräftigen Schluck vom Getränk, dann noch einen, und da ich nach wie vor zu wenig Mut für den nächsten entscheidenden Schritt in mir finden konnte, nahm ich noch einen allerletzten Schluck und dann, weil noch einer da war, noch einen. Nachdem ich das Glas geleert hatte, wendete ich meinen Oberkörper und mein Gesicht zu Elisabeth und sagte: »In Wahrheit fühle ich mich von Frauen angezogen, die … die kurze braune Haare haben. Und dunkle Augen. Und genauso eine Brille tragen, wie du sie auf deiner Nase sitzen hast.« Da sie nicht reagierte und ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, sprach ich weiter: »Und im Speziellen stehe ich auf Frauen, die sich am Oberschenkel so anfühlen, wie du dich anfühlst und die genauso eine Stimme haben wie du …« Sie führte ihre Handfläche zu meinem Mund. Sie schaute mich an. Es fühlte sich an, als würde sie mich etwas fragen, auf das ich keine Antwort wüsste, während ich in ihrem Gesicht nichts anderes als unlösbare Rätsel zu erkennen glaubte. Ein paar Sekunden später nahm sie die Hand von meinem Mund, wandte den Blick ab, richtete ihn auf ihr Getränk und trommelte mit den Fingernägeln gegen das Glas.
»Komm mit«, sagte sie auf einmal und schwang sich locker vom Tisch.
»Wohin?«
Sie lächelte mich an.
»Komm einfach mit.«
Sie streckte ihre Hand nach mir aus. Ich ergriff sie und folgte ihr ins Wohnzimmer. Der Pegel der Musik war inzwischen merklich angestiegen, die Bässe versetzten meinen Brustkorb sanft in Schwingung. Mein Herz, das spürte ich, schlug deutlich schneller als der Beat. Und wir tanzten, ohne uns zu berühren. Und wir tanzten und berührten uns. Und wir berührten uns, ohne zu tanzen.