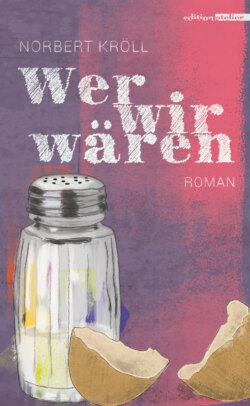Читать книгу Wer wir wären - Norbert Kröll - Страница 8
DREI
ОглавлениеIch dachte immer, Oberkärnten sei der obere, also nördliche Teil Kärntens, aber dem ist nicht so. In Kärnten ist oben der Westen. Dorthin hat mich Klaus eingeladen. Es war Karfreitag. Vor zwei Tagen war ich angekommen und hatte auch gleich seine Eltern kennengelernt. Seine Mutter hatte mich, als würden wir uns schon seit Jahren kennen, mit einer herzlichen Umarmung empfangen. Ich fragte mich, ob durch sie die Kärntner Seele, die bekanntlich etwas gemütlicher ist als die der anderen Bundesländer, besonders stark durchschien. Klaus’ Vater war ebenso entspannt, jedoch in einer nach innen gerichteten, passiven Form. Während eines Gesprächs nickte oder brummte er von Zeit zu Zeit, um zu signalisieren, dass er gedanklich anwesend war, aber er sprach nicht viel. Auch nickte er gerne ein, vormittags, dann kurz nach dem Mittagessen und noch einmal am Nachmittag, stets mit einem angedeuteten Lächeln auf den Lippen, während in angenehmer Lautstärke das Programm von Ö1 aus den alten Stereoboxen plätscherte. Dieser Mann hatte etwas von einem schweigenden, tief in seine Gedanken versunkenen Mönch, bis er dann doch etwas sagte, mit einem Satz herausfuhr aus seiner scheinbaren Abwesenheit und damit nicht selten so manches auf den Punkt brachte, worüber zuvor lang und breit diskutiert worden war. Ein kommunistischer Nazi, hatte er zum Beispiel gerufen, als wir über die Karrierelaufbahn eines bestimmten Politikers zu sprechen kamen, oder, als es um eine Sportlerin ging: Die kapiert nichts, und sie hat nie was kapiert und wird niemals was kapieren, und nach einer kurzen Pause: Deshalb ist sie so verdammt gut, oder, als es um einen Firmengründer ging: Ein Verlierer, der weiß, wie man gewinnt. Manchmal zankten sich Klaus’ Eltern, wobei es eher wie ein Schauspiel wirkte; jemand brachte den Stein ins Rollen, indem ein Triggerwort, von dem ich nichts wissen konnte, ausgesprochen wurde, woraufhin sofort mit einer Wortsalve reagiert wurde, die wiederum aufgefangen, durchgekaut und abermals zurückgeworfen wurde, und so weiter und so fort. Ein Ballspiel mit Andeutungen und Vorwürfen, die sich einem Nichteingeweihten entzogen, man konnte nur den Kopf nach links und rechts wenden und die wundersame Mechanik einer jahrzehntelang funktionierenden Ehe bestaunen. Kurzum, in dieser Familie war ich gerne Gast, denn sie lebte und gab mir das Gefühl, eine Bereicherung zu sein, anstatt eine Last, für die man zusätzlich kochen und putzen und Betten beziehen musste.
Am frühen Samstagnachmittag, kurz vor dem Osterschmaus, den mir Klaus als Herzstück aller Festessen angepriesen hatte, traf Martha ein. Seit einigen Jahren arbeitete sie in München in einem kleinen, aufstrebenden Architekturbüro. Klaus hatte nicht oft von seiner Schwester gesprochen und ich hatte selten nach ihr gefragt. Sie sei etwas eigen, hatte Klaus kurz vor ihrer Ankunft wiederholt angemerkt, sie tätige oftmals Aussagen, die sie eigentlich nicht so meine. Er sagte voraus, dass sie schwarz gekleidet sein würde, dass sie immer schwarze Kleidung trage, um, so scherzte er, dem Klischee der jungen, erfolgreichen Architektin zu entsprechen. Sie arbeite viel und sei deshalb, na ja, nervlich beansprucht. Ihr Büro habe einige wichtige Aufträge an Land gezogen und hinke nun mit den Planungen hinterher, ergänzte Klaus’ Mutter. Aber ich solle mir keine Sorgen machen, sagte Klaus und legte eine Hand auf meine Schulter, es werde schon gutgehen. Ich wollte ihn fragen, was er damit meinte, aber schon öffnete sich die Tür zum Wohnzimmer und herein kam eine schlanke, gutaussehende Frau in einem schwarzen Hosenanzug, die ihre Eltern und ihren Bruder begrüßte und ihnen frohe Ostern wünschte und mir zu guter Letzt die Hand entgegenstreckte, wobei es den Anschein hatte, dass ihr diese Geste einige Mühe abverlangte.
»Albert, nehme ich an? Klaus hat dich erwähnt.«
»Das ist mein Name«, sagte ich und schüttelte ihre Hand. Ihr Griff war fest, die Haut selbst aber weich. »Schön, dich kennenzulernen.«
»Ob es schön ist, werden wir noch sehen«, sagte sie.
»Martha!«, rief Klaus’ Mutter ermahnend in ihre Richtung.
»Also gut, dann frohe Ostern, liebster Albert.«
Marthas Blick fühlte sich an, als würde man unter einem Röntgengerät liegen. Ich fragte mich, wonach sie in mir suchte. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit von meinem Scheitel bis zu den Zehenspitzen, als wenn sie ein Gebäude nach seiner Brauchbarkeit, der Beschaffenheit der Fassade und seiner generellen statischen Traglast überprüfen müsste. Hatte ich schon in der ersten Minute etwas Unpassendes gesagt, etwas Falsches getan?
»Ich habe einen Mordshunger, können wir nun endlich essen?«, fragte Martha, nachdem sie den Röntgenvorgang abgeschlossen hatte oder es ihr zu langweilig geworden war, mich länger zu durchleuchten.
»Alles gut«, flüsterte Klaus mir ins Ohr, »alles gut.«
Der Osterschmaus war all das, was mir Klaus versprochen hatte, und mehr noch. Vorzüglicher Schinken, verschiedenste Wurst- und Käsesorten, Eier, fein aufgefächerte Zunge, reichlich frisch geriebener, scharfer Kren und natürlich der berühmte Kärntner Reindling, der bei diesem Fest, so habe ich zumindest gehört, nicht fehlen darf. Während des Essens versuchte ich, nicht zu Martha zu schauen, meine Blicke streiften vom Ei zum Schinken, zum Kren, zum Reindling und wieder zurück zum Anfang. Den Geschmack wollte ich mir nicht verderben lassen. Ablenkung tötet die Wahrnehmung. Das Lesen eines Zeitungsartikels während des Frühstücks? Fünfzehn Minuten später ist das Frühstück weg, und ich weiß nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Die Buchstaben des Artikels jedoch liegen mir quer im Magen, als ob ich sie gegessen hätte, die Ertrunkenen im Mittelmeer, die Terroristen in Syrien, die Erdbeben in Japan, die Vergewaltigungen in Indien, die Messerstecherei am Praterstern, die Aussagen der populistischen Politiker, der Verriss einer neuen Ausstellung. Da empfiehlt es sich, besser an nichts zu denken, mit niemandem zu sprechen und niemanden anzuschauen, den man nicht sympathisch findet. Ob alles in Ordnung sei, fragte Klaus’ Mutter mehrmals. Aber ja doch, alles bestens. Und das war es auch. Klaus lachte viel. Und sogar sein Vater zeigte eine Lebendigkeit, wie ich sie in den letzten Tagen nicht an ihm beobachtet hatte. Er erzählte skurrile Geschichten aus seiner Kindheit und Jugend und hörte nicht auf, von seinen Erfahrungen beim Grundwehrdienst zu sprechen, wie er beim Zerlegen und Zusammenbauen seines StG 77 Sturmgewehrs der Langsamste gewesen war, beim Schießen der Schlechteste, wie er die sogenannten Feinde bei einer Truppenübung in Allentsteig mit seiner Kompanie erledigen hätte sollen, aber stattdessen alleine in einem Versteck hinter dicht wachsenden Büschen gelegen war und mit einem nahe vorbeiziehenden Wolfsrudel Kontakt aufgenommen hatte, indem er ihnen getrocknetes Fleisch zuwarf und durchs Fernglas beobachtete, wie sie sich verhielten. Ich hörte zu, genoss das Beisammensein. Aber dann, als ich das letzte mit Kren befüllte Schinkenblatt in den Mund steckte und auf das angenehme Prickeln und Stechen im Gehirn wartete, schaute ich doch zu Martha, die am Kopfende des Tisches saß und stumm kauend eine Scheibe Reindling mit Butter beschmierte. Sie hatte die ganze Zeit über kaum etwas gesagt. Manchmal hatte sie, so erschien es mir, pflichtbewusst gelacht. Ob es echt war, bezweifelte ich. Ich fragte mich, was an ihr überhaupt echt war. Diese makellose, helle, fast schon blattweiße, und ungemein glatt wirkende Haut? Ihre grünen Augen und das dunkle, dichte Haar? Die Haut könnte behandelt sein, mit Make-up zu dem gemacht, was sie war, die Iris von smaragdgrünen Linsen verdeckt, die Haare schwarz gefärbt. Ihr wahrer Charakter, wenn es denn so etwas neben dem normalen überhaupt gibt, könnte ein völlig anderer gewesen sein, ich tippte auf etwas Filigranes im Inneren, das durch einen emotionalen Panzer geschützt werden musste, damit es nicht ohne Vorwarnung bei der ersten Berührung herausquillt und an der Fülle von Eindrücken zerbricht. Ohne dass ich es wollte, musste Mitleid in meinen Blick geraten sein oder eine heruntergekochte, verdünnte Art davon.
»Was gibt es denn zu glotzen?«, fragte sie. »Gefallen dir meine Brüste, hm?«
»Ich habe nicht …«, stammelte ich. »Ich habe nur …«
»Du hast wohl nur zu ihr hingeschaut, weil sie ihren Reindling mit Butter bestrichen hat, habe ich recht?«, fragte Klaus’ Mutter. »Das machen wir hier so, es schmeckt sehr gut, probier es ruhig mal aus.«
»Lass dich nicht von Martha verunsichern«, sagte Klaus. »Sie ist es nämlich, die unsicher ist, deshalb muss sie aggressiv sein.«
»Ich bin nicht aggressiv«, sagte Martha. »Aber wenn mir etwas Komisches auffällt, dann mach ich meinen Mund auf. Und Unsicherheit, mein liebes Bruderherz, lese ich aus deinen Kunstwerken heraus. Du hast wohl noch nicht deinen Stil gefunden, wie?«
»Ich habe kein Problem mit Unsicherheit«, sagte Klaus. »Es stimmt, ich habe meinen Stil noch nicht gefunden, und wer weiß, vielleicht finde ich ihn nie, aber das macht nichts, dann suche ich eben mein ganzes Leben danach und bin unsicher dabei und verleihe diesem Zustand Ausdruck, anstatt es unter eine Decke zu kehren.«
»Du solltest Philosophie studieren, wenn du so gescheit bist.«
»Das mache ich ja zum Teil. In einer Ästhetik-Vorlesung habe ich Albert kennengelernt.« Er drehte mir den Kopf zu und legte eine Hand auf meine Schulter.
»Wie schön für euch«, sagte Martha.
»Es gibt nichts, was daran nicht schön sein sollte«, sagte Klaus’ Vater, befreite ein Ei von seiner dunkelroten Schale, streute Salz darauf und steckte es als Ganzes in den Mund.
»Muss das sein?«, fragte Klaus’ Mutter. Er nickte und machte mit der rechten Hand eine kreisende Bewegung über seinem Bauch. »Es tut mir leid, Albert.«
»Dir muss nichts leidtun«, sagte Martha zu ihrer Mutter. »Das Leidtun gehört ins vorige Jahrtausend. Papa soll tun, was er tun will, und du tust, was du für richtig hältst. Niemand ist für den anderen verantwortlich. Nicht mehr.«
»Das hast du schön gesagt«, meinte Klaus. »Dir wird doch nicht noch das Herz aufgehen bei so viel Empathie?«
»Damit hat das nichts zu tun«, entgegnete sie. »Es geht darum, dass wir Frauen lange genug nett und brav sein und uns entschuldigen mussten. Für die eigenen Handlungen. Für den Mann. Für die Familie. Für die Gesellschaft. Das ist jetzt vorbei.«
»Und der heilige Gral am Ende des Weges ist gefüllt mit Unfreundlichkeit und Zynismus?«, fragte Klaus.
»Welcher heilige Gral? Bist du unter die Priester gegangen?«
»Nein, das nicht.«
»Abgesehen davon hast du, was Frauen betrifft, deinen Mund zu halten. Da kannst du so schwul sein, wie du willst.«
»Bitte«, sagte ihre Mutter, »jetzt beruhigen wir uns wieder. Wir haben schließlich einen Gast bei uns.«
»Und für ihn soll ich mich verstellen?«, fragte Martha.
»Du sollst dich nicht verstellen, aber wenn du etwas netter wärst, würde es dir selbst auch nicht schaden, da hat Klaus schon recht.«
»Ach, jetzt bin ich wieder die Böse, klar! Ihr habt ja keine Ahnung.«
»Von was haben wir keine Ahnung?«, fragte ihr Vater.
»Dass es … das das Leben halt nicht leicht ist, wenn …«
»Wenn man unbedingt bis ganz nach oben will?«, fragte Klaus. Seine Mutter bedachte ihn mit einem strengen Blick. »Sorry«, fügte er hinzu. »Also, liebe Martha, was wolltest du uns mitteilen?«
»Dir wollte ich mitteilen, dass ich hoffe, dass du keinen Erfolg hast mit deiner Kunst.«
»Das ist nicht nett«, sagte ihr Vater laut schmatzend.
»Ich weiß«, sagte Martha, »aber es tut mir nicht leid. Es ist das, was er hören will, was er hören muss.«
»Es stimmt«, sagte Klaus, »du sollst mein Antrieb sein, denn diesen Wunsch will ich dir nicht erfüllen.«
»Siehst du?«, sagte Martha in Richtung ihres Vaters. »In Wahrheit kann man mir danken. Nett sein bringt einen nicht weiter.«
»Das Architektur-Business ist hart, oder?«, fragte ich, nachdem es plötzlich unangenehm still geworden war. Martha schaute mich an, als ob ich ein Außerirdischer wäre, der sich ungefragt in eine Diskussion einbrachte, von der er nichts verstand, weil er die Menschen nicht kannte, weil er die Kultur nicht kannte, weil er keine Ahnung hatte von der Lebensweise, vom nie enden wollenden Diktat des Lernens, zuerst für die Eltern, dann für die Schule, dann für das Studium, dann für die Arbeit, für das Geld, für den Wohlstand und das eine oder andere schwer erkaufte Luxusgut oder, wenn es nicht so gut lief, fürs nackte Überleben.
»Ich frage mich, was er an dir findet«, sagte sie.
»Wir sind befreundet«, sagte Klaus, »da gibt es nichts zu finden.«
»Ach«, machte sie, »ich sehe schon, es ist diese Süße, das Träumerische und Unschuldige, das ihm anhaftet, nicht wahr? Aber um auf deine Frage zurückzukommen«, Martha wandte den Kopf in meine Richtung: »Warum sollte ich dir bestätigen, was du ohnehin annimmst? Denk dir über die Architektur, was du willst. Mach ein paar Fotos von kuriosen Brücken und putzigen Häusern und sei froh über deine Unwissenheit.«
»Was sie damit sagen will«, meinte Klaus nach einer kurzen Pause, »es ist ein hartes Business.«
Sein Vater gluckste, wobei es sich anhörte, als ob er sich an etwas verschluckt hatte oder ihm der Kren zu heftig in den Kopf gestiegen war. Seine Mutter schmunzelte leise, ich gab einem inneren Drang nach und lachte laut auf, um diese eigenartige Stimmung loszuwerden, und Klaus stimmte mit ein. Ich schaute zu Martha und bemerkte, dass sogar über ihre Lippen der Hauch eines Lächelns gekrochen war.
Vom Badezimmer im ersten Stock aus sah ich durchs geöffnete Fenster in den angrenzenden Wald, die Bäume in der zweiten Reihe waren wegen der Dunkelheit kaum noch auszumachen. Kalte, beinahe winterliche Luft strömte herein und an meinen Füßen vorbei zur Tür, während der Dampf von der heißen Dusche, als würde die Nacht ihn gierig einatmen, so lange nach draußen gezogen wurde, bis nichts mehr von ihm im Zimmer vorhanden war. Die Äste der alten Bäume wurden durch eine sanfte Brise in Bewegung versetzt, sie rieben ihre Nadeln und noch jungen Blätter aneinander und gaben dabei Geräusche von sich, die mir eine Gänsehaut bescherten. Ich schloss das Fenster, spuckte den Rest der schaumigen Zahnpasta ins Waschbecken und spülte gründlich den Mund aus.
Als ich die Badezimmertür öffnete, stand Martha in einem schwarz glänzenden Nachthemd, das ihr gerade so über die Hüften reichte, im Flur, mit dem Rücken lässig ans hölzerne Geländer gelehnt. Fast hätte ich darüber grinsen müssen, dass sie sogar in der Nacht schwarz zu tragen pflegte, aber dann legte sich mein Blick auf ihre langen, dünnen Beine, und diese Ansicht verjagte rasch alle aufkeimende Komik.
»Hallo Martha«, sagte ich so lässig wie möglich, »ich hoffe, ich habe nicht zu lange das Bad besetzt?«
»Wo schläfst du?«, meinte sie, ohne auf meine Frage einzugehen.
»Na, bei Klaus«, sagte ich. »Warum fragst du?«
»Und mit wem?«
»Wie bitte?«
»Mit wem du schläfst, würde ich gerne wissen.«
»Äh, sorry, wie meinst du das?«
»Schnelldenker bist du jedenfalls keiner«, sagte sie trocken und fügte nach einer kurzen Pause, in der ich die Schultern angehoben und wieder fallen gelassen hatte, hinzu: »Also gut, auf deinen Intellekt heruntergebrochen: Du darfst mich ficken.«
Okay, das war ein Witz. War es das? Dann hätte sie doch lachen müssen. Aber sie lachte nicht. Ich verschluckte mich bei dem Versuch, etwas zu sagen und musste mehrmals husten.
»Du hast schon richtig gehört«, sagte sie. »Ein Männertraum, nicht wahr? Mit einer Frau zu schlafen, ohne sie mühsam anbraten und auf zehn Getränke einladen zu müssen.«
»… also, das ist …« Ich hatte mich immer noch nicht ganz gefangen und wischte mir mit dem Handrücken über den Mund. »Danke, aber …«
»Nichts zu danken«, sagte sie. »Ich könnte es mir natürlich auch selbst besorgen, aber warum sollte ich mich anstrengen?«
Ich stellte mir vor, wie es wäre, mit Martha zu schlafen, und ich sah nur schwarzes Leder, schwarzen Latex, schwarze Peitschen, die knallend auf meinen Hintern niederfuhren, schwarze Fesseln und Stöcke und Schnüre und Masken und Vibratoren. So schön der Körper dieser Frau auch anzusehen war, ich verspürte keinerlei Drang, mich ihr zu nähern. Und das verwirrte und überraschte mich. Und ja, es ärgerte mich. War es ihr Geruch? Konnte ich sie, wie man so schön sagte, nicht riechen? Trotzdem: Welcher Mann würde solch ein Angebot abschlagen? Man musste verrückt sein. Sex ist Sex, da braucht man nicht mehr hineindichten, als vorhanden ist. Und man muss einen Menschen bekanntlich nicht mögen, um mit ihm zu schlafen. Da sind doch nur zwei Körper, die passen immer, zumindest auf die eine oder andere Art, ineinander, egal ob man sich sympathisch findet oder nicht.
»Ich … ich weiß dein Angebot echt zu schätzen«, hörte ich mich sagen und dachte mir, dass diese Worte furchtbar klangen und absolut falsch waren und doch gesagt werden mussten, »aber ich möchte lieber nicht. Und das hat bitte nichts mit dir zu tun«, fügte ich entschuldigend hinzu. »Du bist echt …«
»Makellos«, sagte sie, »ich weiß.«
Sie bewegte langsam ihre Arme in die Höhe und streckte sich, wodurch ihr Nachthemd sich um einige Zentimeter anhob und mir die Sicht auf ihren Slip ermöglichte. Ich fühlte mich wie ein Darsteller in einem billigen Softporno. Verdammt, sagte ich mir, was bist du nur für ein Weichei, was für ein Mann? Das kann doch nicht wahr sein! Nun wäre wohl der richtige Augenblick gewesen (und es hätte ja auch im Porno-Skript gestanden), zu ihr hinzugehen und das Nachthemd langsam nach oben über ihren Kopf zu streifen, wodurch ihre Nippel (die natürlich kurz vor Drehbeginn mit Eiswürfeln behandelt worden wären) steif sich meinem Mund entgegengestreckt hätten und so weiter und so bla bla bla.
Sie ließ ihre Arme wieder nach unten fallen. Wir schauten uns ein paar Sekunden stillschweigend an, und da sah ich diesen eigenartigen Blick in ihren Augen. Ich kannte ihn und spürte deutlich, dass ich meine Meinung nicht ändern würde, denn mit einem Mal erinnerte ich mich: Menschen, die wissen, dass sie schön sind, und das auch noch zur Schau stellen, hatte ich nie anziehend gefunden. Aber darum ging es hier nicht. Ich denke, ich wollte nicht von ihr benutzt werden wie ein Dildo, das hatte ich bereits hinter mir, ebenso die Erfahrung, jemand anderen zu benutzen. Es war schon okay, aber es gab mir nichts; ein Objekt zu sein, das hatte für mich nichts mit wahrer Lust zu tun, und daher schüttelte ich den Kopf.
»Also doch ein Homo«, sagte sie.
»Ich?«, fragte ich, als ob sich noch jemand im Flur befunden hätte. »Nein, bin ich nicht.« Sofern ich ihren Gesichtsausdruck richtig interpretiert hatte, wirkte sie durch ihre Abschätzigkeit hindurch auf einmal verletzt; ihre Augen hatten den Panzer verloren, da schien, so glaubte ich, für einen kurzen Augenblick ein Funken der echten Martha zu mir hindurch. So wie sie nun dastand, mit leicht nach vorne gebeugtem Oberkörper und mit den Augen nach etwas suchend, das ihr Halt geben könnte, hätte man sie fast liebenswert finden können.
»Da ich annehme, dass du kein strenger Katholik bist«, sagte sie und setzte wieder ihre undurchdringliche Miene auf, »kann ich dir mit absoluter Sicherheit sagen, dass du schwul bist.«
»Wenn es dir damit besser geht«, sagte ich, »dann nenn mich halt schwul. Passiert mir nicht zum ersten Mal.«
»Sag ich doch!« Mit diesen Worten ging sie ins angrenzende Zimmer und schlug die Tür zu, sodass ein lautes Krachen durch die Luft des Flurs klang. Klaus erschien im gegenüberliegenden Türrahmen und fragte, ob etwas passiert sei. Nein, sagte ich, nichts passiert, mir sei bloß der Türgriff ausgerutscht.
Wir lagen nebeneinander, er in seinem Bett, ich am Boden auf einer für meinen Geschmack zu weichen Matratze. Wenn ich den Kopf ein wenig nach hinten drehte und meinen Hals leicht überdehnte, konnte ich die schmale Mondsichel durchs Fenster erkennen, die sich wie ein Stempel aus Licht mit scharf gezeichnetem Rand von der ihn umgebenden Dunkelheit abhob. Ich fragte mich, ob am Mond jemals Menschen leben würden und, wenn ja, welche Gesetze es dort gäbe oder ob es, wenn es einmal so weit wäre, im Zweifel gar keine mehr bräuchte. Wer wohl das erste Kunstwerk auf dem Mond erschaffen würde? Ob es bereits irgendwo dort oben existierte, für niemanden sichtbar? Der erste Schritt auf der Mondoberfläche von Neil Armstrong: War das bereits ein Kunstwerk oder nur ein Zeitdokument? Müsste es konserviert werden oder übernähme dies ohnehin die fehlende Atmosphäre? Ist dieser Abdruck, der zu einem bleibenden Eindruck wurde, denn überhaupt noch dort oben – oder dort unten oder dort drüben oder besser gesagt: dort draußen? Die Andeutung von Marthas Schamlippen glitt langsam über die Mondsichel, meine Augenlider wurden schwer und ich merkte, dass ich nicht gegen diese Fantasie, die die Zügel in die Hand genommen hatte, ankämpfen konnte und es – wenn ich es recht bedachte – nun auch nicht mehr wollte. Was hatte mich vorhin nur geritten?
»Bist du noch wach?«, fragte Klaus im Flüsterton.
Ein Zucken durchfuhr meinen Körper. In meiner Vorstellung war der Mond zu einem dunklen Bett geworden, nein, es war nicht dunkel, sondern schwarz glänzend, und Martha lag darauf in einem weißen, durchsichtigen Kleid.
»Ja«, sagte ich. »Bin noch wach.«
»An was denkst du?«
»Ich versuche an nichts zu denken«, log ich, »aber das geht nicht.«
»Es geht«, sagte Klaus, »nur darf man sich dabei nicht anstrengen.«
»Und wenn sich … wenn sich irgendwelche Bilder vors innere Auge schieben?«, fragte ich.
»Dann musst du sie wohl oder übel zulassen«, sagte er. »Damit sie wieder verschwinden können, verstehst du?«
»Zulassen«, sagte ich und dachte an die Fußstapfen von Neil Armstrong und ans erste Kunstwerk im All, das es meines Erachtens dort oben noch nicht gab, und dass wir das All auf keinen Fall allein den Wissenschaftlern und dem Militär überlassen dürfen. Aber was weiß ich schon, sagte ich mir, ich müsste es googeln, aber dazu müsste ich das Handy einschalten, und es würde, auch wenn ich es runterdimmen würde, weh tun in meinen Augen. »Wenn du unendlich viel Geld hättest«, fragte ich Klaus, um auf andere Gedanken zu kommen, »also egal wie viel, welches Kunstwerk würdest du dann kaufen?«
Klaus antwortete lange nicht, sodass ich annahm, er wäre eingeschlafen.
»Wenn ich alles Geld der Welt hätte«, sagte er in die Stille und verschränkte die Arme hinter dem Kopf, »dann würde ich …« Er hielt inne und meinte: »Aber ich glaube, das geht nicht. Nicht um alles Geld der Welt. Die sind meines Wissens im Staatsbesitz und somit unverkäuflich.«
»Wovon redest du?«
»Ach, entschuldige, ich habe mir nur gedacht, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich Folgendes tun: Als erstes würde ich in den Louvre gehen und die Mona Lisa kaufen, ich würde sie in einem Bunker verstecken, du wärst natürlich für die Archivierung und Konservierung zuständig.«
»Natürlich«, sagte ich. »Und warum, wenn ich fragen darf, würdest du das machen wollen?«
»Weil mich diese Kunst-Touristenströme ankotzen, die Leute, die durchs Museum rennen, nicht links und nicht rechts schauen, sondern nur, wo sich das Schildchen mit dem Pfeil zur Mona Lisa befindet, um der Weganweisung blind zu folgen. Ebenso würde ich den Kuss vom Oberen Belvedere entfernen und in den Bunker verfrachten. Im Kunsthistorischen Museum würde ich den Großen Turmbau zu Babel abhängen. In jedes namhafte Museum dieser Welt würde ich reisen, um ähnlich zu verfahren. Und zu guter Letzt in den Vatikan, um die Fresken der Sixtinischen Kapelle hinter einem gut gespannten, undurchsichtigen Tuch zu verstecken, damit die Menschen, die dort unbedingt hinpilgern wollen, sich wieder erinnern, dass sie nicht an diesen Ort müssen, um aus sich hinaus-, sondern um in sich hineinzugehen.«
»Du meinst, um zu beten?«, fragte ich. »Aber das kann man doch überall.«
»Das stimmt«, meinte Klaus, »aber erzähl das mal denen im Vatikan. Kunstwerke sehen und machen, das kann man auch überall, und trotzdem strömen die Leute wie Fremdgesteuerte in die Museen, um dieses eine Gemälde zu sehen, als hätten sie sonst die Stadt nicht wirklich erfasst, als kämen sie sonst mit leeren Händen oder leeren Augen nach Hause.«
»Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe«, sagte ich, »du willst also nicht, dass die Menschen ins Museum gehen?«
»Ganz im Gegenteil«, sagte er, »nur sollen sie dorthin, um die Kunstwerke nicht nur anzuschauen, sondern vor allem zu sehen, versteht du, was ich meine? Sie sollen mit offenen Augen durch die Ausstellungen schlendern, die Werke unbekannter Künstlerinnen und Künstler entdecken, anstatt in diese eine Ebene zu pilgern und in diesen einen schummrig beleuchteten Raum, um eine Stunde an diese eine Wand zu starren, an der das sogenannte Meisterwerk hängt.«
»Du meinst, wie auf einen Berg zu gehen, nur damit man den Ausblick vom Gipfel genießen kann, nein, nicht genießen, sondern fotografieren, aber auf dem Weg hinauf und hinunter sieht man nichts, keine Tiere, keinen Grashalm, keine Blume, keinen Stein?«
Klaus richtete sich auf, nickte und sagte: »Amen.«
Wir lachten und sprachen anschließend noch eine gefühlte Stunde über den neuesten Marvel-Film, den wir am Vortag in einem großen, hässlich gestalteten Kino in Villach angeschaut hatten. Ich sagte, dass ich mir wünschte, es gäbe einen Heldenfilm, in dem der Bösewicht gewinnen würde, ich meine wirklich gewinnen, nicht nur scheinbar in einem ersten Teil. Es sollte ein hoffnungsvoller Film sein, wie alle anderen dieser Art, damit die Zuschauer sich in Sicherheit fühlen und mitfiebern mit den großen, tapferen Helden, die bestimmt – und warum auch nicht? – in letzter Sekunde gewinnen würden, denn so war es immer und so wird es immer sein, nicht wahr? Aber dann, ganz zum Schluss, käme es anders, und die Helden, siehe da, würden verlieren, sie würden alle nach heroischen Kämpfen getötet werden oder sie töteten sich selbst, und das Böse würde gewinnen. Und es gäbe keine Auflösung nach dem Abspann, keinen Hoffnungsschimmer, der dem Publikum mit nach Hause gegeben würde, damit sie sich denken könnten: Ach, da gibt es dann bestimmt einen zweiten Teil, wo dann das Gute gewinnt. Nein, hier wäre wirklich das Allerschlimmste eingetroffen. Es ginge bergab ins Dunkle und kein Mensch, kein Held und keine Heldin, würde zur Rettung erscheinen; es wäre vorbei, wir wären am Ende der Erzählung angelangt und niemand würde jemals zurückkehren, die Zeit könnte nicht zurückgedreht werden, es gäbe kein alternatives Ende, kein paralleles Universum, wo der Kampf zu einem positiven Ende führen würde. Es wäre der absolute, fatale Schlusspunkt. Die Herzen wären im Keller, und dort blieben sie, weil niemand käme, um die Wunden zu heilen, und weil niemand mehr da wäre, um geheilt zu werden. Da wäre nur noch Abgrund, Angst und Schrecken. Und so, sagte ich, mit diesem Gefühl würde ich das Publikum gerne den Kinosaal verlassen sehen. Mit dem Wissen, dass es keine Fortsetzung gäbe, nicht im Jahr darauf und auch nicht in zehn Jahren. Dass der Film wirklich so konzipiert sei, dass es nicht gut ausgehe. Wir wünschen es uns so sehr, aber das Wünschen wäre umsonst. Weil es doch nicht immer gut ausgehen kann, dieses eine Mal nicht.