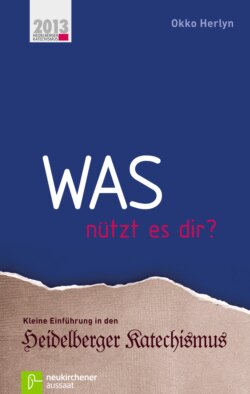Читать книгу Was nützt es dir? - Okko Herlyn - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. Was man vorweg wissen sollte
1. Was ist ein eigentlich ein Katechismus?
Ich gebe zu, das Wort „Katechismus“ ist etwas aus der Mode geraten. Zu Zeiten, als ich noch in den Konfirmandenunterricht ging, das war Ende der 50er Jahre, war das noch ein wenig anders. Da gehörte der Katechismus – neben der Bibel und dem Gesangbuch – zu den Gegenständen, die man in meinem Alter zwar nicht täglich, aber doch immerhin wöchentlich wenigstens in die Hand nahm. Und sei es auch nur, um irgendetwas für den Unterricht zu lernen. Ob einem das immer Spaß gemacht hat, steht auf einem anderen Blatt.
Was den Katechismus angeht, so war das in meinem Fall ein kleines, blass-grau-grünes postkartengroßes Heftchen. Der Heidelberger Katechismus. Gedruckt im Verlag „Buchhandlung des Erziehungsvereins, Neukirchen Krs. Moers“. Später wurde ich gewahr, dass es in der Welt noch eine ganze Reihe weiterer Katechismen gibt, etwa Martin Luthers Großen und Kleinen Katechismus, einen Genfer, einen Württembergischen und einen Holländischen Katechismus, einen Katholischen und einen Evangelischen Erwachsenenkatechismus und mittlerweile auch einen Jugendkatechismus, einen sogenannten „Youcat“, erschienen in vielen Sprachen, sogar in Arabisch und Chinesisch.
Aber was ist das eigentlich, ein Katechismus? Das Wort – man sieht es ihm an der Nasenspitze an – ist ein Fremdwort. In ihm steckt das altgriechische Wort „katēchein“, was wörtlich so viel wie „widerhallen“, „entgegentönen“ heißt. Unser deutsches „Echo“ kann man darin noch etwas erkennen. Weil seinerzeit die Reformpädagogik noch nicht ganz so weit war, kam man von „entgegentönen“ dann sehr bald im übertragenen Sinne auf „belehren“, „unterweisen“ und „unterrichten“. In diesem Sinne kommt das Wort verschiedentlich im Neuen Testament vor. Z. B. heißt es in der Apostelgeschichte von einem Mann, dass er „unterwiesen (katēchein) im Weg des Herrn“ war (18, 25). Man kann sich unschwer denken, was damit gemeint ist.
Unterweisung gehört von Anfang an zur Geschichte des Glaubens. Schon im Alten Testament wird immer wieder dazu aufgerufen, das, was man mit Gott erfahren hat, an die nachfolgende Generation weiterzugeben. „Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, unsre Väter haben’s uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten, in alten Tagen“ (Psalm 44, 2). Manchmal auch unter Zuhilfenahme von ganz handgreiflichen Dingen, wie wir das heute etwa aus der Symboldidaktik kennen. So wird beispielsweise das Volk Israel nach dem Durchzug durch den Jordan in das Gelobte Land aufgefordert, Steine am Ufer zu errichten. Und dann heißt es: „Wenn eure Kinder später einmal fragen: Was bedeuten euch diese Steine?, so sollt ihr ihnen sagen …“ (Josua 4, 6f). Und dann hat eben die Unterweisung im Glauben zu erfolgen.
In der ersten Christenheit hat solch eine Unterweisung wohl vor allem im Zusammenhang mit der Taufe stattgefunden. Anschaulich wird das z. B. in der Erzählung von der Taufe des äthiopischen Kämmerers in der Wüste (Apostelgeschichte 8, 26-40). Dieser ist gerade mit seinem Wagen auf dem Rückweg von Jerusalem nach Hause. Während der Fahrt liest er in einer alten Schriftrolle des Propheten Jesaja: „Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt …“ Er fragt sich: Was soll das? Zum Glück kommt gerade jemand des Weges, der sich auskennt: Philippus, einer der Apostel. Er steigt auf den Wagen und erklärt, was gemeint ist. Der alte Text spricht in einem Bildwort von Jesus Christus. Der Kämmerer ist offenbar so überwältigt, dass er sich spontan von Philippus taufen lässt. Mitten in der Wüste. Gott sei Dank ist gerade etwas Wasser in der Nähe.
Immer wieder begegnet das nun im Neuen Testament, dass Menschen, bevor sie sich für den Glauben an Jesus Christus entscheiden und also taufen lassen, zunächst einmal wissen wollen, worum es überhaupt in diesem Glauben inhaltlich geht. Dass sie sich also „unterweisen“ lassen. Dass solch eine Unterweisung – man könnte mit einem griechischen Fremdwort auch „Katechese“ sagen – kein einmaliger Vorgang nur im Zusammenhang mit einer Taufe war, zeigen mancherlei andere neutestamentliche Stellen. „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel“, heißt es etwa von der Jerusalemer Urgemeinde (Apostelgeschichte 2, 42). Beständig! D. h. Unterweisung im Glauben war offensichtlich nicht mit der Taufe „abgehakt“, sondern begleitete die Menschen weiter durch ihr ganzes Leben. Wir würden heute von einem „lebenslangen Lernen“ sprechen. Das ist leicht nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, dass die Bibel ja ein ziemlich dickes Buch ist, das man unmöglich in ein paar Unterrichtsstunden abhandeln kann.
Unterweisung, Lehre, Katechese also. Dabei geht es nicht darum, den Glauben zu beweisen, sondern ihn zu verstehen. Anselm von Canterbury, einer der großen mittelalterlichen Theologen, hat darum vom christlichen Glauben gesagt, dass dieser „nach Erkenntnis sucht“ (fides quaerens intellectum). Genau das ist es. Der christliche Glaube will schlicht wissen, wo er mit Jesus Christus dran ist. „Ich weiß, woran ich glaube“, heißt es in einem Lied von Ernst Moritz Arndt. Dazu ist Unterweisung, Lehre, Katechese da. Und ein Lehrbuch, das man seit den Zeiten der ersten Christenheit dazu verwendet, nennt man folgerichtig einen „Katechismus“. Unzählige hat es davon in der Geschichte der Christenheit gegeben. Bis heute. Einer davon ist der „Heidelberger Katechismus“.
2. Wie der Heidelberger Katechismus entstanden ist
Wir befinden uns gerade in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Es ist die Zeit der sogenannten „Gegenreformation“. Die Jahrzehnte davor waren durch die von Martin Luther ausgelöste Glaubensbewegung geprägt, die wir die „Reformation“ nennen. Seine grundlegenden Erkenntnisse, dass der Mensch, so wie es in der Bibel heißt, vor Gott „ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben gerecht wird“ (Römer 3, 28), dass also mit Gott kein Geschäft, auch kein frommes Geschäft zu machen ist, dass nicht Kirche und Papst, sondern allein Jesus Christus der Herr der Kirche ist und jeder Mensch in eigener Verantwortung vor Gott steht und dass nicht zuletzt nur die Heilige Schrift die alleinige Richtschnur des Glaubens sein kann – das alles hatte zu einer starken Unruhe und kurze Zeit später sogar zu einer Spaltung der Kirche geführt.
Nach erbitterten, z. T. auch blutigen Kämpfen einigte man sich im Jahr 1555 auf den sogenannten „Augsburger Religionsfrieden“. Dieser sah vor, dass die Frage, wonach sich ein Land in Glaubensfragen zu richten habe, von der persönlichen Entscheidung des jeweiligen Herrschers abhängig gemacht werden sollte: „cuius regio, eius religio“, „wessen das Land, dessen die Religion“. Dazu muss man wissen, dass zur damaligen Zeit Deutschland aus überaus vielen Ländern, Fürstentümern, Bistümern, Herzogtümern und Grafschaften bestand. So konnte es passieren, dass ein Land aufgrund eines neuerlichen Herrschaftswechsels in kurzer Zeit mehrfach die Konfession wechselte. Nicht selten also ein einziges Hin und Her. Ob das für die Menschen immer sinnvoll war?
In der Kurpfalz, einem Landstrich an Neckar und Rhein und politisch mit der bayrischen Oberpfalz verbunden, hatte sich der dortige Kurfürst Friedrich II. bereits 1545 für die Sache der Reformation entschieden. Dies wurde 1548 von dem katholischen Kaiser wieder rückgängig gemacht. Kurz nach dem erwähnten Augsburger Religionsfrieden, nämlich 1556, schloss der jetzige Kurfürst Ottheinrich sein Land wieder der Reformation an. Nach Ottheinrichs baldigem Tod 1559 wurde Kurfürst Friedrich III. sein Nachfolger. Dieser war zwar streng katholisch aufgewachsen, heiratete aber eine evangelische Frau, nämlich Maria von Brandenburg-Kulmbach. Ihr ist es wohl zu verdanken, dass Friedrich sich intensiv mit der Bibel und den Schriften der Reformatoren beschäftigte. Hier vor allem mit den Büchern der Schweizer Reformatoren Ulrich Zwingli und Johannes Calvin, aus denen dann später die reformierten Kirchen hervorgegangen sind.
In der Kurpfalz waren die Verhältnisse, wie sich aufgrund der raschen Konfessionswechsel unschwer denken lässt, alles andere als überschaubar. Es gab überzeugte Lutheraner, es gab Anhänger des „gemäßigteren“ Melanchthon, es gab strenge Calvinisten. Um hier nun wenigstens für sein Land ein wenig Klarheit und Einheit zu schaffen, beauftragte Friedrich eine Kommission unter Leitung von Zacharias Ursinus und Kaspar Olevian mit dem Ziel, ein für alle verbindliches Lehrbuch zu erstellen. Das Ergebnis sollte nicht lange auf sich warten lassen: Es ist der „Heidelberger Katechismus“. Ursprünglicher Titel: „Katechismus oder christlicher Unterricht wie er in Kirchen und Schulen der kurfürstlichen Pfalz getrieben wird“. 129 verständliche Fragen und Antworten in Sachen des Glaubens. Wir schreiben das Jahr 1563.
3. Ein früher Bestseller
Wie man sich denken kann, erfuhr der Heidelberger Katechismus alsbald heftige Reaktionen: Beifall und Pfiffe. Auch innerhalb der reformatorischen, also der evangelischen Kirchen. Vor allem die Lutheraner sahen hier schnell eine Konkurrenz zu „ihrem“, nämlich dem Kleinen Katechismus Martin Luthers, der seit 1529 in Deutschland bereits große Verbreitung gefunden hatte.
Der Heidelberger Katechismus hatte indes seine eigene Erfolgsgeschichte. Schon im Jahr seiner Erscheinung wurde er ins Plattdeutsche und ins Niederländische übersetzt. Da sich zu dieser Zeit sehr viele Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden in Deutschland befanden, bürgerte er sich in manchen deutschen Gegenden schnell ein. Der Weseler Konvent (1568), die Emder Synode (1571) und die Bergische Synode (1589) waren hier maßgeblich dafür, dass der Katechismus zunächst vor allem in Teilen des Rheinlands Verbreitung fand. Es folgten Nassau-Dillenburg, Sayn-Wittgenstein, Solms-Braunfeld, Wied, Isenburg-Büdingen, Hanau-Münzenburg, Moers, Pfalz-Zweibrücken, Simmern und Anhalt, Lippe-Detmold, Hessen-Kassel. Namen, die man heute vor allem von den Abfahrtsschildern auf der Autobahn her kennt. Auf der ersten reformierten Duisburger Generalsynode (1610) der mittlerweile vereinigten Herzogtümer Jülich, Berg, Kleve und Mark wurde beschlossen, dass „die Summe der in Gottes Wort gegründeten Religion im Heidelberger Katechismus wohl gefasst und dieser Katechismus hinfort in den Schulen und Kirchen des Landes zu halten und zu treiben sei“. 1713 wurde der Heidelberger dann auch für die reformierten Gemeinden in Brandenburg-Preußen verbindlich gemacht.
Im Ausland folgten neben den Niederlanden auch Ungarn und die Schweiz. Später kamen Nordamerika, Südafrika und Indonesien hinzu. Das lag vor allem daran, dass viele Auswanderer aus Deutschland und den Niederlanden „ihren“ Heidelberger im Gepäck hatten. Und auch sonst machte der Katechismus rasch Furore. Es wird z. B. berichtet, dass die englischen Abgeordneten auf der Synode zu Dordrecht (1618/19) von dort in ihre Heimat mit den Worten zurückgekehrt seien: „Unsere Brüder auf dem Festlande haben ein Büchlein, dessen Blätter nicht mit Tonnen Goldes zu bezahlen sind.“ Gemeint war der Heidelberger Katechismus. Kein Wunder, dass die Lutheraner mit „ihrem“ Kleinen Katechismus Martin Luthers hier Konkurrenz witterten, mitunter bis heute.
Gleichwohl darf darüber nicht vergessen werden, dass beide Katechismen in den grundlegenden reformatorischen Einsichten völlig eins sind, die sich etwa in den Formeln „solus Christus“, „sola scriptura“, „sola gratia“ und „sola fide“ ausdrücken: „Christus allein“, „allein die Schrift“, „allein aus Gnade“, „allein durch Glauben“. Was diese Grundüberzeugungen angeht, passt zwischen Luther, Melanchthon, Zwingli und Calvin kein Löschblatt, unbeschadet der einen oder anderen theologischen Differenz im Detail. So erklärt sich auch, dass sich beide Katechismen im Laufe der Geschichte in mannigfacher Weise bewährt haben. Der Heidelberger Katechismus u. a. als Antwort auf einen verflachten, moralisierenden Glauben der Aufklärungszeit und nicht zuletzt während des sogenannten „Dritten Reiches“, wo er zu einem wichtigen Wegweiser für den Widerstand der Bekennenden Kirche wurde.