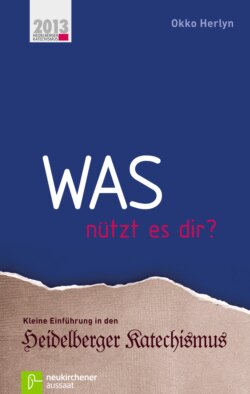Читать книгу Was nützt es dir? - Okko Herlyn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Ja und Nein
ОглавлениеIn dem Zusammenhang fällt noch etwas auf. Viele Antworten des Heidelberger Katechismus beginnen mit einem kurzen und knorrigen Ja oder Nein. Auch das mag befremden. Kann man so mit Fragen des Glaubens umgehen? Ist es nicht immer eher eine Ermessensfrage, die, wie man gerade bei Glaubensfragen immer wieder hört, „jeder selber entscheiden muss“? Und man sich gerade in religiösen Dingen doch in der Regel verbittet, mit einem „Punktum“ abserviert zu werden?
Vor mir sitzt ein junges Pärchen. Es möchte gerne kirchlich getraut werden. Im Verlauf des Gesprächs zeigt sich, dass sie evangelisch und er katholisch ist. Auf meine Frage, ob das für sie beide ein Problem darstelle, kommt die rasche Antwort: Aber nein! Es laufe doch eh alles auf dasselbe hinaus und schließlich glaubten wir doch alle an einen Gott. Man sehe da keine großen Unterschiede und schon gar keine Probleme. Unabhängig davon, ob solch eine Aussage womöglich eher Ausdruck einer religiösen Gleichgültigkeit ist, kann man allerdings fragen, ob es überhaupt stimmt, dass doch eh alles auf dasselbe hinauslaufe.
Der Heidelberger bestreitet das. Allein seine knorrigen Jas und Neins sprechen eine andere Sprache. Nämlich die, dass es schon Unterschiede gibt. Auch im Glauben. Und dass es von dort her vielleicht auch einmal sinnvoll sein kann, entschieden Ja oder Nein zu sagen. Insofern könnte man fragen, ob gerade die auf den ersten Blick so kantige Sprache der Abgrenzung nicht vor allem zu einer heilsamen Aufklärung beiträgt. Es ist eben nicht alles „dasselbe“. Und ob wir z. B. tatsächlich „alle an einen Gott glauben“, ist eine Frage, über die man zumindest einmal in Ruhe nachdenken könnte, statt sie gleich als bereits erledigt abzutun. Wenn man nur daran denkt, wie viel Widersprüchliches – etwa hasserfüllter Fanatismus auf der einen und herzliche Menschenfreundlichkeit auf der anderen Seite – im Namen des angeblich „einen Gottes“, an den wir angeblich „alle glauben“, geschieht, so wird man in dieser Sache schon ein wenig einsilbiger.
Nein, es mögen uns die mitunter kantigen Ja-oder-Nein-Formulierungen des Heidelberger Katechismus hier und da stören. Sie tun uns auf jeden Fall den Dienst, uns immer wieder auf das Besondere des christlichen, auch auf das Besondere des evangelischen und nicht zuletzt auch auf das Besondere des reformierten Glaubens hinzuweisen. Nicht selten wird ja in letzter Zeit wieder „evangelisches Profil“ angemahnt. Hier bekommen wir es reichlich geliefert.
Und die Ökumene? Nimmt sie nicht Schaden, wenn wir schon in unserer Sprache zu sehr auf ein „evangelisches Profil“ drängen? Das Gegenteil ist der Fall. Etwa im interkonfessionellen Gespräch zeigt sich immer wieder, dass ein solches überhaupt nur funktionieren kann, wenn sich die jeweiligen Gesprächspartner über ihre eigene Glaubenshaltung und über ihre eigenen theologischen Erkenntnisse einigermaßen im Klaren sind. Wenn mein Gegenüber anderer Meinung ist, kann ich das respektieren, ohne mich selbst dabei zu verbiegen und ohne ihm umgekehrt auch gleich die Feindschaft anzusagen. Solange wir noch nicht die eine von Christus verheißene Kirche sind, kann ehrliche Ökumene nur heißen: respektvolles Miteinander der Verschiedenen. Und vielleicht entsteht über einem solchen ökumenischen Respekt ein neues gemeinsames Suchen in der Schrift. Auch hier mag der Heidelberger eine Hilfe sein.