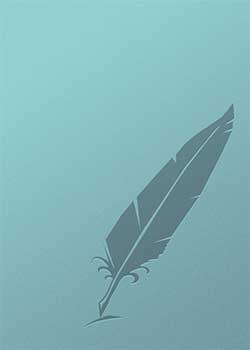Читать книгу Lebensbilder - Оноре де Бальзак - Страница 4
ОглавлениеLiterarische Unterschiebungen sind bei allen Völkern anzutreffen. Entweder man annektierte einen berühmten Namen eines Dichters und gab ein in seinem Geiste geschaffenes Werk heraus, oder man ging noch um den bedeutsamen Schritt weiter, unter dem Namen irgendeines vielgelesenen Schriftstellers eine Parodie seiner Schriften erscheinen zu lassen, oder man bediente sich einer Zelebrität nur als des Deckmantels, um irgendein beliebiges Buch, das mit der Eigenart des um seinen Namen betrogenen Schriftstellers gar nichts zu tun hat, leichter abzusetzen. So gibt es z. B. ein Buch von A. von Chammisso »Die Gauner oder Galerie der pfiffigsten Schliche und Kniffe berüchtigter Menschen« (Sondershausen 1836). Die Verdoppelung des m in Chammisso hat weiter nichts zu sagen; der Verfasser dieser Verbrechergalerie beabsichtigte lediglich eine Spekulation mit dem berühmten Namen des Dichters.
Spekulative Interessen waren es ja immer, die zu solchen Irreführungen den Anlaß gaben. Wenn der junge Thomas Chatterton an Horace Walpole ein »Verzeichnis alter Maler«, das aus dem Jahre 1469 stammen sollte, und ein Gedicht auf Richard Löwenherz, vorgeblich von einem Abte John herrührend, einsandte (die diesbezügliche Korrespondenz in Rüttmans Chattertonausgabe), so hatte er bloß die Absicht, seinen eigenen Werken, unter der Fiktion, sie stammten aus vergangenen Iahrhunderten, den altertumsfreundlichen Walpole zugänglich zu machen. Die vortreffliche Beherrschung der alten sächsischen Sprache durch den halbreifen Knaben verbürgte das Gelingen dieser Täuschung, bis er, in einem Anfall von Scham oder Ruhmsucht, seine Tat eingestand. Es war eine zu harte Strafe, daß der düpierte Walpole den Betrug in alle Welt hinausschrie und der Knabe, der keine Lebenshoffnung mehr sah, sich mit siebzehn Jahren vergiftete! [* Vgl. A. de Vignys Drama »Chatterton«, nach »Hernani« das bedeutendste romantische Drama in Frankreich] So offenherzig wie Chatterton war der schottische Fälscher Macpherson nicht, dessen Ossianlieder niemals an einem geheimnisvollen Orte gefunden worden waren, nicht aus dem dritten Jahrhunderte und aus dem Gälischen stammten, sondern – wie schon Hume vermutete – eigene Dichtungen Macphersons sind. Wie auch die Tragödie Shakespeares, die William Henry Ireland ihm zuschob, eine eigene Dichtung des Jünglings war, der, nachdem London sich an dem neuaufgefundenen Drama Shakespeares erbaut hatte, seine Verfasserschaft eingestand. (Vgl. Curt Müller in der »Vossischen Zeitung« vom 15. Juli 1912.) –
Aus Deutschland sind ein paar ähnliche Fälle von »Einfühlungen« in fremde Werke bekannt. Allerdings den falschen »Wanderjahren« des süßen Pustkuchen [* Vgl. Michael Holzmanns Buch »Aus dem Lager der Goethegegner«. («Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts«. Nr. 129, Seite 29 ff.)] war die Eigenart Goethes, dessen damals noch nicht erschienene »Wanderjahre« von dem stümpernden Pfarrer ersetzt werden sollten, zu wenig aufgeprägt, als daß der Betrug nicht sehr rasch hätte durchschaut werden können. In Stil und Darstellung war Goethe manches abgesehen; aber Stellen, wie I,161, wo sich Äußerungen über Goethe finden, machten dessen Autorschaft von vornherein unglaubhaft [* Andere Stellen bei Holzmann a. a. D.] Glücklicher war Hauffs Claurennachahmung im »Mann im Monde«: sie gilt gewöhnlich als Parodierung des unerquicklichen Modeschriftstellers, ist aber doch eher ein Roman, der gerade mit den Mitteln des zu Verspottenden die stärksten Wirkungen erzielt. Als Parodie auf die unselige Manier Claurens können zwei Arbeiten von Herloßsohn gelten, eine satirische Posse »Der Luftballon« und »Löschpapiere aus dem Tagebuche eines reisendenTeufels«, die unter dem Namen Heinrich Clauren erschienen. (Leipzig 1827.) Diese Claurenparodie Herloßsohns besteht aus drei Teilen: 1. Erzählungen, 2. Silvesternachtbilder, 3. Nachtgedanken Schmuel Baruch Froschs. Nur der dritte Teil ist interessant nicht nur deshalb, weil er, wie Herloßsohn selbst mitteilt, von der österreichischen Zensur in einer Zeitschrift nicht zum Druck zugelassen wurde, da man eine Satire auf Juden darin sah, sondern auch wegen des aggressiven Inhaltes, einer scharfen Satire auf Tieck und seine Schule. Eine Dame aus dieser Schule hält eine Vorlesung über die Barbarei der Zeit, die an Müllner, Houwald, Grillparzer und Raupach Gefallen gefunden habe. Müllner tritt plötzlich in die Versammlung und hält eine Kapuzinerpredigt voll persönlichster Bosheiten, z. B.:
»Der Tieck nennt ihre Werke all schlechten Plunder,
Und wie Kriegszeichen, schwarz und rot,
Hängen seine Didaskalien herunter.
Seine Shakespeare-Theorie steckt er wie eine Rute
Drohend im Dresdner Theater aus;
Das dortige Theater ist ein Trauerhaus,
Die ganze deutsche Poesie schwimmt in ihrem Blute....
Über den Raupach schreit er Weh und Ach,
Und der Houwald und Grillparzer
Meint er, wären ein Mulatte und ein Schwarzer....«
»Die Abenteuer und Erzählungen in Callot-Hoffmannscher Manier« von B. S. Ingemann (übersetzt von Dr. Bartels; Leipzig 1826) atmen weit mehr den Geist Fouqués (dessen »Galgenmännlein« in der Erzählung »Das hohe Spiel« kopiert ist) als den Hoffmanns; und »Skizzen in der Manier des seligen A. G. Meißner«, herausgegeben von Adolf von Schaden (3 Bände, Augsburg 1827 – 1829), beweisen, daß der Vielschreiber jede gerade in Gunst stehende Manier, die des «Rochus Pumpernickel« ebenso wie die der »Sappho« fixfingerig nachzubilden sich erdreistete, mochte sie ihm wesensverwandt sein oder nicht. Er ist der Typus des skrupellosen literarischen Freibeuters, den niemals innere Notwendigkeit dazu trieb, mit fremder Eigenart sein arges Spiel zu treiben. –
Diesen Vorwurf wird man der geschicktesten und feinstem Beobachtungsgeiste erflossenen deutschen Nachahmung eines fremden Dichterwerkes nicht machen können; Willibald Alexis' »Walladmor«, weniger sein »Schloß Avalon«, erweist wohl am zutreffendsten, bis zu welchem Grade sich ein Autor in die Gedankengänge eines Vorläufers einlesen und einleben konnte. Man darf es dem Berliner Dichter, der die Entstehungsgeschichte «Walladmors« selbst in späteren Jahren dargestellt hat (Erinnerungen von Willibald Alexis. »Aus dem 19. Jahrhundert.« IV. Band. Seite 266 ff.), glauben, daß sein Beginnen nicht Spekulationsgier entsprang, sondern einer teufelsmäßigen Lust, zu beweisen, wie leicht und genau man Scott nachahmen könne. Es war nur literarische Ehrlichkeit von ihm, wenn er, nachdem die ersten zwei Bände des »Walladmor« die größte Spannung erregt hatten und fast ausnahmslos als Werk des Briten galten, in dem dritten durch offensichtliche Verhöhnung des Ganzen selbst die Schleier lüftete und seine wahren Absichten enthüllte. Daß Scott, anders als Clauren, wegen der Verwendung seines Namens keine Klage erhob, sondern selbst in einer Rezension die humoristische Täuschung günstig anerkannte, mochte vielleicht Alexis den Mut geben, vier Jahre nach dem »Walladmor« (der 1823 erschienen war) sein »Schloß Avalon« wieder unter Scotts Namen erscheinen zu lassen. Aber diesmal wurde eine ähnlich große Wirkung nicht mehr erzielt, wenn auch die Täuschung des Publikums vollkommen gelang. 1837 hat dann Gutzkow unter Bulwers Namen seine »Zeitgenossen« erscheinen lassen, und der »Verlag der Klassiker« war unaufrichtig genug, in allen gelesenen Zeitungen immer wieder zu annoncieren, daß er das Buch von Bulwer um große Summen zur alleinigen Veröffentlichung angekauft habe. Karl Buchner hat das Verdienst, die Unterschiebung sehr rasch aufgedeckt zu haben (vgl. »Hamburger literarische und kritische Blätter der Börsenhalle« 1837, Nr. 1353-1354). Der Kuriosität halber sei angeführt, daß auch unter Grillparzers Name eine ihm nicht angehörige Broschüre geht. Sie heißt »Die Stadttheatergrille« (Hamburg, Fritz Schuberth, 1857) und erschien gelegentlich der Erstaufführung der Birch-Pfeifferschen »Grille« im Hamburger Stadttheater. – –
Es ist kaum ein Zweifel, daß Alexis Hermann Schiff bewog, das an Balzac zu erproben, was ihm mit Scott so sehr gelungen war. Nur übersah der Balzacparodist, daß er seinen Witz an einem Dichter übte, der in Deutschland noch völlig unbekannt war. Dadurch war von vornherein verhindert, die tieferen Absichten Schiffs zu durchschauen. Eine dichterische Manier zu parodieren, kann nur dort einen Sinn haben, wo das Original selbst Populäritat genießt. Statt also Balzac zu verspotten, wäre es damals weit angebrachter gewesen, ihn erst, wie er war, den deutschen Lesern vorzustellen. Bis sich diese in seiner Denk- und Dichtweise zurechtgefunden hätten, wäre es an der Zeit gewesen, diese nach- oder weiterzubilden.
Übrigens war für Schiff nicht nur Alexis' Vorbild maßgebend, wenn er unter Balzacs Namen Eigenes veröffentlichte. Dieser hatte ja Ähnliches getan, als er »L'Elixir de longue vie« für eine verschollene Phantasie Hoffmanns ausgab [*Vgl. Artur Sakheims Buch »E. Th. A. Hoffmann«, Seite 33. ] Und auch sonst war in Frankreich gerade damals die Mode der literarischen Mystifikation verbreitet. Im April 1829 erschienen in Paris «Les soirées de W. Scott par M. Jakob bibliophile«. Damals begann der Geschmack an historischen Romanen nachzulassen, nur Scott behauptete noch immer sein Ansehen. In der Vorrede behauptete nun Jakob, daß er eine Sammlung historischer Skizzen herausgebe, die Scott in Paris, als er 1825 dort war, in mehreren Abendgesellschaften erzählt habe.
Das war unwahr: tatsächlich hat sich Jakob (Pseudonym für Paul Lacroix) nur mit viel Verständnis in Scotts Romane eingelesen und sie als fruchtbarer Nachahmer auszunützen gewußt. In demselben Jahre 1829 hat Jules Janin mit seinem »L'âne mort et la femme guillotinée« (in der deutschen bei Frankh erschienenen Übersetzung beruht der Titel «Der tote Esel und die guillotinierte Frau« auf einer Oberflächlichkeit: es handelt sich um keine Frau, sondern um ein Mädchen) Viktor Hugos Kunst in genialer und durchdringender Weise nachgebildet. Man war (vgl. »Blätter für literarische Unterhaltung« 1830. Nr. 172) in Verlegenheit, ob hier eine Nachahmung oder eine Persiflage von »Le dernier jour d'un condamné« vorliege. Diese Streitfrage ist nicht leicht zu entscheiden. Man hat immer das Gefühl, daß Janin vorhatte, den grausigen Stoff Hugos zu ironisieren, daß ihn aber unter dem Schreiben das Mitleid mit seinen eigenen poetischen Gestalten erfaßte und er dann, allen Sarkasmus über Bord werfend, ernst und ergreifend wurde.
Dieses reizvolle Buch war für Schiff von der größten Bedeutung. Auch er schwankt zwischen den beiden Gegensätzen des Ergriffenseins mit den Schicksalen seiner Personen und der unbezähmbaren Lust, diese Schicksale ins Lächerliche zu ziehen. Seine Balzacnachbildungen sind ein buntes Gemisch von beklemmendem Ernst und verruchter Necklaune. Er treibt die Menschen Balzacs und seine Leser von einer Stimmung in die andere; eine reelle Absicht leitet ihn niemals und konnte ihn nicht leiten. Denn seine ganze Natur, die sich an den Schöpfungen der deutschen Romantiker vollgesogen und berauscht hatte, konnte für den extremen Realismus Balzacs nichts übrig haben. Der französische Dichter war ihm gerade recht als Sprungbrett, um sich von diesem abzuschnellen und dann seine eigenen tollen Kapriolen auszuführen. In Deutschland nahm man freilich – wie die mitgeteilten Referate zeigten – Schiffs »Übersetzungen« ernst und beurteilte nach ihnen einen der größten französischen Realisten ....
Ja, ein Kritiker, Wolfgang Menzel, nahm das »Elendsfell« sogar zum Anlasse, um dem unschuldigen Balzac gehörig den Text zu lesen. (Literaturblatt zum Morgenblatt 1833, Nr. 19.) Er meinte, daß die vernünftigen, gescheiten und praktischen Franzosen auf dem Wege seien, recht fade und albern zu werden. Die Romantik habe den Franzosen den Kopf verwirrt, und es sei zum Lachen, wenn sie Hoffmann und den Satan in den Mund nähmen. – »Eine hagere Gestalt, ein blasses Gesicht, langstarrendes Haar, ein glühendes Auge, ein Spieltisch, perdu, ein versuchter Selbstmord, eine Engelsschönheit, eine Entführung, die Blasphemie – das sind die Farben, womit sie einen Teufel an die Wand malen. Das sind ihre Vorstudien der Hölle. Besäßen sie nicht im Stil ihre bewundernswerte Leichtigkeit und das Talent, aus jeder Kleinigkeit etwas Anziehendes zu bilden, sie würden mit ihrer ästhetischen Desperation, mit ihren Bizarrerien und ihren Nachtstücken eine klägliche Rolle spielen. Balzac will in jeder Beziehung der französische Hoffmann sein. Er ist unerschöpflich in Erfindungen, die auch er die Nachtseite des französischen Lebens nennt. Balzac schildert keine Menschen, sondern nur Schatten. Was die Tiefe ihres Charakters sein soll, sind Widersinnigkeiten, mit denen man sich nicht befreunden kann.« Nun erzählt Menzel den Inhalt des »Elendsfell« genau nach Schiff und schließt: »Raphael wäre jetzt tot, wenn Herr von Balzac jetzt nicht zu lachen anfinge, das ganze für einen Spuk erklärte und Raphael reich und zufrieden mit seiner Pauline leben ließe.« –
Man darf sich noch hinterher freuen, daß Schiff sein Betrug so vorzüglich gelang und er den allwissenden lilerarischen Papst Deutschlands so betören konnte. Denn was Menzel an Balzacs Erzählung nicht gefallen wollte, hatte dieser gar nicht geschrieben. Es war vielmehr Schiffs bizarrer Einfall, der ganzen logischen Aufeinanderfolge der Ereignisse die Spitze abzubrechen, dem durch den grausigen Schluß zu tiefst ergriffenen Leser plötzlich jovial auf die Achsel zu klopfen und zu sagen, daß das Ganze nicht erlebt sei, sondern nur eine Novelle, die der Held des »Elendsfell« eben geschrieben habe. Solche romantische Ironien standen Schiff gut an; er, der letzte Bekenner der allmählich sanft ausklingenden romantischen Doktrin, hatte bei Tieck und Heine oft gesehen, wie schlichte Märchen durch einen jähen Stimmungsumschlag der Dichter um ihre tiefsten Wirkungen kamen, wie die Erschütterung dem befreienden Lachen wich. Der Schlußeffekt von Heines »Seegespenst« ist von ihm glücklich in novellistisches Gebiet übertragen worden. Balzac hat mit dieser überraschenden, von Menzel getadelten Schlußwendung nichts zu tun! –
Wie Schiff Balzac umgestaltete oder sogar neu gestaltete, soll hier nur an zweien der mitgeteilten »Lebensbilder« gezeigt werden. (»Das Elendsfell« erschien zwar in der ersten Buchausgabe nicht unter dem gemeinsamen Titel »Lebensbilder«. Da aber Schiff bei der Veröffentlichung im »Gesellschafter« auch über diese Novelle »Lebensbilder von Balzac« schrieb, ist die Vereinigung aller Balzacunterschiebungen Schiffs unter der einen Bezeichnung in dieser Ausgabe wohl gerechtfertigt.) Am schwerstwiegenden sind die Überarbeitungen von »La Peau de chagrin«. Schon äußerlich schneidet Schiff aus Balzacs, zwar auch in drei Abteilungen mit einem Epilog gegliedertem, Werke drei fast selbständige Novellen, die nur durch den Helden Raphael verknüpft sind. Schiff setzt ganz ernsthaft ein: er folgt Balzacs Introduktionsszenen getreu: Der Spielverlust Raphaels, die Selbstmordabsicht, die Erwerbung des Chagrinleders bei dem Antiquitätenhändler, dessen Hinweis auf die mysteriöse Kraft, die in dem Felle stecke, die rasche Erfüllung der ersten Wünsche auf durchaus natürlichem Wege (Begegnung mit den Freunden, die Raphael zu einem opulenten Diner führen) – all das ist, zwar wesentlich verkürzt und der subtileren Kunst der Detailmalerei Balzacs beraubt, auch in Schiffs Buch übergegangen. Aber doch nur ganz äußerlich, denn Schiff stört die Illusion des Lesers, der voll frommen Märchenglaubens der Allmacht des Chagrinleders traut, indem er gleich anfangs sagt, daß sich alle Wünsche Raphaels erfüllen würden, ohne daß Wunder geschehen. So entkleidet er das gespenstische Märchen sofort seines Zaubers: er ist hier durchaus nicht Romantiker, sondern Realist, etwa wie der junge Tieck im Dienste Nikolais die «Straußfederngeschichten« am Schlusse immer auf den nüchternen Boden der Wirklichkeit stellte. In dieser Tonart fährt Schiff auch fort: er benützt die Bankettszene, die Balzac in breitester Umständlichkeit als raffinierte Orgie ausmalt, zum Vortrage seiner literarischen Gesinnungen, die der französischen Romantik durchaus abhold sind. Er beklagt die Entthronung Racines und des »geistvollen Popanzes« Voltaire, an deren Stelle de la Vigne, Lamartine und Chateaubriand getreten seien, die der Ruin von Frankreichs Ehre seien! Nur von der Bändigung des ungezügelten Journalismus erwartet er das Heil; der Geist müsse in Frankreich erwachen, damit dieses seine geschichtlichen Aufgaben erfülle.
Diese zweite Hälfte der ersten Novelle des »Elendsfell« zeigt schon, daß Schiff anderes vorhatte, als ein Übersetzer Balzacs zu sein. Er verliert ihn denn auch immer mehr aus dem Auge, und in der zweiten Novelle »Die Herzlose« offenbart er bald, was er im Grunde mit der Bearbeitung bezweckte. Er hat wohl erkannt, daß Raphael im wesentlichen nur ein Abbild Balzacs sei, des in seiner Jugend ruhelos Gequälten, der sich im Kampf um den Erwerb aufrieb, der stets in literarische und finanzielle Spekulationen verstrickt war, die ihn an der Oberfläche halten sollten. Als dann der große Wurf gelungen war, konnte Balzac mit breitem Behagen von dem entnervenden Kampf um das Glück erzählen, wie er es im »Chagrinleder« tut; er macht es sehr deutlich, daß er Raphael sei, wenn er z. B. diesen, wie er es selbst getan hatte, sich mit einer Abhandlung über den Willen (Traité de la volonté) abplagen laßt. Schiff folgt Balzac; aber Raphael ist in seiner Novelle nicht ein Abbild Balzacs, sondern Schiffs. –
Schon äußerlich weicht er völlig von der französischen Vorlage ab. Raphael erzählt im »Chagrinleder« seine Jugenderlebnisse, die ihn endlich bis zur Selbstmordabsicht trieben, bei der nächtlichen Orgie einem Freunde. Diese Erzählung ist so breit ausgesponnen, daß sie kaum während des Zeitraumes einer Nacht hätte vorgetragen werden können. Schiff verschmäht das Kunstmittel der Binnenerzahlung (später hat er es freilich bis zum Überdrusse häufig angewendet) und teilt Raphaels Geschick in Form eines Tagebuchs mit. Zu diesem Auskunftsmittel mußte er greifen, weil er in die Erzählung der Jugenderlebnisse des Helden eine von diesem (richtiger gesagt von Balzac) verfaßte Novelle verflocht. Die Form dieser zweiten Abteilung des »Elendsfell« ist also recht verkünstelt: der Inhalt freilich noch in höherem Maße. Raphael ist Verehrer der deutschen Romantik und Klassik; denn «auch die Klassizität war zu ihrer Zeit eine Romantik«. Er haßt Lord Byron, berauscht sich an Shakespeare und vergöttert Goethe. Darin ist er ein vollkommenes Abbild Schiffs, der in der Zeit der heftigsten Goethegegnerschaften treu an diesem hing und wiederholt nachdrücklich für ihn eintrat. Auch an Tieck erfreut sich der französische Enthusiast: »man träumt, schwärmt, phantasiert, lächelt, lacht und faselt bei ihm und stets mit Vernunft und Weise.«
Ganz anders denkt er über die französischen Dichter, von denen er niemanden gelten läßt, nicht einmal – Balzac. Mit dessen Erwähnung zeigt Schiff schon, daß er den Franzosen nicht übersetzt hatte. Aber man verstand ihn nicht, zumal er in der Auseinandersetzung über Balzac dessen Namen nicht weiter nannte. Und aus dieser Erörterung über Balzacs Kunst ist auch zu erkennen, wie wenig sie Schiff behagte. Er wirft ihm das Fehlen von Weltanschauung. Dichtergeist, Phantasie und Seele vor und tadelt (wie schon in der Vorbemerkung zu den »Lebensbildern«) feine breitausgesponnenen Beschreibungen, die ja bisweilen wirklich zu sehr ausarten. Auch die »Unsittlichkeit« Balzacs ist ihm widerwärtig, dessen Heldinnen nur für das Hospital leben, und deren einziges Ziel es sei, im Golde zu wühlen. (Schiff war wohl der erste, der das verschwenderische Umgehen mit Geld als bezeichnend für Balzac erkannte.)
Diese Charakteristik beweist, daß Schiff nie die ernste Absicht hatte, Balzac, wie er ihn vorfand, in Deutschland einzuführen. Denn man kann sich unmöglich zum Interpreten eines Dichters machen, an dessen Eigenart man alles Wesentliche auszusetzen findet. Aus dieserAbneigung gegen Balzacs Manier ist also Schiffs Bearbeitung zu erklären, die nichts unverrenkt läßt, was uns an dem Franzosen fesselt, was aber zu erkennen, dem romantischen Träumer Schiff, dem für kräftigen Realismus jedes Verständnis fehlte, völlig versagt war. Er stellte sehr bewußt andere Dichtungen der Balzacs entgegen: Shakespeares »Sturm«, »Runenburg« und »Liebeszauber« von Tieck, »Melusine« von Goethe [* »Die neue Melusine« erschien im »Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1817.« ] Eine »Runenburg« wird man unter Tiecks Werken vergeblich suchen; Schiff meint den 1802 entstandenen »Runenberg.« (In unserem Abdruck war kein Anlaß, diesen Flüchtigkeitsfehler Schiffs, der für seine saloppe Art charakteristisch ist, zu tilgen. Tiecks »Runenberg« erschien im 3. Jahrgang des in Köln bei Haas & Sohn verlegten »Taschenbuches für Kunst und Laune«, später im »Phantasus«, Band I, Seite 239–272 und in den »Gesammelten Schriften«, Band IV, Seite 214 ff.)
Diese rein romantischen, phantastischen Kunstwerke sollen nach Schiffs Wunsch den in Mode gekommenen Realismus verdrängen. Das ist für ihn eine Herzenssache, für die er in seinem »Elendsfell« warm eintritt. Er gibt vor, daß Raphael diese romantischen Märchen in Übersetzungen den Franzosen zugänglich mache, wobei ihn auch die Absicht leitet, die »Contes phantastiques« Hoffmanns, die inLoeve-Weimars Übersetzung ein großes Publikum fanden, (vgl. darüber den Bericht in der »Wiener Zeitschrift« vom Mai 1830, Nr. 58) aus dem Felde zu schlagen [* Vielleicht schwebte Schiff dabei Gerard de Nerval vor, der als Jüngling den »Faust« übersetzte und in seinen eigenen Werken den Einfluß Goethes, Uhlands, Bürgers und Tiecks wiederspiegelt.] Natürlich dachte Schiff weniger daran, den Franzosen den Geschmack an diesen Märchen beizubringen, als die deutschen Leser eindringlich darauf aufmerksam zu machen. Und so schwelgt er in geradezu dithyrambischen Verherrlichungen dieser wundersamen, blütenzarten Märchengebilde. Aber das nüchterne Publikum, dem Raphael sie vorliest, findet keinen Gefallen daran: die kleine Pauline und die große Feodora. zwischen denen ihn sein Liebesgefühl hinund hertreibt, lehnen – jede aus anderen Motiven – diese Märchennaivität ab. Ein materieller Erfolg ist für den schwer enttäuschten Vermittler deutscher Poesie in dem realistischen Zeitalter ebensowenig zu erreichen wie ein ideeller, er muß, wie es Mode war, Memoiren fabrizieren, die für echt gelten und um hohe Summen von den Verlegern gekauft werden. (Damals wurde gerade – woran wohl auch Balzac denkt – mit unterschobenen Memoiren viel Unfug getrieben: der Betrug mit den «Denkwürdigkeiten einer Frau vom Stande« und den »Memoirs d'un Pair de France et ex-Senateur« wurde eben aufgehellt.)
Erst als Raphael reich geworden ist, kann er wieder daran denken, seinen dichterischen Neigungen zu folgen. Goethes »Faust«fragment ist es diesmal, das er seinen Landsleuten in einer Übersetzung zugänglich macht. Aber auch jetzt bleibt ihm der Erfolg versagt: sogar seine Frau Pauline – die übrigens bei Schiff ihr verlorenes Vermögen nicht zurückgewonnen hat, sondern arm geblieben ist, wodurch sich eine recht deutsch-sentimentale Vereinigung eines reichen Mannes mit einem armen Mädchen ergibt – lehnt die Dichtung kühl ab [* Bei Balzac interessiert sich Raphael für russische Proklamationen und den Zaren Nikolaus, ein zweifellos realistischerer Zug als die Beschäftigung mit einer Dichtung. – Daß Schiff die uneheliche Verbindung Raphaels und Paulinens in eine eheliche verwandelt, zeigt, wie entscheidend er den Realismus Balzacs abschwächte.] Sie verweist ihn darauf, daß für ihn aus der Vertiefung in Dichtungen nie das Heil kommen könne, das ihm vielmehr nur aus der unbegrenzten Hingabe an das Christentum erblühen werde. Mit diesem begeisterten Preis der Lehre Christi schließt Schiffs Dichtung im Grunde genommen ab. Es ist ein wundersam versonnener Ausblick, den der jüdische Schriftsteller Schiff als echter Bekenner der romantischen religiösen Anschauungen eröffnet. Tiefstinnerliche Gläubigkeit spricht aus dieser Apostrophe, die zu zeigen bestimmt ist, daß alle Dichtung – vor allem ist selbstredend die realistische Balzacs gemeint – vor dem großen Werke Christi verblassen müsse. »Das Christentum ist im höchsten Sinne des Wortes die Poesie der Poesien, die Religion der Religionen, denn Religion und Poesie sind Glaube«. –
Mit diesem Bekenntnisse, das einem echten Gefühle Schiffs entsprang, – er hat es oft genug in anderen Dichtungen wiederholt – ist natürlich Balzacs Tendenz in das gerade Gegenteil verkehrt. Dieser läßt seinen Helden verzweifelt sterben, der deutsche Umdichter aber weist ihm den Weg zur Befreiung und Läuterung. Heine mag schuld daran sein, daß Schiff es sich mit diesem durchaus reinen und erhebenden Schlusse nicht genug sein ließ, sondern noch den zweiten anfügte, worin er sehr bizarr den Helden wieder zum Leben erweckte. Damit wollte er nur seine parodistischen Absichten verdeutlichen, die in vielen Einzelheiten der Novelle unverkennbar sind. So interessiert sich bei Balzac eine Episodenfigur für Bücher über Wasserbau; bei Schiff schwärmt sie für Hydraulik, aber nur insofern, als sie bei jeder Gelegenheit Tränen vergießt.
Wie Schiff Balzacs Tendenzen in der schroffsten Weise abändert, so verfährt er auch mit den Charakteren und der dichterischen Form seiner Vorlage. Bei ihm ist Raphael kein melancholischer Träumer, der das Liebesweh, das ihm Feodora bereitet, geduldig hinnimmt, sondern er ist ein brutal polternder Rächer seines gekränkten Mannesstolzes. In einer großen Gesellschaft zieht er die verräterische Geliebte zur Rechenschaft, indem er eine Analogiegeschichte vorträgt, aus der jedermann erkennen soll, daß sie einen Parallelismuszu seinem eigenen Lebensmißgeschicke enthalte. Schiff verkapselt in den Rahmen des »Elendsfell« Balzacs Novelle »Sarrasine«, der er den Titel »Zambinella« gibt – die Geschichte von dem unglücklichen Kastraten, in den sich ein junger Maler (bei Balzac ein Bildhauer) verliebt, den deshalb ein Gönner des Sängers, der Kardinal Cicognara, den Schiff Cicogna nennt, ermorden läßt. Nur recht gewaltsam läßt sich ein Zusammenhang zwischen den beiden Liebesabenteuern herausfinden, und Schiff mußte, um verstanden zu werden, eine lange Erklärung anführen, die indessen seinen Gedankengang nicht gerade klarer erscheinen läßt. –
Verbreiterte er «Das Elendsfell« durch diese Einschaltung beträchtlich, so war er andererseits geneigt, die schwersten Verkürzungen an Balzacs Darstellungen vorzunehmen. Dabei verfuhr Schiff rücksichtslos; er übersah die Feinheiten der psychologischen Ausmalung, die so sehr subtilster Strichelkunst gleichen, kümmerte sich nicht um die bis ins Kleinste vorschreitende Beobachtung der zartesten Einzelheiten und verstand es namentlich nicht, – was Balzac so meisterhaft konnte – aus Kleinigkeiten, die der Franzose seinen Frauengestalten absah, eine Welt von Wundern aufzubauen, aus denen diese zusammengesetzt sind. Schiff stand bei der Porträtierung von Frauen noch immer auf der Stufe, wie etwa die Scudery, die Schönheiten auf Schönheiten häufte, wenn sie ein weibliches Wesen beschrieb. Diese Methode kannte Balzac nicht, dem selbst kleine Monstrositäten, wenn sie nur pikant und apart wirkten. nicht ungeeignet erschienen, eine Frau im ganzen als schön erscheinen zu lassen. Solche extravagante Details verbannte Schiff regelmäßig: Frauen mußten bei ihm einem vulgären Romanschönheitsbegriffe entsprechen, um sein dichterisches Gefallen zu finden. Dies ist wieder nicht realistisch, sondern romantisch und bedeutet eine arge Verkennung der ihreWege gehendenSchilderungskunst Balzacs. –
In den »Lebensbildern« macht sich allenthalben diese schrankenlose Willkür geltend. Sie soll nicht an allen Erzählungen aufgezeigt werden – die den »Anhang« des Bandes bildende »Das Abenteuer« ist übrigens gar nicht Balzac nachgebildet – ein Beispiel wird Schiffs Verfahren genügend veranschaulichen. »Die Blutrache« (»La Vendetta«) sei zu diesem Zwecke herangezogen. Das Thema war Schiff außer durch Balzac von anderer Seite nahe gebracht. Er wird kaum des älteren Stefanie fünfaktiges Drama »Die Liebe in Korsika oder welch ein Ausgang« (Wien 1770) gekannt haben, sicherlich aber Chamissos Gedicht »Maleo Falcone« und das im »Morgenblatt« (1830. Nr. 61 – 64) veröffentlichte »korsische Sittengemälde« »Mateo Falcone«, möglicherweise Prosper Mérimées Novelle »Mateo Falcone« und dessen »Colomba«, die ein ähnliches Motiv wie Balzacs »Vendetta« enthält. Mit seiner Vorlage verfuhr Schiff in freiester Weise. Er machte aus dem brutalen, atemlos dem tragischen Ende zustrebenden Charakterdrama Balzacs eine rührselige deutsche Famllienkomödie, in der er alles nicht durchaus Stoffliche sorglos beiseite schob. Es mag hingehen, daß er von Luigi Portas Jugendtagen im Hause Colonnas nichts mitteilt. Aber charakteristisch ist es schon, daß Ginevra in der Nachdichtung nicht erst im Hause der Frau Servin Zuflucht sucht und dort eine arge Demütigung erfährt. Dieses Detail, dem Balzac sicherlich Bedeutung beimaß, erschien Schiff wohl als unnötige Kränkung des Mädchens. Dafür läßt er über dieses von dem Vater einen gräßlichen Fluch sprechen, während dieser bei Balzac nicht die Kraft zu einem Fluche aufbringt. Dieses Motiv war ältestes Gut der larmoyantesten Familienromanschreiber, erschien also Schiff für seine daran gewohnten deutschen Leser als kein unwirksames Rührmittel. Die Hochzeitsfeierlichkeit, die im Original wiederholt zu den peinlichsten seelischen Mißhandlungen Ginevras führt, schildert Schiff ganz knapp; wieder bäumt sich seine Sentimentalität gegen Verunglimpfungen des Mädchens auf. das bei ihm ungekränkt zum Altar geht. Auch die Jahre des ehelichen Zusammenlebens, das harte Aufreiben im Kampfe um Erwerb fehlt bei ihm vollständig. Gerade diese Szenen gehören aber zu den packendsten Eingebungen des französischen Dichters, der mit unerbittlicher Realistik jede Phase des ertötenden Ringens um des Lebens Unterhalt – sicherlich aus eigener Erfahrung – schildert. Wenn Schiff alle diese wesentlichen Einzelheiten fortläßt, versündigt er sich aufs schwerste an dem festgefügten Bau der Novelle Balzacs. Aber in dieser Form war sie ihm zu unheimlich wahr: daß man infolge des Mangels an dem Nötigsten zugrunde gehen könne, wollte er den an verlogene deutsche Romane, in denen Geldnot immer durch einen deus ex machina beseitigt wird, gewöhnten Lesern nicht erzählen. So bleibt also von der erschütternden sozialen Tragödie, in der zwei arbeitsfreudige Menschen, die nicht wie Gerstenbergs Ugolino in einen Hungerturm gesperrt sind, Hungers sterben, nichts übrig als eine in larmoyanter Empfindelei aufgehende Familiengeschichte. Ginevra und Luigi verspüren bei Schiff nicht des Lebens Grausamkeit: sie stirbt im Wochenbette. Daß Luigi, gerade als die Not am höchsten ist, zu Gelde kommt und jetzt seine Frau vor dem Hungertode erretten könnte – eine unheimlich tragische Szene voll unwiderstehlicher Kraft – kann Schiff natürlich nicht erzählen, wie er auch Luigi nicht vor Ginevras Eltern zusammenbrechen, sondern weiterleben läßt. In einer Hinsicht geht er weiter als Balzac; bei diesem wünscht Ginevra kurz vor ihrem Hinscheiden, daß ihr Gatte ihr Haar den Eltern überbringen möge. Bei Schiff wird dieser Wunsch der Sterbenden wirklich erfüllt, eine Szene, die der Verfasser sentimental ausspinnt.
Diese Gegenüberstellung von Balzacs Novellen mit den Überarbeitungen durch Schiff lehrt deutlich, daß man es bei diesem nur mit sehr schwachen Anlehnungen an die Originale zu tun habe. Aber es wäre verfehlt, Goedekes Behauptung zu wiederholen, daß Schiff diese Novellen unterschoben habe, um ihnen durch widerrechtliche Benützung von Balzacs Namen in Deutschland leichter Eingang zu verschaffen. Einmal war dieser – wie gezeigt wurde – in Deutschland nicht so bekannt, als daß sich daraus ein sicherer Erfolg ergeben hätte. Dann aber mußte Schiff, seiner ganzen Veranlagung zufolge, so verfahren, wie er es tat. Ihn leitete nur eine Absicht. Mit seinen schwachen Kräften wollte er dem Einbruche der aufkeimenden literarisch-realistischen Flut steuern. Rückkehr zur Romantik! tönt es unaufhörlich aus seinen Dichtungen. Der Romantik, die in Deutschland im sichtlichen Absterben begriffen war, mußte die neue Dichtung, die sich in Frankreich Boden bereitet hatte und von der mit Recht zu befürchten war, daß ihr dasselbe in Deutschland gelingen werde, den Todesstoß versetzen. Aufzuhalten war das Unheil vielleicht durch den frommen Betrug, den sich Schiff gestattete. Auf alles Ausländische horchte man ja in den Dreißigerjahren voll gespanntester Aufmerksamkeit. Und wenn ein französischer Dichter predigte, daß in den Werken der deutschen Romantiker alle künstlerische Freihelt und Schönheit vergraben liege, nach denen man in deutschen Landen dürstete, dann stand zu hoffen, daß die entblätterte Romantik doch wieder neue Blüten und Früchte treiben würde. Noch lebte ja ihr vollwertigstes dichterisches Talent, Schiffs heiß verehrter Meister Ludwig, und auch sein ergebenster Jünger – eben Schiff – stand bereit, im echt romantischen Sinne seine Stimme zu erheben. Es war eine Spekulation, die Schiff mit Balzacs Werken – weniger mit seinem Namen – trieb; aber sie entsprang durchaus ideellen Motiven, der entthronten Romantik wieder den Platz an der Sonne zu sichern. –
Die Spekulation mißlang völlig. Man schritt achtlos an den poetischen Forderungen des einsamen Schwärmers vorbei und ergötzte sich nur an dem rein Stofflichen, das man bei Balzac entdeckt hatte. Aus keiner Besprechung ersieht man, daß Schiffs klar ausgesprochene Gedanken erfaßt worden wären. Die »Jenaische Literaturzeitung« (1832, Nr. 235) z. B. schob die eingestreuten Reflexionen im »Elendsfell« verächtlich beiseite und berauschte sich nur an dem nackten Handlungsgerüste. – »Stets am Stoff klebt unsere Seele« – die verbitterte Klage des einsamen Lyrikers Platen könnte beinahe auch auf die allmählich einsetzende Wertung Balzacs in Deutschland Anwendung finden. Was Schiff aus und mit ihm gemacht hatte, ging fast spurlos vorüber. Zum Bekämpfer seiner eigenen Anschauungen eignete sich Balzac wohl am allerwenigsten.
Wenn er im »Chagrinleder« einen Hoffmann abgelauschten Zug anbrachte, so war er dennoch gewiß kein Nachfolger deutscher romantischen Tradition, von der ihn in seinem Dichten so gut wie alles trennte. Deshalb war Schiffs gut gemeinter Betrug durchaus fehl am Orte. Was er bekämpfen wollte, dem öffnete er unfreiwillig Tür und Tor. Sein Eintreten für die Romantik war kaum ein Eintagserfolg; man kümmerte sich weiter nicht darum, hielt sich bloß an die effektvollen Begebenheiten, die der Franzose schilderte, und begehrte stets mehr davon.
Balzacs Sieg wurde in Deutschland nach Schiffs Verfälschungen vollständig. Die große Übersetzungsflut brach nach des begeisterten Romantikers Verkünstelungen herein und bewirkte, daß die guten Deutschen, ohne durch unangebrachte literarische Forderungen und Theorien, wie sie Schiff hinemverflochten hatte, behelligt zu werden, ihren Balzac, wie er war, verdeutscht erhielten. Nun rückten sie alle an, die gewerbsmäßigen Übersetzer, die froh genug waren, wenn sie einen französischen Autor in ein schlechtes deutsches Gewand stecken konnten, die oft nur recht mühsam eine wirkliche Übertragung zustande brachten, selten bis zu den tieferen Gedankengängen des Ausländers vordrangen und gewiß diesen niemals umzuarbeiten versuchten. Von solchen Ideologien, wie sie nur ein romantischer Phantast vom Schlage Schiffs wagen konnte, hielten sich die phantasielosen (und oft ach! so geistlosen) Übersetzer alle fern. Sie waren trockene Pedanten, die am Worte klebten, wie Theodor Hell, der schon 1833 den »Grafen Chabert« in ein mühseliges Deutsch übertrug, wofür ihm Laube in der »Zeitung für die elegante Welt« (1833, Nr. 148) in der ungestümen Weise seiner draufgängerischen Jugend mit Recht den Text las [*1836 übertrug Hell »Seraphita«; dasselbe Werk in demselben Jahre ein F. von R. (Stuttgart)] : der Vielschreiber O.L. B. Wolff und die Vlelschreiberin Fanny Tarnow durften nicht zurückstehen und ließen «Neue Erzählungen« (Leipzig 1833) und »Eugenie« (»Ein Genrebild« schrieb sie geschmackvoll darunter; Leipzig 1835) erscheinen. »Vater Goriot« wurde von einem Friedrich von R. »ein Familiengemälde aus der höheren (!) Pariser Welt« genannt (Stuttgart 1835), dem «Israeliten« pfropfte ein Or...n (Leipzig 1840) ein gedankenloses Nachwort auf, »Le Médicin de campagne« erschien (Berlin 1837) in einer durch Karl von Lützowbewerkstelligten Form, in der man das Original kaum wiedererkennen kann« [* Nicht besser ist eine Übersetzung von Alexander Gonzaga (?), 1836, Seite 283 ff. in der Prager Zeitschrift »Erinnerungen«.] »Balzacs erzählende Schriften, teutsch bearbeitet von Friedrich Seybold (Stuttgart und Leipzig 1836) sind unkünstlerische, mechanische, von Gallizismen strotzende, jedem feineren deutschen Sprachgefühle hohnlachende wörtliche Wiedergaben, denen nur das eine nachzurühmen ist, daß sie darauf verzichten, Balzac willkürlich umzuarbeiten. Dieses Urteil trifft auch die bei Gottfried Basse (Quedlinburg und Leipzig 1845) erschienene Ausgabe von »Honoré de Balzacs sämtlichen Werken«, die nur eine bescheidene Auslese alles dessen, was wir von Balzac besitzen, enthält.
Außer diesen Buchübertragungen (von anderen, wie »Die alte Jungfer«von L. Frey, Breslau 1838, »Beatrix«, anonym. Wesel 1840, »Der Gewürzkrämer« und «Die Musterdame«, beide anonym, Stuttgart 1839, unter dem Gesamttitel »Die Franzosen der neuesten Zeit«, spricht man am besten gar nicht), gibt es viele in Zeitungen erschienene, die meistens nur arge Versündigungen am Werke Balzacs bedeuten. In der Zeit der ungeschützten Übersetzerbefugnis machte sich eben jeder halbwegs des Französischen Mächtige daran, den wundervollen Stilkünstler Balzac barbarisch, ohne jedes tiefere Eingehen auf seine nuancierten Eigenheiten dem deutschen Publikum vorzuführen. So entstanden Übersetzungen, wie die in den von schamlosestem Nachdrucke und widerrechtlichen Ubersetzungen lebenden »Lesefrüchten«, die Dr. Pappe in Hamburg durch mehr als 30 Jahre herausgab. Hier findet man »Ein grausames Geschick« (1841, III. Band, Seite 241 ff.), den famosen »Gobseck« (von Schiff ausgezeichnet mit »Trockenschling« in dem Lebensbild »Der Geizhals« übersetzt), der den urbanalen Titel »Die Gefahren einer schlechten Aufführung«, womit die triviale Mache dieser Übersetzung genügsam charakterisiert ist, bekommt (1841, III. Band, Seite 241 ff.) und »Zwei Träume« (1843, IV. Band, Seite 209 ff.). All diese jämmerlichen Übertragungen Balzacs konnten den Deutschen, die den großen Romandichter nicht in seiner Sprache lasen, nur schwache Begriffe seiner machtvollen Kunst eröffnen. Aber sie waren, so unerträglich sie samt und sonders heute anmuten, noch immer erträglicher als die kritischen Beurteilungen, denen Balzac in Deutschland ausgesetzt war. Was die »Blätter für literarische Unterhaltung« zweimal sagten (1835, Seite 27 ff. und 1837, Seite 110), war wenigstens von dem ehrlichen Willen erfüllt, auf des französischen Dichters Intentionen einzugehen. Aber abgeschmackt und lächerlich wirken Charakteristiken, wie die im Berliner »Freimütigen« (1833, Nr. 55; dieerste eingehendere, die überhaupt in Deutschland erschien, und die deshalb ihren historischen Wert besitzt) oder im »Literaturblatte des Morgenblattes« (1836, Nr. 76). Dort meinte W. von Lüdemann von Balzac: »Balzac mit seiner sinnlich-tiefen, philosophisch-phantastischen, erschütternd-lehrreichen Erfindungsgabe! Balzac gehört wie Sue zu den Verzweifelnden, die die menschliche Gesellschaft für rettungslos halten, während V. Hugo, Janin und andere zu den Triumphierenden gehören. Nirgends ist Ruhe, Trost – Wut, Erschöpfung, Haß teilt sich in seinen Empfindungen. Nirgends Menschen, überall Wahnsinnige! So tritt er in seinen »Contes philosophiques« hervor – diese höchste Steigerung aller Seelenkräfte erfüllt uns mit Ekel, aber mit einem solchen, der nahe an Bewunderung streift ...« Im »Literaturblatte« holte Menzel weit derber aus: er warf Balzac Schriftstellereitelkeit vor; unklar und verwässert sei alles, was er geschrieben habe; er hätte ein ausgezeichneter Romanschriftsteller werden können, wenn er statt Studium und Fleiß zu üben, nicht 37 Bände in sieben Jahren geschrieben hätte. Und nur eines freute Menzel, daß Balzac trotz seiner Unsittlichkeit und das Herz empörenden Schilderungen nicht so arg sei wie die Sand, Janin und andere; denn er stelle das Schlechte als schlecht, das Gemeine als gemein dar, und er stelle nur deshalb dem Laster keine Tugend gegenüber, um die Wahrheit desto eindringlicher zu machen, daß die Verdorbenheit wirklich herrsche und nicht bloß drohe ...
Gegen derartige kleinliche, uneinsichtsvolle Urteile heute, da sich Balzac völlig durchgesetzt hat, nur ein Wort der Erwiderung oder der Erklärung vorzubringen, wäre wohl gänzlich unangebracht. Diese oberflächlichen, den Gedankengang Balzacs so schwer verkennenden »Verdammungen« beweisen ebenso wie Schiffs Verfälschungen nur eines, daß man nämlich in den Dreißigerjahren kaum ahnte, worin die überragende Bedeutung des kraftvollen Realisten liege, und daß man damals in sentimentalen Schwärmereien noch viel zu sehr befangen war, um eine Kunst zu verstehen, die sich auf neuen Bahnen bewegte, die Schminke und Retusche gründlich verachtete, die sich von jeder lügenhaften Konvenienz freizuhalten wußte. Damit konnte man in Deutschland nichts beginnen und nicht fertig werden. Aus der Welt schaffen ließ sich dieses »Übel« nicht; so gingen die einen daran, Balzac dem Tagesgeschmack der großen Menge gefügig zu machen, die anderen, ihn totzulästern. Vergeblich war eines wie das andere – Balzac war stark genug, selbst deutsche Schwerfälligkeit zu überwinden und den Boden urbar zu machen, auf dem nach ihm die Größten unserer Zeit ackerten. Wenn Emil Zola in der großen Genealogie der »Rougon-Macquart« im Rahmen einer Familienentwicklung die politische und soziale Geschichte seines Zeitalters darzustellen suchte, so dankte er die Idee seiner Konzeption niemand anderem als Balzac, der ihm mit der Zusammenfügung aller seiner Novellen in das große Gebäude der »Comédie humaine« Mut für sein gewaltiges Beginnen gemacht hatte. Wie Balzac für Zola oft bis auf die einzelne Phrase herunter in Stil und Vortrag von weitestreichendem Einflusse wurde, so lebte der Grundgedanke seines kühn ausholenden, leider nicht zu Ende geführten Unterfangens in dem Werke des Größeren machtvoll wieder auf. So ward aber auch seine dichterische Tat dem Los des Vergessenwerdens entrissen. Balzacs Werk und Ruhm besteht – die Minierarbeit der Kleinen, die sich daran zu erproben versucht hatte, ward zuschanden.
Man braucht deshalb Hermann Schiffs Unterfangen, so erfolglos es war, nicht verächtlich zur Seite zu schieben. Es war ein Versuch mit untauglichen Mitteln, zu unrichtiger Zeit, an einem unrichtigen Objekte. Aber die Balzacverfälschungen Schiffs waren getragen und beeinflußt von deutschem Idealismus, der, wie so oft vorher und nachher, die nächstliegenden Realitäten übersah, der völlig verkannte, daß einer mächtig einsetzenden neuen literarischen Richtung durch die kleinlichen Mittel des Betruges nicht beizukommen sei. Nur zu kurze Zeit konnte der deutsche Pseudobalzac dem echten die Wege verrammeln. Dieser vernichtete mit heißer Jugendkraft die vor ihm aufgetürmten Barrikaden und trat auch in Deutschland seine Siegeslaufbahn an.
Übrigens: Schiff scheint nicht der einzige gewesen zu sein, der Balzacs Namen widerrechtlich usurpiere. In Brüssel ward Ähnliches unternommen, wovon die »Grenzboten« (1843, II. Band, Seite 1499) zu erzählen wissen. Im »Tagebuch« (Rubrik: Aus Berlin. II) heißt es: »Eine hübsche literarische Anekdote ist folgende, um so hübscher, als sie nicht erfunden, sondern wirkliches Faktum ist. – Der letzthin in Berlin anwesende Balzac machte Tieck einen Besuch. Letzterer sprach mit ihm von seinen Schriften und lobte als ganz vorzüglich › Le vicaire des Ardennes‹ und › Annette et le Criminel‹. ›Sie haben wahrscheinlich meine Schriften im Brüsseler Nachdruck gelesen?‹ fragte Balzac. ›Ich glaube, ja!‹ antwortete Tieck. ›Es muß wohl sein,‹ erwiderte jener, ›denn die beiden Romane sind gar nicht von mir, und die Brüsseler Nachdrucker [*Die Schamlosigkeit des Brüsseler Nachdruckes ging ins Ungeheuerliche. 1829 wiesen die Pariser Buchhändler in einer Bittschrift darauf hin, daß ein Brüsseler Nachdrucker von 1825 bis 1827 allein 318615 Bände im Werte von 1183515 Franken nachgedruckt habe (»Morgenblatt« 1829, Nr. 234)] haben bloß auf meinen Namen spekuliert und sie unter demselben herausgegeben, um Absatz zu finden [* Beide Werke gehen noch immer – vgl. die »Édition du Centenaire«, bei Calman Lévy – unter Balzacs Namen und sollen aus den Jahren 1822 und 1824 stammen] . Ich habe die Sache für unbedeutend gefunden, um dagegen zu reklamieren. Jetzt, da ein berühmter deutscher Autor sie als meine besten Werke erklärt, werde ich wohl öffentlich protestieren müssen.«
Balzac hat den angekündigten Protest niemals erhoben, wie er auch gegen Schiffs Verfälschungen niemals etwas unternahm. Ob er sie jemals zu Gesichte bekam, ob sie ihm mißfielen, ist nicht bekannt geworden. Sie waren ein literarisches Kuriosum, das, anders erdacht als es wirkte, jedenfalls den historischen Vorzug hat, Balzacs Dichtung, wenn auch in gründlich veränderter Form, in Deutschland zum ersten Male zur Geltung gebracht zu haben.