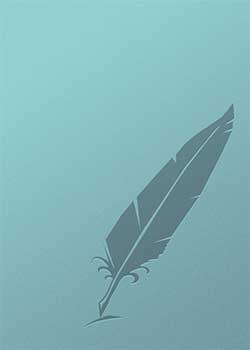Читать книгу Lebensbilder - Оноре де Бальзак - Страница 5
Hermann Schiff
ОглавлениеZu Eckermann äußerte sich Goethe einmal: »Der persönliche Charakter des Schriftstellers bringt seine Bedeutung beim Publikum hervor, nicht die Künste seines Talentes. Napoleon sagte von Corneille: ›S'il vivait, je le ferais Prince‹ – und er las ihn nicht. Den Racine las er; aber von diesem sagte er es nicht. Deshalb steht auch der Lafontaine bei den Franzosen in so hoher Achtung, nicht seines poetischen Verdienstes wegen, sondern wegen der Großheit seines Charakters, der aus seinen Schriften hervorgeht.« – Damit hat Goethe allen Literaten, deren Charaktere anfechtbare Züge aufweisen, das Todesurteil gesprochen. In dieser Allgemeinheit trifft indes die Behauptung nicht zu, und Goethe selbst hat ja dem unglücklichen Johann Christian Günther, dem sein Leben wie sein Dichten zerrann, nachdem er schon als Leipziger Student Günthers dichterischen Spuren gefolgt war, ein Erinnerungszeichen gewidmet, das den Unglücklichen, in seinem Leben sicher nicht ganz Einwandfreien keineswegs in Grund und Boden verdammt. Aber mit kleinen Einschränkungen trifft Goethes Anschauung zweifellos das Richtige; der persönliche Charakter der Schriftsteller entscheidet sehr oft die Bewertung nicht nur bei der Kritik, sondern auch bei der Menge. Heine und Grabbe leiden unter dieser moralisierenden Einschätzung beträchtlich, und ihr völliges Durchdringen ist in Deutschland noch immer durch die Tatsache erschwert, daß ihr Lebenswandel nicht allgemein gültigen Sittlichkeitsbegriffen entspricht. Die Einbeziehung des moralischen Wertes eines Schriftstellers bei seiner ästhetischen Beurteilung ist unschwer verständlich; da die große Menge ein Buch nicht nur als Bildungs-, sondern auch als Erziehungsmittel betrachtet, erwählt sie zur Lektüre immer lieber das eines gefesteten, einwandfreien als das eines anrüchigen oder auch nur verdächtigen Charakters. Daß dabei nur allzuoft blasphemisches Spießbürgertum das maßgebendste Urteil spricht, mag bedauerlich sein; verkennen und übersehen läßt sich diese Wahrheit nicht.
Sie ist die stichhaltigste Erklärung für die völlige Ignorierung des Balzacumdichters Hermann Schiff, der vielleicht von den tragischesten Verhängnissen heimgesuchten dichterischen Persönlichkeit Deutschlands. Soviel Elend hat das Schicksal selten über einen deutschen Dichter gebracht, von denen ja auch sonst viele nicht gerade Schoßkinder des Glückes waren und sind. Aber im Erdulden des fast kettenartig geschlossen über ihn hereinbrechenden Ungemachs übertrifft Schiff sie alle, wie bös den andern auch Mühsal und Jammer mitgespielt haben mögen. Im Leben wie nach dem Tode blieb ihm nichts erspart von all dem Leid, das Menschen treffen kann. Gewiß schloß sich auch für andere Dichter die Pandorabüchse nicht früher, als bis sie alles über sie geschüttet hatte, was jenen an Not und Qual zugedacht war. Jedoch die meisten führten wenigstens ein glücklicheres Leben nach dem Tode, indem ihnen eine gerechtere Nachwelt das zu vergelten suchte, was die Mitwelt schmählich versäumt hatte. Schiff ist bisher auch diese Ehrenrettung versagt geblieben; er wird nur selten genannt; und wo es geschah, waren Böswilligkeit; Verkennung, Urteilslosigkeit und Fahrlässigkeit zur Stelle, um auch noch des Toten Namen zu verunglimpfen.
Nun ist Schiff zweifellos kein Charakter gewesen, der subtilerer moralischen Begutachtung standhielte. Und in vollem Maße trifft auf ihn der Ausspruch Goethes zu, daß der persönliche Charakter des Schriftstellers seine Bedeutung beim Publikum hervorbringe. Wenn Schiff deshalb heute vergessen ist und nicht mehr gelesen wird, wie er eigentlich auch zu seiner Zeit nicht allzuviel gelesen wurde, so ist das von Goethes Standpunkte aus und vieler anderen Umstände wegen begreiflich. Aber viel zu hart ist es, wenn die repräsentativste Persönlichkeit der deutschen Literaturwissenschaft, Karl Goedeke, – schroff wie sonst niemals – über ihn den Stab bricht, ihn beweislos einen Zuchthäusler nennt und zu den verkommenen Genies rechnet. Denn das war Schiff nicht. Die gewissenhaftesten Nachforschungen und die amtlichen Bekundungen all der Behörden, mit denen Schiff zu tun hatte, beweisen, daß er niemals in Korrektionshäusern saß. Er hat dreimal kleine Anstände mit der Leipziger Polizeibehörde gehabt (welcher politische Schriftsteller hatte solche im Vormärz nicht?) und wurde in Hannover wegen Ehrenbeleidigung eines literarischen Gegners zu einer dreiwöchigen Arreststrafe verurteilt. Das ist alles, was ihm nachgewiesen werden kann. Schiff war gewiß ein zügelloser Mensch, ein Phantast, ein schwacher Charakter voll der bizarrsten Schrullen und Launen; aber er saß keine Sekunde im Kerker, wenn auch die Hamburger Polizei, der er wegen seiner Eigenheiten sehr unbequem war, es versuchte, ihn festzusetzen. Damit war Schiff großes Unrecht widerfahren, und er mußte nach kurzer Haft wieder freigelassen werden, hat also nicht, wie Goedeke meint, »meistens in Polizeihaft gelebt«, wie er auch nicht im Armenhause gestorben ist.
Goedeke teilt leider nicht mit, woher er seine für Schiff diffamierenden Nachrichten bezog. Das ist um so beklagenswerter, als seine Angaben in allen Kompendien, die Schiffs Namen erwähnen, Aufnahme gefunden haben. Niemand, der Goedekes Ausführungen nachdruckte, nahm sich die Mühe, die Berechtigung der erhobenen Anklagen zu erforschen. Kritik- und bedenkenlos wurden sie abgeschrieben; nur Adolf Bartels machte in seinem »Handbuch der deutschen Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts« einen knappen Zusatz, worin er Goedeke naiv nennt, weil dieser meinte, die Juden hätten mit Schiffs unmoralischem Lebenswandel nichts zu tun. Es wäre verdienstlicher gewesen, wenn Bartels Goedekes Bericht erst nachgeprüft hätte, ehe er sich zu der doppelten Verurteilung Schiffs und Goedekes entschloß.
Jedenfalls erhellt schon aus der Berichtigung dieser weittragenden falschen Mitteilung Goedekes, daß seine Schiffbiographie (wie alle andern bisher erschienenen, die sämtlich mehr oder weniger wörtliche Paraphrasen der Goedekeschen sind) nicht stichhält. Deshalb soll hier eine neue gegeben werden, die sich bemüht, alle Schiffs Namen anhaftenden falschen Behauptungen aus der Welt zu schaffen und ein richtiges Porträt dieser durchaus originellen und beachtenswerten Persönlichkeit zu entwerfen. Es wird sich zeigen, daß damit nicht nur einem mit Unrecht vergessenen Schriftsteller die verdiente posthume Ehrenrettung zuteil wird (die sich freilich von jeder Überschätzung sorgfältig fernhalten wird), sondern daß auch ein bedeutungsvoller Zeitraum deutscher literarischen Entwicklung nach verschiedenen Seiten hin neue Belichtung erfährt. Für die Geschichte der deutschen Romantik – dies sei vorweg hervorgehoben – ist die Darstellung der schriftstellerischen Laufbahn Schiffs von besonderer Bedeutung.
In einem reichen jüdischen Kaufmannshause zu Hamburg wurde David Bär [*Den Vornamen Hermann bekam er erst mit vierzig Jahren bei der Taufe; als Schriftsteller führte er ihn schon früher] Schiff am 23. April 1801 geboren [*Die Angaben aller Handbücher, die Schiffs Namen nennen, geben einen falschen Geburtstag und auch sonst unrichtige Daten in Hülle und Fülle an. Im einzelnen verweist diese Darstellung, die durchwegs im Hamburger Staatsarchive aufbewahrtes Aktenmaterial benützt, für dessen Überlassung den Herren Beamten an dieser Stelle herzlichst gedankt sei, nicht auf alle von einem Buche in das andere hinübergeschleppten Fehler, schon weil dies zu weitläufig wäre, sondern verbessert diese stillschweigend. In vielen Fällen war Schiff selbst an der Entstehung von Irrtümern schuldtragend. In autobiographischen Angaben sind ihm arge Gedächtnisfehler und Verwechslungen unterlaufen; auf solche wird gelegentlich aufmerksam gemacht] – . Väterlicher- und mütterlicherseits stammte die Familie aus dem damals noch dänischen Altona. Ein Onkel des Dichters war Günstling des Dänenkönigs, dem zu Ehren er Synagogenfeste veranstaltete, wofür er der königlichen Tafel beigezogen wurde. Der Großvater war zweimal verheiratet, in zweiter Ehe mit seiner Schwägerin Mathe (Mathilde), die aus erster Ehe mit Löb Heine sechs Kinder hatte, darunter Samson Heine, den Vater des Dichters. David Bär Schiff war also nicht, wie man immer wieder liest, ein Vetter Heinrich Heines, sondern nur ein solcher zweiten Grades, außerdem aber, wenn man in Betracht zieht, daß der beiden Väter Stiefbrüder waren, ein Stiefvetter. Soviel zweifellos Richtiges ergibt sich aus einer sonst sehr mit Vorsicht zu benutzenden Schrift Schiffs »Heinrich Heine und der Neuisraelitismus« (Hamburg 1866), die schon Adolf Strodtmann in seiner Heinebiographie (I, 355, Anmerkung 1 und I, 368, Anmerkung 111) an entscheidenden Punkten berichtigen mußte.
Ein vertrauterer Umgang zwischen Heine und Schiff in ihrer Knabenzeit war nicht nur infolge der Verschiedenheit der Aufenthaltsorte ausgeschlossen. Schiffs Vater war damals sehr wohlhabend, während der Heines bekanntlich nicht gerade reich war. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die verschiedenartige soziale Lage die beiden Stiefbrüder, die auch Vettern waren, von vertrauterem Umgange abhielt. Denn nirgends findet sich ein Hinweis, daß irgendeine nähere Beziehung zwischen Samson Heine und Hertz Bendix Schiff (dem Vater von David Bär) stattgefunden hätte.
Das Glück blieb indes Schiffs Vaterhause nicht treu; der Vater scheint zugrunde gegangen zu sein (worüber Schiff selbst gelegentlich Andeutungen macht.) Aus sehr gewissenhaften Nachforschungen J. Heckschers (in den »Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde«, Heft XVI, Seite 124) geht hervor, daß Schiffs Vater seit 1828 sein Manufakturwarengeschäft nicht mehr betrieb, von Jahr zu Jahr seine Wohnung wechselte (vielleicht weil er die Miete nicht bezahlen konnte) und 1840 in Wandsbek starb. Fünf Jahre vor ihm war seine Frau heimgegangen, ein von dem Dichter, der gleich Heine auf das zärtlichste an seiner Mutter hing, tiefbeklagter Verlust!
Die Hamburger Jugendjahre sind für Schiff von der größten Bedeutung gewesen. Er besuchte das Johanneum (von den Lehrern rühmt er namentlich Gurlitt), von 1821 – 1822 das akademische Gymnasium. Ostern 1822 ging er an die Universität Berlin ab, um dort Jura zu studieren. Er hat also verhältnismäßig lange zur Absolvierung des Gymnasiums gebraucht. Vielleicht war schon damals seine exzentrische Natur schuld, daß er erst spät zum Abiturium kam, vielleicht war er durch burschenschaftliche Bestrebungen, die damals in Hamburg eine große Rolle spielten, zu sehr abgehalten, um seine Pflichten als Gymnasiast zu erfüllen. Er berichtet wiederholt, daß er sich damals mit burschenschaftlichen Fragen beschäftigte, den breiten altdeutschen Kragen trug und sein Deutschtum immer stolz betonte. Damals war Schiff – recht im Gegensatze zu Heine – ein Franzosenfeind, was vielleicht sein Vater bewirkt hatte, der, wie Schiff selbst erzählt, mit Heines Vater wegen dessen Franzosen-Freundlichkeit oft in scharfe Dispute geriet. Allerdings waren bei beider Zu- und Abneigung sehr persönliche Interessen im Spiele. Samson Heine stand auf Seite der Franzosen, weil diese den Juden die Gleichberechtigung gewährt hatten, Hertz Bendix Schiff war jenen gram, weil er während der Hamburger Belagerung durch Davoust starke geschäftliche Verluste erlitten hatte. So schwärmte auch der junge Schiff für die deutschen Studenten, die dem Vaterlande die Befreiung von dem französischen Joch erkämpft hatten; und noch in seinem späten Alter gedenkt er der herrlichen Tage, als man das Deutschtum und die Freiheit besang, sich an Liedern und Schriften der Patrioten berauschte und sich in der begeisterten Verehrung der Romantiker gefiel. Aus dieser jugendlichen Schwärmerei hat Schiff die nachhaltigsten Anregungen für seine spätere Dichtung empfangen. Man pflegt ihn spöttisch den »letzten Romantiker« zu nennen; aber er ist sicherlich ein durchaus echter Romantiker, in seinem Dichten ebenso wie leider – in seinem Leben, in das er immer romantischen Überschwang hineinzutragen liebte.
Dieses Aufgehen in romantischen Ideen und das unbedingte Bekenntnis zum Deutschtum berührt bei Schiff wegen seiner jüdischen Abkunft merkwürdig. Er hat indes vor keiner Forderung der Romantiker haltgemacht; sogar ihr extremes Hinneigen zum Katholizismus ist auf ihn völlig übergegangen. Das kann sehr wohl der Umgang in seinen Jugendjahren und die Erziehung im väterlichen Hause veranlaßt haben. Denn Schiff hat – wie er selbst erzählt – niemals hebräisch gelernt und nie ein jüdisches Gebet gesprochen. Von der Synagoge wurde er ferngehalten, dagegen war es ihm nicht verwehrt, am christlichen Religionsunterrichte teilzunehmen. Allerdings war die große Judenverfolgung, die er 1819 in Hamburg mitmachte, nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben: aber dieser war nicht stark genug, um Schiff seiner Religion näher zu führen oder ihn gar zum frommen Juden zu machen.
Dieser Judensturm findet in Schiffs Altersdichtung, als er selbst Christ geworden war und dem Judentum skeptisch und kritisch gegenüberstand, oft Erwähnung, wie auch Heine seiner voll Erbitterung in einem Briefe an Sethe gedenkt. Sehr bedeutend waren diese Krawalle nicht gewesen; man hatte den Juden die Fenster eingeworfen und prügelte sie; ein behördliches Plakat, das mit dem scharfen Schießen der Garnison drohte, brachte die Bewegung nach zwei Tagen zum Abschlusse. Den jungen Schiff haben diese Exzesse, obwohl er sie aus der Nähe besehen konnte, nicht sonderlich berührt, da er ganz in seinen altdeutschen Ideen aufging.
Als er Ostern 1822 in Berlin einzog, stand dort die Romantik noch in hohem Ansehen. E. Th. A. Hoffmann, der bereits auf dem Krankenlager hinsiechte und nicht viel später starb, wird er nicht mehr kennen gelernt und den überwältigenden Reiz dieser eigenartigen Persönlichkeit nicht mehr eingesogen haben. Aber die Unterhaltung in den studentischen Kreisen, deren Teilnehmer Schiff war, wird sich stark um Hoffmann gedreht haben. In Rahel Varnhagens Haus könnte er gekommen sein. In Varnhagens Tagebüchern findet sich – zwar aus späteren Jahren – sein Name wiederholt, und das Interesse, das dieser an dem Schicksal und einzelnen Werken Schiffs nimmt, ist doch wohl nur daraus zu erklären, daß er Schiff in Berlin kennen gelernt hatte. Ein Verkehr in dem gastlichen Hause Rahels ist um so wahrscheinlicher, als Schiff in Berlin mit Heine zusammentraf und mit diesem sogar – wenn man ungedruckten Erinnerungen Schiffs glauben will, die eine Fortsetzung seines Buches »Heinrich Heine und der Neuisraelitismus« bilden und Adolf Strodtmann vorlagen [*Vgl. seine Heinebiographie I, 164]– 1822 in einem Hause (es ist das Schlesingersche Unter den Linden, unfern dem Palais des Prinzen Wilhelm) Stube an Stube wohnte. In dieser Zeit des gemeinsamen Berliner Aufenthalts bestand zwischen den beiden jungen Leuten jedenfalls ein lebhafter Verkehr; Heine trug Schiff das Du-Wort an und bediente sich oft seiner Kasse [* »Heinrich Heine und der Neuisraelitismus«, Seite 56 und 98] . Auch die poetischen Erstlinge Schiffs, die Phantasiestücke in Callots Manier gewesen sein sollen[* ibidem; erhalten ist nichts davon] , ließ er sich vorlesen, bewunderte an ihnen »echten Naturmystizismus« und nannte sie das Beste, was in neuester Zeit geschrieben wurde, mit Ausnahme von dem, was er selbst geschrieben hatte. Diese Mittellungen Schiffs müssen nicht unbedingt zuverlässig sein (sie stammen aus dem Jahre 1866); und aus Briefen Heines an Freunde geht sogar hervor. daß er über ihn nicht gerade günstig dachte [* Vgl. den Brief an Moses Moser vom 17. Mai 1824 aus Göttingen (in der Ausgabe der Werke Heines von Karpeles VIII, 420), worin er Schiff einen »Kerl« nennt, der ihn nochmals um Briefporto bringen werde. Freundschaftliche Gefühle verrät diese Briefstelle wohl nicht] . Vielleicht verstimmten ihn schon damals Schiffs exzentrische Neigungen, die im Keim sichtbar waren und ihn als Stichblatt aller mehr oder weniger bösen studentischen Witze sehr geeignet erscheinen ließen [*Eine charakteristische Anekdote teilt Strodtmann a. a. O. I, 322 mit] .
Am 28. Oktober 1824 wurde Schiff in Jena inskribiert. (Eintrag im »Akademischen Album der Jenaer Universitat«). Er studierte Jura, reichte aber 1825 bei der philosophischen Fakultät eine Dissertation »De natura pulchri et sublimis« ein, auf Grund deren er am 8. Juli 1825 unter dem Dekanate des Geheimen Hofrates Dr. Luden zum Doktor der Philosophie promoviert wurde. (Vgl. Intelligenzblatt der Jenaer Literaturzeitung, 1825, Nr. 61, Seite 483). In Göttingen hat Schiff niemals studiert; alle diesbezüglichen Mitteilungen sind unrichtig, über den Inhalt der Dissertation laßt sich nichts Zuverlässiges mitteilen; aber aus einer autobiographischen Novelle Schiffs, »Der Fibel-Philosoph« (im »Novellenbukett« 1858) geht hervor, daß er sich als Student in Schillers Abhandlung »Über das Erhabene« (er nennt sie »Über das Schöne und Erhabene«) vertieft habe; und es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Untersuchung Schiffs von der Schillers ihren Ausgang nahm. –
Nach der Promotion begab sich Schiff nach Leipzig, um dort als freier Schriftsteller zu leben. Leipzig halte damals als Zentralsitz des deutschen Buchhandels für junge Literaten seine besondere Anziehungskraft. Gutredigierte Zeitschriften ließen den Aufenthalt ebenfalls angenehm erscheinen. Für Schiff, dessen materielle Lage nicht mehr so günstig gewesen zu sein scheint wie während der Berliner Studentenjahre, da der Vater inzwischen sein Vermögen verloren haben dürfte, ergab sich die Notwendlgkeit, da er als Jude zu keinem staatlichen Amte gelangen konnte, von schriftstellerischer Produktion zu leben. Er setzte quantitativ gleich sehr lebhaft ein; drei größere Werke in Buchform sind die Frucht seines ersten Leipziger Aufenthaltes vom Ende 1825 bis Ende 1826. Außerdem redigierte er eine Monatsschrift »Dichterspiegel«, die freilich sehr kurzlebig war, und von der sich leider auch nicht ein Exemplar erhalten hat. Mitredakteur war Wilhelm Bernhardi, der Neffe Tiecks, Sohn seiner Schwester Sophie, Schiffs steter Begleiter auf seinen verschlungenen Lebenspfaden. Immer wieder begegnen die beiden wesensverwandten Naturen gemeinschaftlich. Sie waren beide in romantische Schrullen verrannt, verkannten sehr bedeutungsvoll die tiefliegenden Unterschiede zwischen romantischem Empfinden und romantischer Lebensführung, und beide gingen an dieser argen Begriffsverwirrung zugrunde. Beider äußeres Leben war wüst und exzentrisch; sie glaubten an eine Durchsetzung des Lebens mit romantischen Irrlehren – denn allzu geordnet waren auch ihre dichterischen romantischen Anschauungen nicht – und hofften, diesen zum Siege zu verhelfen, wenn sie sich wild, verwegen und von keinem Lebenszwange beengt gebärdeten. Leben und Dichten sollten eine Einheit bilden, wie es schon die Schlegel jugendlich-ungestüm gefordert hatten. Aber nicht aus innerer Übereinstimmung und veredelter Abgeklärtheit sollte diese innige Vereinigung erwachsen, sondern aus trotziger Auflehnung gegen alles Hergebrachte, ja, gegen die einfachsten Anstandsbegriffe.
Man wird weder Schiff und noch weniger den ganz unproduktiven Bernhardi deshalb mit Grabbe vergleichen dürfen. Diese Einheit von Leben und Dichten, die Schiff erträumte, herstellen zu wollen, war nur der Gedanke eines Phantasten; ein Märtyrer seiner Kunst war Schiff nicht. Ihm könnte kein Freiligrath nachrufen:
»Der Dichtung Flamm' ist allezeit ein Fluch! ...
Durch die Mitwelt geht
Einsam mit flammender Stirn der Poet;
Das Mal der Dichtung ist ein Kainsstempel!«,
weil ja das dichterische Schaffen für Schiffs zügelloses Leben nur ein Vorwand war, während sein Leben seine Dichtung nicht bedingte. »Riesen-« oder »titanenhaft« ist Schiffs Aufbäumen gegen des Lebens Notwendigkeiten kaum zu nennen; es waren nur Versuche eines ungezügelten Menschen, sich über alles Hergebrachte hinwegzusetzen und unangefochten tolle Streiche zu begehen.
Leider war Schiff zeitlebens von der fixen Idee, daß er als romantischer Dichter keinerlei Gesetz über sich dulden müsse, nicht abzubringen. Er war gewiß nicht verfolgt von dem »malheur d'être poète«, wie es August Sauer in glücklicher Erweiterung des berüchtigten d'Alemberlschen Wortes »malheur d'être« von Sappho und ihrem Dichter Grillparzer geprägt hat. Schon deshalb nicht, weil bei Schiff nicht die exzentrische Dichtung, sondern das exzentrische Leben das Primäre war. Er wollte ungezügelt dahinleben und suchte, diesen Trieb in seiner Dichtung zu rechtfertigen. Von ihr kam ihm kein Leid; nur seine Lebensführung brachte es ihm, aus der seine seltsamen, häufig fast an Wahnsinn grenzenden Werke erwuchsen. Ubrigens kann vielleicht die bizarre, von Rechts- und Unrechtsbegriffen wenig angefochtene Art, wie sich Schiff betrug, echt gewesen sein; aber in seinen Dichtungen war er ein oft recht nüchterner Verstandesmensch, dessen erzwungene Kälte und raffiniert-psychologische Behandlung seiner Stoffe nicht selten die frostigsten Eindrücke hinterläßt. – –
Schiffs erste dichterische Periode, die 1825 einsetzt – von den Jugenddichtungen hat sich nichts erhalten – zeigt ihn als getreuen Schüler der Romantik. E. Th. A. Hoffmann und Ludwig Tieck sind seine ersten Vorbilder. Eine Fortsetzung des »Kater Murr« ist das erste Buch, das er veröffentlichte. Es führt den Titel »Nachlaß des Katers Murr. Eine Fortsetzung der Lebensansichten des Katers Murr von E. Th. A. Hoffmann. Nebst einer Vorrede des Herausgebers.« (Leipzig 1826, bei Wilhelm Lauffer). Diese Fortsetzung des Hoffmannschen Fragmentes wird am prägnantesten durch eine Äußerung Heines charakterisiert, der an Moser schrieb [*Sämtliche Werke ed. Strodtmann, XIX, 237] : »Hast Du schon gehört, daß mein Vetter Schiff Hoffmanns »Kater Murr« fortsetzt? Ich habe von dieser Schreckensnachricht fast den Tod aufgeladen.« Dieses Urteil, das ohne Kenntnis der Schiffschen Arbeit gefällt wurde, trifft trotz seiner Impulsivität ins Schwarze. Ein neuerer Beurteiler, Franz Leppmann, in seinem anregenden Buche »Kater Murr und seine Sippe« [* Eine Katzendichtung, die Leppmann entgangen ist, rührt von Eduard Maria Öttinger her. (»Argus« (Hamburg) 1837 Nr. 32.) Es ist ein »Tiergespräch zwischen einer Katze und einem Mops«] (München 1908, Seite 26 ff.) ist geneigt, der Fortsetzung nicht allen Wert abzusprechen. Sie ist aber, was wohl den schwersten Vorwurf bedeutet, stillos und vom Geiste des Originals ganz und gar nicht erfüllt. Sie knüpft recht äußerlich an Hoffmanns Dichtung an, hat aber innerlich mit ihr sehr wenig zu tun. Auch in der Form, die bei Schiff unheimlich verkünstelt und wenig übersichtlich ist, hält er sich nicht an das große Vorbild. Er wollte anscheinend der Hoffmann des Hoffmann sein, wie Karoline Schlegel von Tieck meinte, daß er im »Gestiefelten Kater« den Tieck des Tieck habe spielen wollen.
Schon in diesem Erstlingswerke begegnet Schiffs später immer wiederkehrende Vorliebe für Binnenerzählungen. Das geht wohl auf die Vorliebe der Romantiker für das Theater im Theater, für Rahmen- und Binnenerzählungen zurück, die Schiff bei ihnen kennen zu lernen, vielfach Gelegenheit hatte. Da er im »Kater Murr« die eigenartigste Form der Einschalterzählung gefunden hatte, fühlte er sich wohl zu der Fortsetzung angeregt. Allerdings verzerrte er das Hoffmannsche Vorbild bis zu den äußersten Grenzen des Möglichen. Im »Nachlaß des Kater Murr« finden sich nicht nur ineinandergeschaltete Erzählungen, sondern auch noch zwei Supplemente, die mit der Hauptgeschichte in den engsten Beziehungen stehen. Nur erfolgt die Verknotung der Geschehnisse recht äußerlich; von einem Ineinanderweben, wie etwa der Begebenheiten in den »Bekenntnissen einer schönen Seele« in die Fäden der eigentlichen Handlung von »Wilhelm Meisters Lehrjahren«, ist bei Schiff keine Rede.
Um von dem Inhalte des »Nachlasses des Katers Murr« auch nur eine schwache Vorstellung zu geben, ist es nötig, die einzelnen Geschichten gesondert und ausnahmsweise etwas breiter zu charakterisieren.
In der Vorrede versichert Schiff den Leser zunächst weitläufig seiner Hochachtung und behauptet, daß das Werk wirklich von einem Kater herrühre und von ihm nur herausgegeben werde. Allerdings verkennt er nicht, daß die Leser sehr gelehrt sind und wissen, daß Tiere nur in der Fabel reden, und daß nichts für wirklich gehalten wird als das, wovon sich die Existenz beweisen läßt. So obliegt es ihm also, diese Existenz wissenschaftlich darzutun. Vorher aber bespricht er den Inhalt seines Buches, das aus dem ersten Hefte der Reisen des Katers besteht (anscheinend waren also mehrere Hefte solcher Reisen geplant) nebst hindurchlaufenden Makulaturblättern (vermutlich eines Manuskriptes, das der Autor auf seinen Reisen gefunden und verbraucht hat). Da des Katers Manuskript für einen Band nicht völlig ausgereicht, ein zweites Heft seiner Reiseschilderungen den Band aber zu unförmig gemacht hätte, habe der Herausgeber (Schiff) von dem zweiten Hefte des Katers so viel abgerissen, als für das Ausmaß des Buches nötig war. So entstanden die zwei Makulaturblätter des Anhanges. Das zerrissene Heft war aber nichts anderes als die Biographie Johannes Kreislers. Es folgt eine eingehende Beweisführung über die Existenz des Katers in Form einer unendlich weit verzweigten Disposition. Die Vorrede schließt damit, daß Schiff seinen eigenen bis dahin gebrauchten ernsten, wissenschaftlich tuenden Ton verwirft und (als echter Romantiker) »das freundliche Antlitz der geliebten Ironie« zu Hilfe ruft.
Im ersten Abschnitt geht Murr auf Reisen. Das Werk fährt unmittelbar dort fort, wo Hoffmann aufgehört hat. Meister Abraham klagt, daß die weiße Glaskugel seit dem Verschwinden der Chiara nicht wieder ertönte. Er ist ganz melancholisch, ebenso wie Kreisler, von dem der Kater es fühlt, daß ihn sein musikalischer Enthusiasmus zum Wahnsinn treiben müsse. Um ihn diesem zu entreißen, schilt er seine musikalische Begeisterung, die nicht der höchste Zweck des Daseins sei; denn wäre sie das, so hätte sie nicht einem einzelnen Menschen wie Kreisler zuteil werden dürfen, sondern allen Menschen, damit der Schöpfer gegen die anderen Geschöpfe nicht ungerecht hätte erscheinen müssen. Diese Argumentation versetzt Kreisler in solche Wut, daß er den Kater schlägt, der mit Mühe entwischt und nun beschließt, in die Welt zu gehen. Der Anfang seiner Wanderung entzückt ihn, nur der Hunger quält ihn. Plötzlich sieht er Abraham, der ihn mit Kreisler zu versöhnen sucht. Abraham eröffnet Murr, daß er der Sohn einer Prinzessin sei, die, in eine weiße Katze verwandelt, von einem Kater entführt worden sei. Er verschafft ihm ein leckeres Mahl und fordert ihn auf, nach einem Schmetterlinge zu haschen; wenn er ihn erreiche, so werde er ein Prinz sein und die schönste Prinzessin werde ihm gehören. Der Kater setzt zum Sprunge an, da sieht er sich von Hunden verfolgt. Er bittet einen Herrn und eine Dame, die im Wagen fahren, ihn aufzunehmen. Es geschieht. Als Verfasser der »Lebensansichten«, die Hoffmann herausgegeben hat, wird er freundlich auf das Schloß des Paares geladen. In dem Wirtshaus, in dem bald darauf gespeist wird, sind anwesende Bauern über Murr erbost, da sie sein Benehmen und seine Fähigkeit zu sprechen, für Hexerei halten, die sie nicht dulden wollen. Sie bewerfen ihn mit Steinen, er muß flüchten, was den Grafen sehr betrübt, der sich schon früher vergeblich bemüht hatte, den Gespensterglauben unter seinen Untertanen zu vertreiben. In einer Soiree, bei der die bedeutendsten Literaten zugegen sind, gibt Murr Aufschlüsse über die Abfassung seines Erstlingswerkes. Er kommt ins Theater, worüber die Zeitungen ausführlich berichten. »Der Hund des Aubri« wird gegeben, aber der Pudel, den man bewundern wollte, tritt hinter dem Interesse der Zuschauer für den Kater zurück. Das Zeitungsblatt, das seinen Ruhm verkündet, sendet Murr an Kreisler. Er spricht sich in seinem Briefe an ihn auch eingehend über die Gestalt des Baron von Wallborn (in Fouqués »Gefühle, Bilder und Ansichten«. 1819, Seite 145) aus. Auf die Naturphilosophie fallen immerfort Ausfälle. Dem Kater wird bewiesen, daß es nach den Lehren der Naturphilosophien mehr Geschöpfe seiner Art gebe. Endlich wird ihm in Aussicht gestellt, über seine tierischen Schicksalsgenossen unterrichtet zu werden. Da bricht das Fragment ganz unvermutet ab [* Ein Bruchstück daraus ist abgedruckt In Pappes »Lesefrüchten« 1825, III. Band, 2. Stück, Seite 337–347].
In diese Geschichte sind »Makulaturblätter« eingeschaltet, die mit Hoffmanns Erzählung nichts zu tun haben. Ein glänzendes Fest am herzoglichen Hofe. Der Prinz Ludowigo küßt eine Sängerin Giovanina, mit der sein Vertrauter Laelio im tête-à-tête gewesen war. Ein Hofnarr, der bei Shakespeare in die Schule gegangen ist (Wortgefechte sind seine liebste Unterhaltung), bittet, seiner Funktion enthoben zu werden, da er sich zu alt fühle. Der Prinz Ludowigo ist mit seinem Los unzufrieden, er verzweifelt an Gott und verschmäht seine Unendlichkeit. Da bemerkt er nachts im Garten eine schlafende Schöne, und das entreißt ihn seiner Verzweiflung. Er bittet sie um ihre Liebe, sie stößt ihn zurück. Laelio grollt ihm, da er bei Giovanina keine Erhörung findet, die meint, der Prinz küsse ganz anders als er. Deren Mutter hat eine phantastische Oper komponiert, die das zum Inhalt hat, was der Prinz Ludowigo einmal geträumt hat. Die Heldin der Oper erklärt ihrer Mutter, daß sie den Prinzen, ihre Kunst und sie (die Mutter) als eine Einheit liebe. Die Mutter flucht ihr, wenn sie den Prinzen erhöre. Die Liebesgeschichte zwischen dem Prinzen und einer Sängerin Paula, die plötzlich unmotiviert erzählt wird, ist durchaus verworren. Die Mutter ist gegen diese heiße Liebe; da erkrankt sie am Nervenfieber und stirbt. Die Tochter klagt sich an, daß sie die Mutter durch ihre Liebe ins Grab gebracht habe. Sie gibt dem Prinzen den Abschied, um das Gebot ihrer Mutter, sich mit dem Prinzen nicht einzulassen, nicht zu übertreten. Der Prinz will erst sterben, dann Einsiedler werden. Da er aber eine irdische Liebe im Herzen trägt, gerät er in Konflikt mit einem Einsiedler, der die Inquisition anrufen will, um einen von dem Prinzen einem Muttergottesbild angeblich angetanenen Schimpf zu rächen. Von Paula kann Ludowigo nicht lassen, daneben liebt er auch Giovanina. Die erstere sucht ihn zu fesseln, die zweite ist unnahbar. Fast mit Gewalt reißt er Paula an sich, die ihm flucht. Da erschießt sich Ludowigo. Nun verzweifelt auch Paula, die das Schreckliche nicht geahnt hatte. Sie wird wahnsinnig, und diese ergreifende Szene hat Schiff wirklich vortrefflich ausgemalt, wie er immer in grausigen Wahnsinnsszenen erschütternde Wirkungen zu erzielen verstanden hat. –
Einen dritten Teil dieses kaum entwirrbaren Buches bildet die Biographie Kreislers. Schiff hatte nicht die Fähigkeit, diese Biographie so in die Reiseberichte des Katers und die Liebesgeschichte des Prinzen einzuspinnen, daß er zwei eingeschachtelte Erzählungen hätte gestalten können. Deshalb nimmt er zu dem Ausweg seine Zuflucht, daß er diese Biographie anhangsweise mitzuteilen – – – vorgibt. Denn in Wirklichkeit hat er es damit gar nicht eilig, sondern er läßt Meister Abraham Kreislern eine Geschichte erzählen. Also wieder eine Binnennovelle in der eigentlichen Erzählung. Diese eingeschobene Novelle soll Kreisler beweisen, wie im Leben jede Sehnsucht unbefriedigt bleiben müsse. Bekanntlich ist Abraham bei Hoffmann in Neapel mit den fürstlichen Brüdern oft in Berührung gekommen. Nun weilt der Prinz Hektor in Neapel und belauscht, wie eine Zigeunerin der Prinzessin Angela prophezeit, daß sie aus einer Verwünschung erlöst werden solle, wenn sich ein Prinz in sie verliebe und sie befreie. Kaum hat sie das ausgesprochen, als der Prinz hervorstürzt und der verzauberten Prinzessin seine Liebe gesteht. Die Zigeunerin nennt ihn sofort beim Namen und wirft ihm seine Flatterhaftigkeit vor. Das setzt ihn so in Erstaunen, daß er erklärt, er sei von diesem Augenblicke an ein anderer. Bald aber kommt er mit seinem Gefühl in Widerspruch und bereut sein Versprechen. Natürlich ist Angela niemand anders als Angela Benzoni, die Tochter des Fürsten Irenäus und der Rätin. Diese Angela wird bekanntlich der Zigeunerin Magdala Sigrun übergeben, die Mittel treffen soll, den Flecken der Geburt, der auf dieser fürstlichen Tochter ruht, auszulöschen. – Dem Prinzen fehlt leider der ernste Wille dazu, sein Herz sprechen zu lassen. Plötzlich überkommt ihn wieder das Gefühl der Liebe für die unbekannte Prinzessin, aber nun weiß er sie nicht aufzufinden. Da kommt Abraham nach Neapel, um dort seine Kunststücke zu zeigen. Die Zigeunerin besitzt den Ruf, jedermann die volle Wahrheit zu verkünden. Abraham ist überzeugt, daß seine Chiara dahinterstecken müsse, die allein ein fremdes Wesen völlig durchschauen könne. Er und der Prinz treffen zusammen, und nun, da Hektor Abraham alles erzählt, weiß dieser sofort, daß die Chiara hier sein müsse. Er forscht die alte Zigeunerin aus und erkennt Angela, die sich seiner auch dunkel aus ihrer Kindheit erinnert. Inzwischen hat die alte Zigeunerin, um des alten Fürsten Wunsch zu erfüllen, und da Hektor unschlüssig ist, die Prinzessin mit dem Prinzen Antonio verheiratet. Hektor ist sehr erbittert, zumal er mit Antonio, seinem Bruder, nie auf gutem Fuße stand. Es klingt leise das Motiv aus der »Braut von Messina« an: Zwei Brüder, die unerkannt dasselbe Mädchen lieben. Aber bald erfährt Hektor, daß Antonio mit Angela verheiratet sei. Er schleicht in ihre Wohnung, findet dort Antonio und ersticht ihn. (Schiff war unfähig, etwas anders als tragisch ausgehen zu lassen; hier war diese Lösung gewiß nicht am Platze.) Auch Angela stirbt auf sehr eigenartige Weise durch Gift, das ihr Antonio in ein Medaillon gegeben hat. Dieses Gift wird durch Körperwärme flüssig. (!) So endet also Hoffmanns Geschichte plötzlich tragisch, wie bei Schiff in der Folge alles einen tragischen Ausgang nahm. Später erfährt auch Abraham, daß die Chiara auf Veranlassung der Benzon vom Fürsten der Zigeunerin mit dem Auftrage übergeben worden sei, sie streng verborgen zu halten. Antonio erhält durch ein Wunder neu das Leben. –
In einem zweiten Supplement (der »Differenz«, wie es Schiff nennt) wird das Schicksal Angelas enthüllt. Die Benzon will Abraham die Chiara ausliefern, wenn er ihr sage, wo Angela sei (die von der Zigeunerin während des allgemeinen Tumultes, den die zwei Todesfälle hervorriefen, entflohen ist). Er will das nicht tun. Hektor, der in Julia verliebt ist, wird wahnsinnig; er erinnert sich immer wieder Angelas und glaubt, in Julien ein Spukbild, das Angela vorstelle, zu sehen. Inzwischen ist Kreisler Mönch geworden, und das erregt den Wahnsinn des Prinzen aufs neue. Er sieht den Leichnam seines Bruders und wie vom Donner gerührt – – damit schließt das Buch.
Diese verworrene, lose und äußerlich an Hoffmann anknüpfende Fortsetzung des »Kater Murr« zeigt schon, wie wenig befähigt Schiff war, dort fortzufahren, wo sein Vorgänger, der den in einer »Nachschrift des Herausgebers« versprochenen dritten Band des »Kater Murr« niemals erscheinen ließ, abgebrochen hatte. Schiff war Hoffmanns Art nur wenig homogen; er war wohl von der besten Absicht erfüllt, sie weiterzubilden. Aber die Ausführung blieb, wie in diesem Werke so auch in späteren, weit hinter dem guten Willen zurück. Eine künstlerische Manier kann eben nicht nur mit dem Verstande erfaßt werden, und niemand kann sich sie durch den bloßen Willen, sie nachzubilden, aneignen. Nur organische Wesensgleichheit ermöglicht das völlige Aufgehen in den Intentionen eines Vorgängers.
»Dein Kater Murr ist schlecht«, schrieb Heine kurz und bündig an Schiff. Er versüßte ihm diese bittere Pille dadurch, daß er eine gleichzeitig erschienene Novelle »Pumpauf und Pumprich« herzhaft lobte. »Schiff! Ich schreibe heute an Dich wie an meinesgleichen. Dein ›Pumpauf und Pumprich‹ hat mir gefallen. Es ist ein gutes Buch, ein braves Buch, ein Buch, dem ich mich nicht scheuen würde, meinen Namen vorauszusetzen, kämen nicht Bestialitäten darin vor.« Von dieser lustigen, durch den originellen Einfall bestechenden Geschichte behauptet Schiff im hohen Alter, sie sei nicht sein Werk, sondern das Bernhardis. Die Nachricht ist, wie alles, was in »Heinrich Heine und der Neuisraelitismus« steht, mit großer Vorsicht aufzunehmen. Er erzählt dort (Seite 103–105), daß er, Bernhardi und der Sohn eines Dresdner Beamten, namens Müller, öfter kein Geld, ja, nicht einmal ein Stück Brot hatten. Da führte Schiff das »hochromantische Kleeblatt« eines Samstags zu einem jüdischen Gastwirte, der ihnen zu essen gab, sich aber weigerte, an diesem Tage Geld zu nehmen (das die drei ohnehin nicht hatten). »Sollst doch gesegnet sein, Moses, weil du solche Gesetze gegeben«, sprach Bernhardi, der auch meinte, das sei ein Novellenthema, das er sogleich auf Schiffs Zimmer ausführte [* In Göttingen wurde die Novelle verboten, damit die akademische Jugend durch die Lektüre nicht zum Schuldenmachen verleitet würde] .
Diese Angabe ist, wie erwähnt, mit Vorsicht aufzunehmen. Strodtmann (Heines Leben I, 164) und Goedeke schreiben die Autorschaft der Novelle, deren Stil unbedingt auf Schiff hinweist, Bernhardi zu. Dagegen spricht indes zunächst Heines Brief; wäre Schiff nicht der Verfasser der Novelle gewesen [* Strodtmann meint, Bernhardi habe Schiffs Namen über Wunsch des Verlegers auf das Titelblatt gesetzt, weil Schiff damals schon bekannter gewesen sei. Das trifft aber nicht zu. Schiff war 1826 ebensowenig bekannt wie Bernhardi] , so hätte er kaum Heines Lob ruhig eingesteckt, sondern es abgelehnt. Aus einer Charakteristik Schiffs von Alexis geht übrigens deutlich hervor, daß man diesem die Autorschaft der Novelle zu Unrecht absprechen wollte. Wenn Schiff dies im hohen Alter selbst tat, so muß ihm bei seiner Angabe eine Verwechslung mit einem anderen Werke, das seinen und Bernhardis Verfassernamen gemeinsam aufweist, unterlaufen sein; gegen die Verwendung seines Namens gelegentlich des Erscheinens eines »Gespensterbuches« von H. Paulmann, Dr. Schiff und W. Bernhardi sandte er am 21. Oktober 1838 aus Emden an Gutzkows »Telegraph« die Erklärung, daß er an diesem Buche nicht den geringsten Teil habe. Wäre also sein Name widerrechtlich auf »Pumpauf und Pumprich« gekommen, so hätte sich Schiff wohl sofort dagegen verwahrt und hätte nicht erst volle vierzig Jahre später seinen Widerspruch erhoben, der übrigens in einem wichtigen Punkte beweist, daß Schiffs Erinnerung stark getrübt war. Er behauptet nämlich, daß die Novelle bei Wilhelm Lauffer in Leipzig erschienen sei (wo der »Kater Murr« herauskam), während sie in Zerbst verlegt wurde.
Endlich aber spricht ein drittes, sehr wichtiges Argument für Schiff als Verfasser der Humoreske. In dem Jahre 1826 erschien noch ein drittes Werk von ihm, zwei Novellen, denen er den gemeinsamen Titel »Höllenbreughel« gab. Darin legt er sich Rechenschaft über seine ganze schriftstellerische Existenz ab. Nach einem einzigen Buch pflegt man solche Resumés wohl nicht abzuhalten. Die Annahme ist nicht ungerechtfertigt, daß Schiff bereits einiges veröffentlicht hatte, ehe er vor dem Publikum mit sich selbst abrechnete [*Daß von Schiff vor 1826 bereits eine Novelle »Marienkind« gedruckt worden wäre, wie Alberti im Lexikon der Schleswig-Holstein-Eutinschen Schriftsteller ohne nähere Angaben behauptet, ist falsch. Diese 1831 in München anonym erschienene Erzählung rührt vielmehr (vgl.Lindner »Die Schriftsteller und die um Wissenschaft und Kunst verdienten Mitglieder des Benediktinerordens«, II, 113) von LudwigAurbacher her] . In der zweiten Novelle dieses Buches »Die Genialen«, einer bitteren Satire auf die ganze zeitgenössische Literatur (die große Absicht wurde in der Ausführung nur zum kleinsten Teile verwirklicht) urteilt ein literarisch genußfreudiger Weber über Schiff: »Er trägt die Spuren der Krankhaftigkeit nicht minder wie die ganze Zeit, seine ganze Erfindung und Empfindung ist stets auf die höchste Spitze hinaufgeschraubt. Was laßt sich überhaupt von einem jungen Menschen sagen, der sich nur mit Bagatellen abgibt? Er ist nur einSchiffchen, ohne gehörigen Ballast, das keine große Fahrt antritt, nicht in die offene See sticht, was untergeht, scheitert, vielleicht auch nur leck wird.« »Höllenbreughel« nennt der Weber ein Produkt des Übermutes, in dem der Autor die Charaktere der Dichtung über sich selbst reden lasse, wodurch das Werk in den Augen des Lesers sofort verliere.
Diese Selbstcharakteristik ist sehr bezeichnend und bereits eine Vorahnung der Urteile, die Schiff in den »Lebensbildern von Balzac« den französischen Autor über sich selbst aussprechen läßt. Das ist der alte romantische Kniff, sich über sich selbst lustig zu machen, wie etwa im romanischen Lustspiel die Bühne mit sich selbst Scherz treibt. Bei Tieck fand Schiff hierfür wohl die wirksamste Anregung, wie er dessen Jugendlustspielen in dieser Novelle »Die Genialen« auch sonst die bedeutsamsten Einwirkungen verdankt. Denn recht tieckisch-übermütig ist Schiffs Abrechnung mit der Literatur seiner Zeit, vornehmlich ihrem größten Schädling, Clauren. Zweimal verspottet er diesen aufs kräftigste, als Erzähler und Lustspieldichter. In einem »Claurenschen Roman« »Assessor Winchen oder die Liebe ist das höchste Leben« ist die unerträgliche Süßlichkeit Heuns wohl auf das schlagendste verhöhnt. Verfertigt ist diese Parodie von einem Barbier, der »Verfasser der Romane in allen möglichen Manieren« ist, ein deutlicher Hinweis auf Adolf von Schaden, der beständig in der Manier anderer schrieb. Schiff zeigt schon äußerlich, daß es ihm nur um satirische Wirkungen zu tun sei. Er verflicht in den Pseudoclaurenschen Roman einen zweiten, der denselben Inhalt hat wie der erste; er läßt auch die herbsten Urteile über diese Dichtung aussprechen, so z. B. daß man derartige Bücher nicht in aller Ewigkeit zu Ende lesen könne, oder »die Poesie unserer Zeit ist vor Altersschwäche kindisch geworden«, vielleicht die kürzeste, aber treffendste Verurteilung Claurens und seines Gefolges. Diese Parodie, die sich auch offen als solche gibt, steht hoch über der Hauffs, der die satirischen Absichten nicht so ohne weiters anzumerken sind. Schiffs Humor, der schon in »Pumpauf und Pumprich« kräftig zum Vorschein kommt, übt die stärkste Wirkung aus. Keine geringere auch in dem Schauspiel »Tugend nur allein macht glücklich«, das ein Schuljunge verfaßt hat, und in dem alle Personen vor Edelmut und Selbstlosigkeit überfließen. Wenn am Schlusse zwei Bewerber um ein Mädchen dieses einander unaufhörlich gegenseitig in die Arme werfen, damit einer hinter dem anderen an Entsagungsfähigkeit nicht zurückstehe, so ist das wohl die anschaulichste, aber auch wirksamste Persiflage auf die übertriebene Tugendduselei Claurens. Als bedeutsames Vorspiel für die Balzacparodierung haben diese beiden Verhöhnungen des Berliner Dichters zu gelten. Nur ist die satirische Absicht hier weit stärker zum Durchbruch gelangt; Schiff schwächt die Mittel des Dichters, dessen Manier er verspotten will, nicht ab, sondern verstärkt sie wesentlich und macht dadurch seine eigenen Absichten weit offenkundiger.
Diese beiden Parodien bekunden Schiffs Talent, sich in eine fremde dichterische Manier einzufühlen, weit besser als die ernstgemeinte Fortsetzung des »Kater Murr«. Seine Art war, wie dies auch sein ganzes Leben offenbart, weit eher destruktiv als konstruktiv. Das können die unter dem Titel »Höllenbreughel« vereinigten zwei Novellen sehr deutlich lehren. Der Titel weist bereits den Weg, den der Autor nehmen will. Der Fratzenmaler Callot soll durch den »Höllenbreughel« übertrumpft werden. Schiff begnügt sich also nicht mehr damit, Hoffmann nachzufolgen, sondern sucht, dessen wildphantastische Wirkungen zu übertreffen. In der ersten Novelle »Die Hexen« ist ihm das eher geglückt als in der zweiten. Zwar operiert Schiff zum Teile mit Hoffmanns Mitteln; Gespenster und Hexen beleben die Handlung, die sich in wilden Sprüngen gefällt. Sie soll Grauen hervorrufen, kann aber im besten Falle nur Mitleid mit einem irregeleiteten Dichter erregen, der um jeden Preis aus einem unglaubhaften Stoffe Wirkungen hervorholen will, die in diesem nicht gelegen sind[*Heine soll sich nach Schiffs Mitteilung (»Heine und der Neuisraelitismus«, Seite 105) über das Werk geäußert haben: »Entweder du bist meschugge (verrückt) oder du gehst direkt darauf aus, es zu werden.« ].
»Der Leser weiß nicht, woran er ist; und wenn er meint, der Verfasser wolle sich über ihn lustig machen, mag er wohl auf richtiger Fährte sein«, meinte die »Jenaische Literaturzeitung« (Ergänzungsblätter 1829, Nr. 36, Seite 288) in arger Verkennung der Absichten Schiffs, der sich ernstlich bemühte, das Hineinspielen der Geisterwelt in menschliche Geschicke, wie es bei Hoffmann vor sich geht, bis auf den Gipfel emporzutreiben. Auf diesem Wege übertreibt aber Schiff maßlos; er wirkt unglaubwürdig und nicht erschütternd, sondern ernüchternd.
In der ersten Novelle treiben die Hexen (ein abscheulicher Kater hilft ihnen dabei) ihre heillosen Künste mit dem Blute, das einem Jüngling abgezapft wurde, der in ein (man weiß nicht recht irdisches oder himmlisches) Mädchen verliebt ist. Ein Arzt und sein gespenstischer Famulus suchen, der Hexe ihr Opfer zu entreißen; sie soll verbrannt werden, entflieht aber, während des Jünglings Liebste wirklich auf dem Scheiterhaufen umkommt. In dieser Szene, die in keinerlei Geisterspuk hineinspielt, ist Schiff ein packendes, sehr realistisches Genrebildchen gelungen. Die Verbrennung des schuldlosen Mädchens, das seine letzten ergreifenden Klagen dem Geliebten, der der Hinrichtung beiwohnt, zuruft, ist von stärkster Wirkung. Dieser Schluß, der wieder Schiffs Vorliebe für tragische Ausgänge offenbart, kann mit der ganz auf äußerliche Effekte berechneten Mache der Novelle einigermaßen versöhnen. Das gelingt der zweiten »Die Genialen« nur in den parodistischen Szenen; ihr sonstiger Inhalt (insbesondere die Sticheleien auf Gelehrteneitelkeit und die schwächlich funktionierende Gespenstermaschinerie) läßt die Frage, was Pieter Breughel damit zu schaffen haben sollte, für immer offen. Denn der vorgeblich so schauerliche Gespensterspuk, der aber schließlich seine natürliche optische und mechanische Erklärung findet, wirkt kalt und leer.
Dagegen zeigen ein paar Gedanken über den Unterschied zwischen der poetischen Schönheit und Wahrheit, die wohl Schiffs Dissertation entstammen mögen, daß er sich mit diesen Fragen eingehend beschäftigt habe. Er meint, das Schöne könne wahr sein, doch sei das kein unbedingtes Erfordernis. Die Schönheit der Homerischen Gedichte würde dadurch nicht beeinträchtigt, wenn Achill und Hektor niemals gelebt hätten. Selbst das Häßliche könne schön wirken, wenn es sich an dem richtigen Orte befinde. Das sind, ohne daß Schiff damals Balzac schon kannte, auch dessen ästhetische Ansichten, die leider von dem Deutschen später nicht mehr anerkannt wurden. –
Den drei Erstlingsbüchern Schiffs war kein größerer Erfolg beschieden: man nahm von ihnen kaum Notiz. Das mag ihn verdrossen haben, und so kehrte er Ende 1826 nach Hamburg zurück, wo damals (vgl. mein Lyserbuch Seite 58 ff.) namentlich auf journalistischem Gebiete eine beängstigende Überproduktion um sich gegriffen hatte. Schiff erhoffte wohl, in der Heimat tiefergehende Anerkennung zu finden als in Leipzig und durch Zeitungsmitarbeit rascher zu einem halbwegs gesicherten Einkommen zu gelangen. Daß ihn Heine schon 1827 (wie Strodtmann a. a. O. II, 52 nach Schiffs Mitteilung behauptet) [* In »Heinrich Heine und der Neuisraelitismus« (Seite 57) verlegt Schiff diese Empfehlung in das Jahr 1826] an Campe empfohlen hätte, ist nicht ganz glaubwürdig. Denn erst 1836 ist eine Verbindung zwischen dem Verleger und Schiff nachweisbar. Diese Hamburger Zeit war zwar nicht unproduktiv (vieles, was erst später gedruckt wurde, muß bereits in Hamburg entstanden sein; von einem Werke läßt sich das sogar mit Sicherheit behaupten), aber an die Öffentlichkeit gelangte nur wenig. Schiff war damals Mitarbeiter der berüchtigten »Originalien« von Georg Lotz; leider sind von seinen Beiträgen für dieses Blatt nur zwei zuverlässig nachzuweisen. Doch geht aus einer Anmerkung Lotz' zu einem von Schiff mitgeteilten Romanfragment »Flucht der Gräfin Elisabeth aus ihrem Schlosse« [* Aus dem damals und bis heute noch ungedruckten Roman »Agnes Bernauerin«; »Originalien« 1828, Nr. 145–150] hervor, daß dieser schon früher Aufsätze in der Zeitschrift veröffentlicht habe. Mit diesem Romane übertraf Schiff, nach Loß' Behauptung, seine bisherige literarische Produktion bei weitem. Doch ist von dieser, wie erwähnt wurde, in dem Hamburger Blatte nur noch der polemische Beitrag »Schiller, Madame Weißenthurn und Terpsichore« (1826, Nr. 106) Schiff zuzuschreiben, eine heftige Anklage gegen das Theaterpublikum, bei dem Schiller nur wenig Anklang finde.
Diese überaus geringfügige Produktion Schiffs während drei Jahren wirkt befremdlich. Erklärlich ist sie vielleicht dadurch, daß er sich in dem rohen journalistischen Getriebe, das Hamburg damals erfüllte, nicht Bahn brechen konnte. Seine durchaus sensitive Natur, der viel Schüchternheit anhaftete, die ihm niemals gestattete, sich vorzudrängen, sondern immer zu stiller Resignation trieb, verhinderte es wohl, daß er in Hamburg zur Geltung kam. Noch 1866 beklagt Schiff sein »einsames, selbstbehagliches Streben«, von dem abzulassen, ihn Heine immer ermahnte. Aber »wer nur Gewinnes halber seiner Zeit dienen will, erniedrigt sich zu einem Komödianten seiner Zeit.«
Mit solchen Grundsätzen konnte Schiff die vor keiner Erniedrigung und Korruption zurückschreckende Hamburger Journalistik der ausgehenden zwanziger Jahre nicht aus dem Felde schlagen. So kehrte er der Alsterstadt den Rücken und wandte sich anfangs 1830 nach Berlin. Hier konnte Heine für ihn eintreten. Wie er August Lewald, den Gefährten aus seiner Hamburger Zeit, an Willibald Alexis für den »Freimütigen« empfahl [* Vgl. den Brief an Hering (Heines Werke ed. Strodtmann, XIX, 408)] , so bemühte er sich für Schiff beiGubitz, dem Herausgeber des »Gesellschafters«, und ebenfalls bei Alexis. Für die Zeitschriften beider hat Schiff von 1830 – 1835 eine Überfülle von Beiträgen geliefert; daneben erschienen in diesem Lustrum eine Reihe von Buchgeschichten und Theaterstücken. Man »nahm mir ab, was ich liegen hatte, und verlangte, soviel ich leisten konnte. So ward denn aus mir ein Licht, wenn auch kein großes. Die Frauen lasen mich gerne ...« [* Heinrich Heine und der Neuisraelitismus, Seite 57] .
Diese fünf Jahre bedeuten den Höhepunkt der literarischen Produktion Schiffs. Es war sein eigenes Verschulden, wenn dieser Zeitraum, der ihn zu einem gekannten und auch geachteten Schriftsteller machte, nur so kurz war. Denn ruhelos, wie er immer war, brach er plötzlich, ohne daß man die Ursachen hierfür erkennen könnte, seine Zelte in Berlin ab, wobei er sicherlich nicht ahnte, daß damit seine glücklichste Lebensperiode für immer zu Ende sein sollte. In Berlin eroberte sich Schiff überraschend schnell eine literarische Position, die er indes vielleicht nur einer Opposition zu verdanken hatte, die gegen – Tieck ankämpfte. Damals war es ja Mode, auf Tieck loszuschlagen, wie dies z. B. Müllner jahrelang tat, der Tieck wirklich, um mit Raumers Worten in den »Briefen aus Paris« (I, 154) zu sprechen, auf nichtsnutzige Weise verleumdete. Auch nach Müllners Tode (1829) verstummten diese Angriffe nicht; in den meisten Zeitschriften der Dreißigerjahre begegnet man ihnen immer wieder [*Noch 1839 ein Tiecks Novellistik hart und oft ungerecht befehdender Aufsatz in den »Hallischen Jahrbüchern« (Spalte 2476 ff.)] , und die Jungdeutschen waren nicht die einzigen, die gegen ihn Front machten. Selbst ihre Gegner waren in der Bekämpfung Tiecks eines Sinnes mit ihnen. –
In Schiff sah man nun allgemein denjenigen, der als Novellist Tieck den Kranz von der Stirne reißen könne. Immer wieder wurde er gegen diesen ausgespielt, von ihm erwartete man eine Erneuerung und Belebung der novellistischen Kunst. Nun läßt sich gewiß nicht verkennen, daß in den späteren Novellen Tiecks die reine novellistische Form nicht immer gewahrt ist, daß er alles mögliche, oft sogar einfache Anekdoten, als Novellen ausgegeben hat. Auch das mußte befremden, daß Tieck in seinen späteren Novellen seine eigene romantische Vergangenheit Lügen strafte, daß er gegen die Schwärmerei in der »Waldeinsamkeit«, die er selbst im »Blonden Eckbert« verherrlicht hatte, Stellung nahm, daß er sich von seiner Vorliebe für den Katholizismus und katholische Kirchenmusik losmachte u.s.w. Wenn man ihn den »Talmi-Goethe« nannte, weil er, wie Goethe, seine Personen nur im feinsten Salontone sprechen ließ und niemals bürgerliche Milieus darstellte, so lag in dieser Bezeichnung der Angriff auf Goethe ebenso wie auf Tieck, die ja beide von der Generation um 1830 mit gleichem Hasse bedacht wurden.
Aus dieser Entartung der Romantik sollte Schiff, nach dem Wunsche aller maßgebenden Kritiker, die deutsche Literatur erretten. Niemand war weniger dazu geeignet als er. Allerdings hatte er sich, in den beiden ersten Werken, die er in Berlin veröffentlichte, in den Balzacnovellen nämlich, als unbedingten Verehrer der romantischen Doktrin bekannt, und diese sehr energische Bevorzugung der romantischen Poesie vor jeder anderen konnte erwarten lassen, daß Schiff den von ihm so ostentativ betonten Grundsätzen immer treubleiben werde. Wenn er wirklich, wie er insbesondere im »Elendsfell« vorgab, in der Wunderwelt der romantischen Poesie den Inbegriff aller Dichtung erblickte, dann stand zu hoffen, daß die selbst von Tieck preisgegebene Romantik durch Schiff wieder neu durchgesetzt werden könnte. Und sicherlich hatte er, als er in den »Lebensbildern« die realistischen Schilderungen Balzacs im romantischen Sinne umgestaltete und im »Elendsfell« sogar mit heißen Worten für die Neubelebung der Romantik eintrat, im Sinne, der von ihm selbst so laut gepriesenen literarischen Richtung treuzubleiben und ihr zu frischen Siegen zu verhelfen. –
Schiffs Berliner Dichtung ist denn auch bestes romantisches Gut. Nur enttäuschte er alle, die in ihm den Besieger Tiecks sahen, schon im »Elendsfell« damit, daß er für Tieck entschieden Partei nahm. Noch lebhafter tat er das in einem gegen Franz Horn gerichteten Aufsatze des »Gesellschafters« (1831, Nr. 207–208); dieser hatte Tiecks Ansichten über den »Hamlet« bekämpft und wurde dafür jetzt von Schiff heftig zurechtgewiesen. Wie er auch sonst (vgl. z. B. »Gesellschafter« 1832, Nr. 55 »Goethes und Tiecks Kommentare«) immer als wärmster Anwalt Tiecks auftrat, gegen den er sich niemals, wie es von ihm so heftig verlangt wurde, in Gegensatz stellte, dessen neue Werke er vielmehr immer begeistert begrüßte. So rühmte er z. B. dessen 1833 verfaßten, 1834 im »Novellenkranz« erschienenen »Tod des Dichters« (»Gesellschafter« 1834, Nr. 44), der ihm als Künstlernovelle und damit als ein recht dem Boden der Romantik entsprossenes Produkt besonders zusagen mußte, ebenso »Die Vogelscheuche« (ib. 1834, Nr. 191), deren Persiflage des Dresdner Liederkreises Schiffs Vorliebe für parodistische Wirkungen sehr entgegenkam. Allerdings verkannte er nicht, daß die Zeit einem Erstarken der romantischen Tendenzen keineswegs günstig sei, und die Titelfrage seines Aufsatzes »Ist unsere heutige Poesie noch eine romantische?« (»Gesellschafter« 1834, Nr. 119–120) nannte er selbst »eine Paradoxe«. Darüber war er sich eben allmählich klar geworden, daß die alte Romantik, wie sie das beginnende 19. Jahrhundert gesehen hatte, nicht mehr zum Leben erweckt werden könne und seine pompösen Streitrufe für sie nur geringes Echo gefunden hatten. So blieb denn auch Schiff mehr im Herzen als in seinen Werken Verehrer dieser infolge der Geschmacksveränderung des Publikums überlebten Richtung. Aber was zu ihren Gunsten ausschlagen konnte, tat und sagte er redlich. Er wußte genau, daß die jämmerliche Modeliteratur der Clauren und Raupach, der Schaden und Wachsmann sowie all der seichten Almanachnovellisten dem echten romantischen Geiste am meisten Abbruch getan hatte. Und so war er unermüdlich in der Bekämpfung ihrer trostlos trivialen, den ödesten Publikumsinstinkten entgegenkommenden Plattitüden. Wie er Raupach angriff (in dem Aufsatze des »Freimütigen« 1834, Nr. 175–178, »Raupach von innen. Eine Epistel an die Provinzialdichter«; vorangegangen war ein lobender Essay von Alexis »Raupach von außen«, ib. Nr. 173–174) oder Wachsmann namentlich wegen dessen hämischer Angriffe auf Börne abfertigte (»Glosse über sechs Novellen«, »Gesellschafter« 1834, Nr. 165–166) [* Von Michael Holzmannin seinem Börnebuche, Seite 270, aber unter falschem Titel herangezogen] und die ganze Almanachnovellistik wirklich fein verspottete, das gehört zu den anregendsten und ehrlichsten kritischen Kundgebungen Schiffs. Daraus sprach jemand, der in einer wenig gesinnungstüchtigen Zeit den Mut hatte, unparteiisch über literarische Gerechte und Sünder zu urteilen. Ein unerschrockener Wahrheitsfanatismus und gefestete, unerschütterliche Grundsätze sind aus diesen anklagenden Aufsätzen immer erkennbar. Es ehrt Schiff, daß er es sogar wagte, in der Zeitschrift, deren Redakteur Alexis war, gegen diesen in der Auseinandersetzung mit Raupach aufzutreten. Wie er sich auch sonst, trotz seiner materiellen Abhängigkeit vom »Freimütigen«, nicht scheute, gegen Alexis anzukämpfen.
Als dieser in dem 1833 bei Brockhaus erschienenen Buche »Wiener Bilder« sein royalistisches politisches Glaubensbekenntnis veröffentlichte (Seite 425–453), worin er den Begriff der Volkssouveränität für eine Chimäre erklärte, für den Geburtsadel und die Legitimität eintrat und von einem »Völkerfrühling« nichts hören wollte, trat ihm Schiff in einem Aufsatze des »Gesellschafters« (1833, Nr. 179, 181) »Auch mein politisches Glaubensbekenntnis. Von einem dummen Teufel« [* So unterfertigte sich schon Lyser in Aufsätzen, die er in Hamburg publizierte, gern] aufs schroffste entgegen. Furcht scheint er überhaupt nicht gekannt zu haben; denn sogar mit Wolfgang Menzel rechnete er zweimal in den schärfsten Ausdrücken ab. Dem konnte er seinen Goethehaß nicht verzeihen; er warf ihm literarische Unzurechnungsfähigkeit vor (»Gesellschafter« 1834, Nr. 42–44) und trat in dem Aufsatze »Goethes literarisches Porträt« (ib.Nr. 139) voll Begeisterung für den von Menzel, Müllner und Pustkuchen Befehdeten ein, die er mit loderndem Ingrimm angriff. Auch Heine verschonte er nicht; seine Selbstbespiegelung in »Adler und Lorbeerbaum«, die auch Johann Peter Lysers Mißfallen erregt hatte [* Vgl. mein Lyserbuch, Seite 72] , forderte den ersten seiner Ausfälle gegen Heine heraus, die er später heftigst fortsetzte, freilich zu seinem argen Schaden. –
Aus den theoretischen Ausführungen Schiffs wird seine literarische Stellung viel klarer ersichtlich als aus seinen eigenen dichterischen Arbeiten in dieser Zeit. Hier fließt alles; Romantik, Realismus, falsche Sentimentalität, wie sie sich in den flachsten Almanachnovellen austobte, Deutschtümelei und Franzosenfreundlichkeit – alles ist anzutreffen. Ein zutreffendes Bild der dichterischen Persönlichkeit Schiffs während seines ganzen Lebens ergibt sich nur, wenn man ihm chronologisch durch das Auf und Ab und Kreuz und Quer seiner literarischen Sprünge folgt. Um sein Schaffen zu beschreiben, ist nur der eine Weg gangbar, seine Jahr um Jahr entstandenen Schriften zu betrachten, die Widersprüche, die zwischen einer und der anderen liegen, aufzuzeigen und nicht etwa die zusammenzustellen, die inhaltlich zusammengehören. Schiffs Denken und Dichten war eben immer krummlinig, und deshalb muß man diesem Dichten wohl auch auf all seinen Zickzackläufen nachgehen, um die richtigen Vorstellungen davon zu erwecken. Gleich diese Berliner Zeit zwingt zu dieser chronologischen Betrachtungsweise. Schiff überarbeitete aus den »Contes de l'Atelier« von Michel Raymond, einer Kompagniefirma von vier literarischen Teilhabern, die nur allzu gerne gesellschaftliche Sümpfe aufdeckte und für Verbrechen und Hinrichtungen schwärmte, eine »Waise vom Tandel-Markt« (»Gesellschafter« 1832, Nr. 92–101), nach einer nicht eruierbaren französischen Vorlage die Selbstbiographie »Der redliche Josef« (in »Mußestunden«, herausgegeben von Friedrich Bertram; Berlin, Vereinsbuchhandlung 1832) nach Lewalds »Gonzales de la Mara« die Novelle »Der schwarze Manufrio« (»Gesellschafter« 1831, Nr. 72–79). Was er an frei erfundenen Novellen den Zeitschriftenlesern bot, unterschied sich nicht wesentlich von den von ihm so sehr verurteilten Almanachsnovellen. Ob es nun »Sittengemälde« (diese realistische Terminologie hatte sich Schiff rasch angeeignet) »Schwänke« oder »Episoden« waren [* Die Titel und genauen bibliographischen Angaben finden sich in dem an den Schluß gestellten »Verzeichnis der Werke Hermann Schiffs«] , immer sind es Augenblickswünschen des Publikums angepaßte, oft wie hingeschleudert anmutende novellistische Skizzen, die von einer Reform des Genres, wie man sie von Schiff erhoffte, nichts merken ließen. Er machte (diese Arbeiten erschienen sämtlich im »Gesellschafter« und im »Freimütigen«) offensichtlich den Bedürfnissen der Herausgeber und der Leser Zugeständnisse, wenn er derartige Nichtigkeiten publizierte. Anderes und Besseres wollte man in Journalen nicht; deshalb mußte sich Schiff, der auf den materiellen Ertrag seiner Schriftstellerei angewiesen war (was nur ein mildernder, kein entschuldigender Umstand ist), vielleicht sehr gegen seinen Willen Liebedienereien gegen das Publikum schuldig machen.
Er vergaß darüber nicht, sich, wenn er nur konnte, nach seinen eigenen Neigungen literarisch auszuleben. Noch immer glühte in ihm die alte Hoffmannbegeisterung, jetzt vielleicht noch stärker als in der Zeit des »Katermurrnachlasses«. Als Fortsetzer Hoffmanns hatte er seinen ersten dichterischen Versuch gemacht; jetzt kam er auf dem Umwege über Frankreich unter der Führung Balzacs wieder zu Hoffmann zurück. Die kleinen Geschichtchen »Die Geistererscheinungen«, »Ein orientalisches Märchen«, die schon 1832 im »Gesellschafter« (Nr. 200) abgedruckte Episode »Der starke Bär« aus der erst 1838 erschienenen Märchennovelle »Gevatter Tod« u. a. zeigen die stärkste Beeinflussung Schiffs durch Hoffmann. Dagegen wird man in den Berliner Jahren eine Einwirkung anderer Romantiker nicht wahrnehmen können. Nur ganz äußerlich wurde er mit einem, nämlich mit Clemens Brentano, zusammengekoppelt, dessen »Drei Nüsse« mit einer Novelle Schiffs »Varinka oder die rote Schenke« zu einem Bande vereinigt wurden. Das war nur das Werk des Verlages, der Gubitz gehörigen Vereinsbuchhandlung, daß diese beiden »Volkserzählungen« aneinandergefügt wurden. Gubitz hatte Brentanos Novelle 1817 im »Gesellschafter « (Seite 521–523) zuerst veröffentlicht, und so mochte er sich jetzt für berechtigt halten, sie der zu wenig umfangreichen Erzählung Schiffs beibinden zu lassen. Unrichtig sind natürlich Heckschers Angaben (a. a. O. Seite 135), daß »Die drei Nüsse« unter Clemens Brentanos Namen erschienen seien, also Schiff zugehörten, und die Goedekes, der der Ansicht gewesen zu sein scheint, die beiden Novellen seien ein gemeinsames Werk Schiffs und Brentanos.
»Varinka oder die rote Schenke« geht auf ein französisches Werk zurück: L´hermite en Russie par Dupré de St. Maure. In einer Übersetzung von A. Kaiser erschien dieses unter dem Titel: »Rußland, wie es ist.« (Zwei Bände, Leipzig, Rank, 1830.) In dem französischen Original finden sich zwei Novellen, die für russische Verhältnisse charakteristisch sein sollen. Sie sind keine Originaldichtungen des Franzosen; die eine, »Varinka«, ist eine Übersetzung einer Geschichte Meißners, die sich in dessen »Skizzen« findet. Das wußte Schiff nicht, der mit seiner Bearbeitung der französischen Vorlage eigentlich nur eine Rückübersetzung ins Deutsche lieferte. In den Voraussetzungen und ihrem Aufbau ist die Novelle ungewöhnlich geschickt. Ein sehr entschlossener, strenger russischer General hat eine schöne Tochter, Varinka, um die sich sein Adjutant Fedor bewirbt. Das Mädchen erwidert die Neigung und gestattet dem Geliebten, mit dem Vater zu sprechen. Nur darf er dabei nichts davon erwähnen, daß sie ihm gewogen sei. Sie ist eine durchaus verschlossene Natur geworden, und zwar durch den Einfluß einer englischen Erzieherin, die ihr nichts anderes predigte, als den Männern kalt und streng gegenüberzustehen. Fedor muß von dem General abgewiesen werden, und zwar deshalb, weil dieser das Mädchen schon vor vielen Jahren einem andern versprochen hat. Diese Abweisung empört Varinkas Stolz, sie ergibt sich Fedor, was von einem Kammerdiener dem General verraten wird. Dieser will in das Zimmer des Mädchens eindringen, wo sich gerade Fedor aufhält, der mühsam in einem schweren Kasten verborgen wird. Während der General lange die Zimmer untersucht und dann, da er nichts findet, eine halbe Stunde lang eine englische Abhandlung vorträgt, erstickt Fedor. Varinka und ihr Kammermädchen wissen sich keinen anderen Rat, als daß sie den Toten von dem Kutscher Peter fortschaffen lassen. Peter gilt als verschwiegen. Da er aber nach der Tat mit Geld sehr verschwenderisch umgeht, fällt das dem Kammerdiener auf, der ohnehin Verdacht hat, und er sucht, Peter zum Sprechen zu bewegen. Sie befinden sich einmal im roten Kabak (=Schenke), wo Peter wettet, er vermöge es, sein Fräulein zum Besuch der Schenke zu bewegen. Sie muß dies tatsächlich tun, da sie fürchtet, Peter könnte im Rausch verraten, daß sie eigentlich einen Mord (dessen sie sich selbst anklagt, übrigens fürchtet sie natürlich auch um ihren guten Ruf) verübt habe. Sie geht in die rote Schenke, bringt einen mit Opium vermischten Likör mit und gibt ihn den Anwesenden zu trinken; diese sinken in Schlaf, und dann zündet Varinka die Schenke an, wobei alle Anwesenden umkommen. Sie geht nach Hause, macht den Karneval lustig mit, aber in den Fasten erfaßt sie Reue, sie beichtet, und da der Pope ihr die Absolution nicht geben will, ist sie ganz verzweifelt. Durch diesen Popen kommt die Geschichte an den Tag; er verletzt das Beichtgeheimnis seiner Frau gegenüber (das Motiv aus Chamissos »Die Sonne bringt es an den Tag«), ihr Kind belauscht das Gespräch, und einmal in einer Kirche beschuldigt dieses Varinka, daß sie die rote Schenke habe anzünden lassen. Varinka geht in ein Kloster, wo sie büßt und bereut.
Diese »Varinka«, mit ihren wilden und brutalen Effekten, bedeutet bereits eine starke Abkehr Schiffs von den Wegen der romantischen Poesie. Allerdings könnte man in der Heldin eine Gestalt sehen, die ein Abbild der bei den Romantikern so oft vorgeführten Amazonen ist. Denn die vor nichts zurückschreckende Grausamkeit und Kälte Varinkas macht sie einer Penthesilea und Wanda nicht unähnlich. Auch das slavische Milieu ergibt einen Anklang an romantische Vorbilder. Aber die ganze Entwicklung des Themas, vor allem die Hingabe der Heldin in freier Liebe, bekundet schon aufs stärkste, daß Schiff sich den Einwirkungen der Tendenzen des »jungen Deutschland« nicht ganz zu entziehen vermochte. Varinka stellt noch eine Mischung romantischer und jungdeutscher Dichtweise dar. (Der versöhnende Schluß, das Zurückziehen in ein Kloster, ist sicherlich wieder durchaus romantisch.) Zwischen diesen beiden Extremen pendelte Schiffs Novellistik jetzt immer hin und her. Ein 1835 erschienenes Bändchen, das fünf ungleichwertige und ungleichartige Erzählungen vereinigte, denen der Autor den gespreizten Titel »Novellen und Nichtnovellen« gab (er meinte unter den Nichtnovellen Märchen), offenbart dieses Schwanken aufs deutlichste. Rein romantische Märchen stehen neben einer brutalen Tendenznovelle. Wie von einem strahlenden Abendsonnenglanze übergoldet, grüßt aus diesem Band noch Schiffs letztes rein romantisches Gebilde, das feine, zarte Märchen »Der Kristall«, als sein warmer Abschied von der Dichtung seiner Jugend. In diesem Märchen zeigt er, wie ausgezeichnet er das Erbe der Romantiker hätte verwalten können, wenn ihm die Zeit und ihr Geschmack mehr entgegengekommen wären. Es ist eine einfache Liebesgeschichte zweier jungen Menschen, die sich wegen ihrer Armut nicht heiraten können. Die Eltern versprechen ihre Tochter einem reichen Jüngling. Das Mädchen träumt, eine Zauberin überbringe ihm einen Kristall, der ihm die Zukunft offenbare. Diese ist traurig genug; denn der verschmähte arme Geliebte werde es erschießen und sich dann selbst den Tod geben. Diesen Traum glaubt die Braut, wirklich erlebt zu haben, und es ist plastisch und glaubhaft dargestellt, wie sie sich in diese Phantasie immer mehr hineinredet, bis sie zugrunde geht. In diese Geschichte spielt das alte lukianische Thema von der vergessenen Entzauberungsformel ebenso wirksam hinein, wie in ein zweites Märchen, »Alban und Alba«, das Hoffmannsche Doppelgänger- und das Oberonmotiv von der Belohnung eines Liebespaares, das sich unbedingt die Treue hält und dem eine Gottheit dafür einen Talisman verleiht, der es aus schweren Gefahren befreit. »Alban und Alba« ist ebenfalls ein echtes und rechtes romantisches Produkt. Helden sind ein fahrendes Sängerpaar, das – wie Tiecks Sternbald, Dorothea Schlegels Florentin u. v. a. – improvisierte Lieder vorträgt; die beiden ziehen als echte Romantiker zweck- und ziellos umher, und ihr liebster Aufenthalt ist der Wald, dessen Poesie Schiff begeistert preist. Er ist sonst niemals so weich und lyrisch gewesen wie in diesem Märchen, und diesmal ist ihm auch neben manchen schwachen ein hübsches Lied gelungen, von dem zwei Strophen hier wiedergegeben seien:
»Wir Vögel schweben in himmlischen Räumen,
Wir singen von lieblichen, glänzenden Träumen,
Tief unter uns die Wolken ziehn
Über Berge und Seen und Felder dahin.
Tirilei, Tirilei, Tirilei!
Und der Wind spielt auf die Melodei.
Wenn Lüfte durch prangende Fluren wehn.
Da nicken die Blumen mit Häuptern so schön,
In tausend Farben mit Funken und Glanz
Verübt das Licht seinen goldenen Tanz.
Tirilei, Tirilei, Tirilei!
Und der Wind spielt auf die Melodei.«
Der Reiz dieses Märchens liegt lediglich in dem anmutigen und wirklich keuschen Ton, in dem es vorgetragen wird; stofflich weist es zu viele Anklänge an sehr bekannte Vorläufer auf, als daß es völlig befriedigen könnte. Außer den bereits hervorgehobenen Anlehnungen verwendet Schiff auch in stärkster Weise das Amphytriomotiv, nur daß diesmal nicht ein Gott, sondern eine Göttin in der Gestalt einer Ehefrau auftritt, um ihre Verführungskünste zu üben. Geschmackvoll ist diese Variante kaum zu nennen, schon deshalb nicht, weil eine Frau, die sich solcher Mittel bedient, um einen Ehebruch zu begehen, niemals erfreulich wirken kann. Gelten lassen kann man diese Änderung nur darum, weil der Ehebruch nur versucht und nicht vollbracht wird. Das Märchen klingt nämlich, wie bei Schiff fast immer, tragisch aus: der Ehemann sieht seine Gattin in doppelter Gestalt; trotz der verschiedensten Proben, die er anstellt, kann er nicht herausfinden, welche die richtige sei. Endlich glaubt er, diese erkannt zu haben, und tötet die vermeintlich falsche Gattin. Zu spät erkennt er, daß er sein eigenes Weib erschossen habe. Als blinder Spielmann irrt er dann durch die Lande.
Eine dritte Novelle »Zwei Fliegen mit einer Klappe« [* Erstdruck im »Freimütigen«, 1833, Nr. 229–236] steht auf der Scheide zwischen Romantik und »jungem Deutschland«. Zwei Männer geraten in Zwist wegen ihrer romantischen bzw. realistischen Neigungen. Während der eine namentlich Jean Paul verherrlicht, findet der andere ihn und alle Dichter, die in unbestimmt schwärmenden Gefühlenaufgehen, lächerlich. Schiff entscheidet sich nicht, für welchen von beiden er Partei ergreifen soll. Seine Stellung bleibt – und das ist ein bemerkenswertes Zeugnis für seine allmählich ins Wanken geratene Auffassung – unentschieden.
Eine vierte Novelle »Gundlingen« [*1846 ließ Schiff die Geschichte unter dem Titel »Das Tabackskollegium« in Pappes »Lesefrüchte« (IV. Band, Seite 358ff.) wieder erscheinen] kann insofern noch der romantischen Periode Schiffs zugezählt werden, als die Vorliebe der Romantiker für Neubearbeitungen alter Volksbücher, Chroniken usw. zur Geltung kommt.
Die Figur des Gundlingen mag Schiff wohl wegen seiner eigenen ähnlichen Veranlagung zur Darstellung gereizt haben. Wie Gundlingen war auch er dem Trunke ergeben, und obwohl beide graduierte Leute waren, dienten sie den Zechkumpanen als Stichblätter oft sehr roher Scherze. Die Autobiographie Gundlingens, die Schiff vorträgt, geht auf Daniel Faßmanns »Elisäische Felder« zurück. Nur ist vieles gekürzt, anderes verbessert, die Sprache teilweise modernisiert, das ganze neu geordnet. Es ist wenig interessant, was man von Gundlingen aus dieser Icherzählung erfährt; die Schwänke, die mit dem immer Volltrunkenen aufgeführt wurden, sind roh und meist widerwärtig.
In dieser Novelle liegt die Bedeutung dieses Buches nicht. Sie ist vielmehr in der nach dem Französischen geschriebenen Novelle »Johann Faust in Paris 1463« zu sehen. Denn hier schwenkt Schiff offenkundig von der Romantik ab; er ist unverfälschter Rationalist geworden, der sich namentlich von dem Wunderglauben und den katholisierenden Neigungen seiner früheren Zeit vollständig abgewendet hat. Auf welche Einflüsse diese Abkehr zurückzuführen sein mag, ist kaum zu ergründen. Aber die Richtung, die Schiff in diesem merkwürdigen »Faust« einschlägt, hält er von jetzt ab eine Zeitlang fest. Dieser »Faust in Paris« stellt die Vereinigung zweier Persönlichkeiten dar, nämlich des Schwarzkünstlers und des Erfinders der Buchdruckerkunst. Faust will, da er vor der deutschen Inquisition fliehen mußte, in Paris seine Bibeln verkaufen. Gleich seinem Namensbruder aus dem Volksbuche ist er von sinnlichen Begierden stark erfüllt. Er läuft hinter Freudenmädchen einher und verbindet sich mit einem solchen, das ihm, da es Freunde in den höchsten weltlichen und geistlichen Kreisen hat, dabei behilflich sein soll, die gedruckten Bibeln abzusetzen. Das Mädchen erzählt einem Pater, zu welch niedrigen Preisen man jetzt Bibeln kaufen könne; der ist nach diesem billigen Gewinn lüstern, besucht Faust, kann aber mit ihm nicht ins reine kommen. Deshalb schürt er in ganz Paris gegen den Schwarzkünstler und Zauberer, predigt auf den Kanzeln und erwirkt bei der Inquisition das Recht, Faust zu verhaften. Das Mädchen macht aber den Pater trunken und verrät Faust die gegen ihn gerichteten Anschläge. Er verbrennt sein Pariser Haus und entkommt glücklich.
In diese lebendige Geschichte verflicht Schiff den wüstesten Haß gegen den Katholizismus und seine Priester. Ihm ist kein Wort des Angriffes zu scharf, um es nicht auszusprechen. Er verhöhnt den Wunderglauben, wobei er sich nicht scheut, arge Blasphemien einzuflechten, läßt Priester von der Kanzel herab predigen, daß jede Frau, die an Wunder nicht glauben wolle, demnächst eine tote Katze, eine Ziege oder ein Mondkalb zur Welt bringen werde usw. Der heftigste Groll gegen das Christentum, für das er selbst oft so glaubensstarke Worte gefunden hatte, lodert aus dieser Erzählung.
Persönliche Erfahrungen, die Schiff verstimmten, mögen diesen auffallenden Umschwung vollbracht haben; die Erkenntnis wird sich ihm nicht mehr verschlossen haben, daß zu einer Zeit, in der die Jungdeutschen, von Regierungen und Zeitungen verfolgt und verfemt, dennoch sich und ihre Tendenzen immer nachdrücklicher durchsetzten, auch er dieser Geistesrichtung entgegenkommen müsse. Ärger haben freilich die führenden Bekenner des Jungdeutschtums und alle ihre blinden Nachläufer eine der Tendenzen dieser Bewegung – den Kampf gegen Religion und Kirche – nicht geführt als Schiff in diesem »Faust«. Er ist damit nicht originell: in der Zeit von 1832–1834 findet man in Romanen und Novellen auf Schritt und Tritt diese wüsten antikirchlichen Ausschreitungen. Bei ihm muß freilich der jähe Wechsel zwischen hingebendster Gläubigkeit und schärfster Gehässigkeit sehr befremden. Denn damit vollzieht Schiff den entscheidenden Bruch mit der Romantik und nähert sich in einem wichtigen Punkte dem »jungen Deutschland«. Allerdings hat Schiff seinen romantischen Gesinnungen nicht für alle Zeit den Abschied gegeben; immer wieder sickern sie bald schwächer, bald stärker durch, und es ist fraglos, daß ihn zur Annäherung an das »junge Deutschland« nicht innere Notwendigkeit getrieben habe, sondern der Wunsch, sich anerkannt zu sehen. Denn viel hatte er für diese neuerstandene Richtung eigentlich niemals übrig, wenn er auch Börne liebte. Aber wie wenig er auf Heines Seite stand, offenbarte er bereits in auffallendster und nachdrücklichster Weise ein paar Jahre später. Mit den übrigen befaßte er sich in dieser Berliner Zeit überhaupt nicht, wenn man von der nichtssagenden Rezension desMundtschen »Basilisk« (»Der Freimütige«, 1833, Nr. 134) absieht. So verbindet also weder äußerlich noch innerlich Schiff irgend etwas mit den Bestrebungen der Jungdeutschen. Wenn er diesen dennoch in »Johann Faust in Paris« Zugeständnisse macht, mag ihn dichterische Notwendigkeit am allerletzten dazu getrieben haben. Doch läßt sich nicht verkennen, daß Schiff auch auf einem anderen Gebiete damals zwischen Romantik und Realistik planlos umherirrte; und so muß er jedenfalls allmählich an sich selbst irre geworden sein und daran gedacht haben, die unzeitgemäß gewordene romantische Schwärmerei nach und nach aufzugeben.
Auch der Dramatiker Schiff läßt nämlich die sich in seinem Innern bekämpfenden beiden kontrastierenden Richtungen sehr klar erkennen.
Mit der novellistischen Produktion Schiffs hält seine gleichzeitige dramatische gleichen Schritt. Die tiefliegenden Gegensätze seiner Epik begegnen auch hier; er schwankt zwischen der französischen Realistik und der deutschen Romantik unstet hin und her. Schiff setzt mit einer freien Bearbeitung des streng realistischen Dramas von Alexander Dumas »Heinrich III. und sein Hof« ein, jenem Trauerspiele, das die große literarische Umwälzung in Frankreich so sehr gefördert hatte. Diese Bearbeitung erschien zwar im Drucke, zu einer Aufführung wurde sie nicht benützt, wie sich ja das neuromantische französische Drama damals in Deutschland noch nicht durchsetzen konnte [* In Berlin wurde das Drama in Ludwig Roberts Übersetzung (Juli 1830) dreimal gegeben, doch hatte es keinerlei Erfolg. (Vgl. »Gesellschafter«, 1830, Nr. 108.)] . Dagegen ging eine um ein Jahr später erschienene »dialogisierte historische Novelle«, die Agnes Bernauer zur Heldin hatte, wenigstens in Berlin flüchtig über die Bühne [* Erste Aufführung am 3. Januar 1831. Wie Schiff behauptet, verhinderte der Ausbruch der Cholera die Fortsetzung der Aufführungen. Die Buchausgabe ist dem Intendanten der Berliner Königlichen Schauspiele, Grafen Redern, zugeeignet] .
Als Roman und Novelle hatte Schiff vorher den seit Hoffmann von Hoffmannswaldau immer wieder hervorgesuchten Stoff zu bearbeiten versucht, ohne ihn zu meistern. Erst als er die erzählende Form in die dialogische umgoß, war seiner Dichtung ein kurzes Bühnendasein beschieden. Das Charakteristische dieser Tragödie liegt in dem Schluß, der, wie A. Prehn in seiner Untersuchung »Agnes Bernauer in der deutschen Dichtung« (Wissenschaftliche Beigabe des Programms zu Nordhausen, Ostern 1907, Seite 7) richtig erkannte, niemals versöhnlich sein kann; deshalb griff Schiff zu dem einzig möglichen Ausweg, indem er den Herzog Albrecht an der Bahre seiner Gemahlin tot niedersinken läßt. Dieser Schluß ist übrigens nicht ganz unhistorisch. In Trithemii Chron. Hirsaugiens (II, 392) heißt es: »Et qui vivam ultra debitum amaverat, pro mortua, cadens in terram, ut mortuus iacebat.« Schiff geht weiter als seine Quelle, indem er Albrecht nicht nur »wie tot« daliegen, sondern wirklich sterben läßt. Er motiviert dies damit, daß er in Albrechts fernerem Leben nichts mehr Poetisches und Erfreuliches finde. Er sei in der Geschichte moralisch tot, physisch tot wünsche ihn das Gedicht. Jedenfalls habe der Dichter daher das Recht, den Rahmen seines Bildes da zu schließen, wo er seine Wirkung erregt zu haben glaube.
So künstlerisch der Schluß des Stückes berührt, so wenig Eindruck vermag die übrige Dichtung zu machen. Schiff hat sich stark von der »Agnes Bernauerin« des Grafen Törring beeinflussen lassen, und das hat seinem Drama nicht gerade genützt. Die Bearbeitung ist unbeholfen und undramatisch, die Charakteristik unlebendig, die Führung der Handlung verschwommen. Schiff war sich dessen wohl bewußt, »welcher Aufgabe er sich unterzogen habe, ein so viel gespieltes Stück, wie das des Grafen Törring, neu zu bearbeiten [* Vgl. seine Bemerkung zu dem nicht aufgeführten, nur im »Gesellschafter« (1830, Beilage zu Nr. 207) abgedruckten Vorspiele des Dramas] . Nichtsdestoweniger hat das Stück den Zeitgenossen recht gut gefallen. Ein Berliner Theaterbericht der Dresdener »Abendzeitung« (1831, Nr. 51) meinte, daß niemand nach diesem ersten Versuch Schiffs Beruf »zum« Dichter verkennen werde; die Tragödie werde durch einige Veränderungen einen Gewinn für die deutsche Bühne bilden. Und der Buchausgabe dieses Dramas rühmte es dasselbe Blatt (1831, Nr. 230) sogar nach, daß es gewiß zu dem Besten gehöre, was die neuere Zeit in diesem Genre gebracht habe.
Im »Literaturblatte zum Morgenblatt« (1832, Nr. 48) meinte Wolfgang Menzel, daß das Stück besser sei als manche andere Jambentragödie. »Das schöne bürgerliche Mädchen, das von einem Prinzen geehelicht und dann von dessen stolzem Vater ermordet wird, muß in dieser anspruchslosen Darstellung die Teilnahme des Publikums erregen.« –
Das nächste dramatische Produkt Schiffs heißt: »Der Graf und der Bürger«. (Trauerspiel in vier Akten; Gubitz' »Jahrbuch deutscher Bühnenspiele, 12. Jahrgang, 1833, Seite 247–328.)
Das Motiv und seine Bearbeitung sind veraltet. Ein Gutsbesitzer Arnstein ist verlobt. Er erfährt lauschend (!), daß der regierende Minister vorgegeben habe, er sei in Beziehungen zu der Braut Arnsteins gestanden. Das ist freilich unwahr und nur gesagt worden, um einen rege gewordenen Verdacht, daß der Minister die Schwester seines Herzogs liebe, zu entkräften. Peinlich berührt schon in dieser Vorgeschichte, die stark in Sentimentalität getaucht ist, zweierlei: einmal, daß der Herzog nichts anderes zu tun hat, als einen Preis für den auszusetzen, der hinter das Geheimnis der Liebe seines Ministers komme (was taktlos ist und ihn nichts kümmern sollte), zweitens aber, daß der Bräutigam durch einen schwach motivierten Zufall horchend erfährt, seine Braut sei früher einmal dem Minister freundschaftlich zugetan gewesen. Durch Horchen Aufklärungen zu erhalten, ist immer ein naiver, wenig glaubwürdiger Zug. Noch abgeschmackter wird dieses Motiv dadurch, daß der Bräutigam zwar zuerst fest daran glaubt, seine Braut habe ihn belogen, ihr auch die heftigsten Vorwürfe zuschleudert, aber plötzlich, ohne daß man wüßte, warum, ihr alles abbittet. Damit wäre die Geschichte zu Ende, wenn nicht ein sehr stolzer Bruder der Braut seine Schwester noch immer für beschimpft hielte und die Hochzeit nicht stattfinden ließe. Inzwischen bekommt der Bräutigam die Aufklärung, daß der Minister sich einen Scherz mit seiner Braut erlaubt habe. Er stellt ihn zur Rede und erhält für sein Stillschweigen Geld angeboten. Nun folgen entsetzliche Tiraden über Bürgerstolz und Bürgerehre, die nicht um Geld feil seien. Der Minister wird dadurch so gerührt, daß er widerrufen will. Freilich auf die Aufforderung, zu bekennen, wo er in jener Nacht, als ihn der ganze Hof suchte, gewesen sei, kann er, um die Herzogsschwester nicht zu kompromittieren, nicht eingehen. Da ihm Arnstein droht, will er ihn verhaften lassen, um vor ihm sicher zu sein. Aber dieser Plan mißlingt, und der Bräutigam stiehlt im Zimmer der Herzogsschwester einen Brief des Ministers, der diesen kompromittieren muß. Darauf läßt ihn der Minister erschießen. Aber durch das von Arnstein gestohlene Schreiben, das er seiner Braut noch vor seiner Ermordung übergeben hat, kommt alles an den Tag. Der Minister wird als Mörder verhaftet und nur insoweit begnadigt, als ihm der Fürst Gift in das Gefängnis mitgibt, an dem er wohl sterben wird.
Diese Tragödie steht im vollen Widerspruche zu Schiffs sonstigen Anschauungen. Hier bricht seine antiromantische, demokratischeGesinnung wiederholt durch. Sogar der Minister hat demokratische Anwandlungen; müßte also darüber von Arnstein nicht belehrt werden. Eine Reihe von Fragen findet in dem Stücke keine Beantwortung. Warum muß Hugo Arnstein unschuldig sterben? Warum muß seine Braut Helene leiden, indem sie den Bräutigam verliert, sie, die doch gewiß nichts getan hat? Sie ist eine zweite Agnes Bernauer, nur daß nicht ihr Leben mit dem gewaltsamen Tode endigt, sondern das ihres Bräutigams, wie ja Schiff auch schon in der »Agnes Bernauerin« Albrecht sterben ließ. –
Von dem Lustspieldichter Schiff läßt sich ebensowenig Erfreuliches berichten, wie von dem ernsten Dramatiker. Sein »Aprilmärchen« oder »Der gefährliche Harnisch« ist kaum ein Aprilmärchen, weit eher ein recht langweiliger Aprilscherz.
Dieses weniger phantastische als parodistische Lustspiel, das mit Tieckschen Mitteln, aber nicht mit Tiecks Urkraft die Motive der spanischen Ritterstücke zu verspotten sucht, zeigt, wie Schiff zum Bühnendichter eigentlich alles fehlte. Er ist auch als Dramatiker Novellist, der endlose Reden für dramatisches Geschehen hält. Das Motiv des Stückes wäre nicht so übel. Es ist eine Parodie auf den Cidstoff, indem diesmal nicht ein toter Held den Mauren derartigen Schrecken einjagt, daß sie schon bei seinem Anblicke fliehen, sondern bloß die Rüstung eines siegreichen Heerführers, der sie aber einem feigen Seneschall umlegt, während er selbst zu einem Stelldichein mit einer sehr phantastischen Prinzessin eilt, in deren Dienst und zu deren Ruhm er alle seine Taten verrichtet. Manches ist in dem Stück lustig, und fast Shakespearischer Humor blitzt an ein paar Stellen auf. Aber wenn man auch über den Seneschall, das getreue Abbild des Shakespearischen Tobias von Rülp manchmal herzlich lachen kann, allmählich arten die beständigen Reden der Personen zu sehr ins Breitspurige aus, als daß man mit Behagen den Vorgängen folgen könnte. Wo Schiffs derber Humor durchbricht, ist das Stück am wirksamsten. Nur die fortwährenden Kopien der Manier Tiecks und Shakespeares werden lästig, und eine Schlußapostrophe, ganz nach dem Muster von »Was ihr wollt«, aber leider in etwas gezwungener Lustigkeit, erzeugt nur verstimmende Wirkung [* Szenen aus diesem Lustspiele erschienen 1831 im »Gesellschafter« (Nr. 196–197); das ganze Werk in Gubitz' »Jahrbuch deutscher Bühnenspiele« (11. Jahrgang, Berlin 1832)] . –
Der Dramatiker Schiff übt, wie die Analysen seiner Stücke zeigen konnten, einen wenig erfreulichen Eindruck aus. Immer wieder bricht die epische Veranlagung des Dichters durch, und ihr ist er auch fortan – mit der einen Ausnahme der Bearbeitung eines französischen Dramas – immer treu geblieben.
Daß Schiff sich zu der Übertragung dieses Dramas verstand, lag lediglich daran, daß ihm das Sujet, das Romantiker immer stark angezogen hatte, behagte. Es ist ein »Salvator Rosa« von Ferdinand Dugue, den Schiff überarbeitete. (Im Verlage des Hamburger Theateragenten C. A. Sachse in den Fünfzigerjahren (ohne Jahreszahl) erschienen.) Der Stoff des »Salvator Rosa« gehört in der Zeit der Romantiker zu den meist bearbeiteten [* Vgl. mein Lyserbuch, Seite 155ff, wo verschiedene Bearbeitungen besprochen werden] .Schiff mochte wohl eine innerliche Wesensverwandtschaft mit der Gestalt des »Salvator Rosa« fühlen, weshalb er die Bearbeitung des französischen Dramas unternahm. Allerdings scheint ihm auch diesmal ein theatralischer Erfolg versagt gewesen zu sein; eine Aufführung dieses »Salvator Rosa« ist nicht nachzuweisen.
Dieser letzte dramatische Versuch Schiffs fällt schon weit außerhalb seines Berliner Aufenthaltes, der gegen das Ende des Jahres 1835 jäh abgebrochen wurde. Voran ging diesem unseligen Schritte eine heftige Polemik mit Christian Dietrich Grabbe. Beider Dichter äußeres Wesen sollte eine Gegnerschaft von vornherein ausgeschlossen erscheinen lassen. Wie vieles sie miteinander gemein hatten, ist schon früher gezeigt worden. Aber so sehr sie einander in ihrer Lebensführung glichen (auch die Sehnsucht beider, schauspielerisch zu wirken, verbindet sie), so wenig stimmten sie in ihren poetischen Anschauungen überein. Das offenbarte sich am schlagendsten darin, daß Schiff Grabbes Hohenstaufendramen im »Gesellschafter« (1830, Beilage Nr. 80) scharf angriff. Er warf ihm vor, daß er mit großen Stoffen leicht fertig werde oder sie leichtfertig behandle und daß er seine Kräfte überschätze. Doch verkannte er nicht, daß, »wer solche Gedanken und Verse habe, ein Dichter sei.« In seinem »Cid« nahm nun Grabbe eine wenig vornehme Rache. Die Entstehung dieser Satire muß man mit Oskar Blumenthal (Grabbes sämtliche Werke, Detmold 1874, IV. Band, Seite 90) sicherlich erst in die Dreißigerjahre verlegen. Für mich ist kein Zweifel, daß schon die Wahl des Cidstoffes, um darin verschiedentlich literarische Rache zu nehmen, einen Angriff auf Schiff bedeutet, der im »Aprilmärchen« denselben Stoff satirisch vorarbeitet hatte. Grabbe hätte gewiß ebenso gut irgendein anderes heroisches Thema als Grundlage seiner recht lose zusammenhängenden Verhöhnungen erwählen können, die übrigens, so weit sie Schiff betreffen, weder allzu wirksam noch allzu treffend sind.
Von diesem einzigen Angriff abgesehen, verlief Schiffs Berliner Zeit ruhig und friedlich. (Grabbes »Cid« dürfte er wohl erst 1845 in Arthur Müllers »Moderne Reliquien« kennen gelernt haben, wenn ihm nicht vielleicht Immermann das Manuskript schon früher zeigte.) Dennoch begann ihm Berlin nicht zu behagen: seine Ruhelosigkeit scheuchte ihn fort. Die übergroße Nüchternheit, die Berlin in der Mitte der Dreißigerjahre erfüllte, mag den Entschluß, die preußische Hauptstadt zu verlassen, in ihm bestärkt haben. Von dem ungebundenen Wanderleben, wie es die Romantiker so oft verherrlicht hatten, erhoffte er sich die stärksten Impulse für seine Dichtung. Berlin bot seinem skurillen, phantastischen Dichtergemüte gewiß wenig Nahrung. Dort hatte neuerdings der Geist plattester Aufklärung um sich gegriffen, der Schiff unmöglich zusagen konnte. Und so verschwand er eines Tages und blieb monatelang völlig verschollen. Er fühlte nur zu gut, daß er in Berlin nichts mehr zu sagen hatte. Deshalb wollte er es versuchen, auf anderem Boden sein dichterisches Glück zu finden. Fehlgeschlagene Hoffnungen müssen es allein gewesen sein, die ihn dazu drängten; denn mit seinen literarischen Freunden stand er sich vortrefflich. Aber er lohnte ihnen nach seinem Ausmarsche aus Berlin ihre Zuneigung schlecht. Kaum hatte er ihnen den Rücken gekehrt, als er sie gänzlich ignorierte. Er ließ nichts mehr von sich hören, so daß man ihn allgemein für – – tot hielt. Willibald Alexis schrieb ihm sogar einen ausführlichen, warmen Nachruf, der die tiefsten Einblicke in Schiffs Wesen gewährt, und der wegen seiner Bedeutung ausführlich wiedergegeben werden muß.
In dieser Charakteristik (»Der Freimütige«, 5.–7. November 1835, Nr. 220–222) heißt es: »Erinnerungen an Daniel (sic!) Schiff. Es war in den ersten Monaten dieses Jahres, als der talentvolle Doktor Daniel Schiff Berlin verließ, um seine Vaterstadt Hamburg zu besuchen. Er schied von seinen Freunden mit der festen Zusicherung, sogleich nach seiner Ankunft von sich hören zu lassen, und auch dem damaligen Redakteur dieser Blätter [* Willibald Alexis, der Ende 1835 die Redaktion an W. Albrecht übergeben hatte] hatte er sein Wort gegeben, noch vom Wege aus Mitteilungen zu senden. Er versprach sich, in seiner eigentümlichen Weise die Dinge zu betrachten, einen besonderen, humoristischen Genuß von der Art, wie er diese Reise unternahm; denn trotz des regnerisch-unbeständigen, kalten Frühjahrs, trotz der durchnäßten, schlechten Wege war es sein fester Wille, sie ganz zu Fuß zu machen. In einem schlechten grauen Überrock, ohne anderes Gepäck, als was er in die Taschen stecken konnte, einen großen Stab in der Hand, wanderte er, nicht ohne Besorgnis seiner Freunde, aus den Toren von Berlin. Aber er selbst vergnügte sich schon in Gedanken, wie er regentriefend am Abend in der ersten besten Dorfschenke einsprechen und neben den Stammgästen und Honoratioren einen Platz am brennenden Herde erbitten würde, wie er auf ihre Fragen antworten, Geschichten erzählen und Geschichten hören wollte. Er freute sich auf die Gesellschaft von Handwerksburschen, Kärrnern, Gendarmen und allenfalls Transporten von Strafgefangenen, mit denen er des Wegs ziehen und, eine Pfeife rauchend, Gedanken auszutauschen und Menschenkenntnis einzusammeln hoffte. Aber der moderne Seume und Arndt täuschte sich, wenn er, trotz seiner unverkennbaren dichterischen Gaben, die er zu haben meinte, sich in die Menschen zu finden und sie glauben zu machen, er gehöre zu ihnen, hoffte. Schiff konnte alles eher, als sich in den Verhältnissen zurechtzufinden. Man muß es ihm auf die erste Frage, auf den ersten Blick, auf die erste Bewegung mit den Händen angemerkt haben, wer er war, wenigstens daß er nicht zu jener ehrenwerten Klasse gehörte, zu der er sich zu gesellen vorhatte ...
Überdies sind die Anwohner auf der großen Kommerzialstraße nach Hamburg nicht mehr im Stande der Unschuld und ihre Blicke in realen Dingen schärfer als die des unglücklichen Dichters. Noch was die Besorgnisse seiner Freunde um vieles steigerte, trug er einen kostbaren Ring, den er mit einer Art abergläubischer Scheu nie vom Finger ließ. Auch beim Ausgehen aus Berlin war er nicht zu bewegen, ihn einzustecken, und der flimmernde Edelstein vertrug sich schlecht mit den baumwollenen Zwickelhandschuhen, dem Knotenstock und dem groben Rocke ...
Er hat keine Mitteilungen eingesandt, er hat keinem seiner zahlreichen Freunde hier geschrieben, aus Hamburg verlautet nichts von seiner Ankunft, er ist fast seit einem Jahre verschwunden und der betrübtesten Vermutung ein weites Feld eröffnet. Der Weg, den seine Phantasie ihn vielleicht gedrungen, einzuschlagen, ist nicht bekannt; aber selbst auf dem bekanntesten weiß, wer die Hamburger Tour gemacht, welche Gefahren in den ausgefahrenen Hohlwegen jenseits der preußischen Grenze, in der Nähe von Britzenburg oder in den Marschländern der Elbe, dem verspäteten Reisenden drohen.
Müssen wir den Verschollenen als einen Verlorenen betrachten, so ging in ihm eines unserer originellsten Talente viel zu früh unter. Schiff kann kaum das dreißigste Jahr erreicht haben. Aber selten hat ein Dichter so entschiedenes Unglück. Ich rechne nicht dahin, daß er, in großer Wohlhabenheit erzogen, durch einen Vermögensumschlag in seiner Familie plötzlich arm wurde, denn sein Sinn war über diese Unglücksfälle hinaus. Echter Dichter aus der Zeit, wo es noch kein Bewußtsein und keine Spekulation gab, gingen seine Sorgen nicht über den Augenblick hinaus. Er jubelte, wenn er etwas hatte, und darbte, wenn er nichts hatte. In dieser Kunst, zu darben und dabei liebenswürdig und heiter zu bleiben, suchte er seinesgleichen. Aber sein Unglück war die merkwürdige Nichtanerkennung, die seine Dichtungen gefunden. Wenn das Schicksal lang ungerecht war gegen echtes Talent, irgendwie und wo kommt die Anerkennung! Und unsere Zeit, in allem rascher als die vorigen Jahrhunderte, holt gewöhnlich noch den Lebendigen ein, um ihm Balsam auf die Wunden zu träufeln und einen bescheidenen Kranz auf den kahl gewordenen Scheitel zu drücken. Schiff war wohl schon zehn Jahre öffentlich aufgetreten, aber noch hatte weder das Publikum noch die Kritik die Notiz von ihm genommen, auf die sein Talent Anspruch hat. Von seinem ersten Buch, einer Studentenhumoreske, die in ihrem Kreis gefallen hat, »Pumpauf und Pumprich«, wurde ihm sogar die Autorschaft abgestritten. Er selbst sprach nicht gerne davon, als einem Produkte jugendlichen Übermuts. Sie hat, wenn auch in barocker Manier, ihre Verdienste, doch bleibe sie immerhin vergessen. Eben desgleichen bleibt der Ruhm, den seine dramatischen Arbeiten in Anspruch nehmen, zweifelhaft. Seine »Agnes Bernauerin« bekundet freilich die ganze dichterische Innigkeit, den Naturhauch und Naturdunst der Empfindungen, in dem Schiffs Poesie ihren Kulminationspunkt hat, aber als Drama ist das Ganze allzusehr subjektiver Guß, der der Gestaltung entbehrt. ...
Seine Märchen und Novellen gehören dagegen zu den sinnreichsten Phantasien und ausgebildetsten der neueren Zeit. Das Märchen »Alban und Alba«, die schauervolle Erzählung »Varinka«, die psychologisch humoristischen Novellen »Zwei Fliegen mit einer Klappe« und »Der Häßliche« und andere würden dem Verfasser einen Ehrenplatz in der Literatur sichern, wenn sein Unglücksstern nicht gewollt, daß sie in den Zeltungsblättern übersehen und, in Sammlungen erschienen, nicht beachtet wurden. An Tiefe der psychologischen Auffassung, an Schmelz in den lyrischen Partien wetteifern sie mit Tiecks Novellen und würden mehreren darunter wenig nachgeben, wenn Schiff Tiecks Weltblick besäße. Er kann aber nur kleine Segmente aus dem Globus herausschneiden, für das Umher ist er blind.
Am sichtbarsten war dieser Unglücksstern bei seiner Übersetzung der »peau de chagrin« von Balzac. Unter dem sinnvoll umgearbeiteten Titel »Elendshaut« [* Ein Flüchtigkeitsfehler von Alexis. Schiff schrieb »Elendsfell«] lieferte Schiff nicht eine Übersetzung, sondern eine der geistvollsten Parodien der Balzacschen Schrift. Kaum eine Seite in Schiffs Arbeit ist Eigentum des Franzosen. Die Charaktere der Fabel, den Dialog umschmelzend, bemühte er sich, die verkehrten Richtungen der französischen Romantik zu persiflieren, und glaubte nicht anders, als daß jeder Leser dies auf den ersten Blick sehen und anfangs sich verwundern, dann den Schalk erkennen würde. Denn so gegen sein eigenes Fleisch wüten kann kein Franzose. Schiff erwartete Ruhm und Ehre bei der Entdeckung. Aber sein Plan war zu fein angelegt für das Publikum. Man las die »Elendshaut« mit Vergnügen und gab sich nicht Mühe, darüber nachzudenken. In den gedruckten Kritiken wurde Schiffs Arbeit als eine recht gelungene, treue Übersetzung gerühmt! Das war selbst für seine Lebensphilosophie zuviel.
Daniel Schiffs Persönlichkeit war eine der merkwürdigsten und hat nicht wenig dazu beigetragen, dem Sukzeß des Schriftstellers zu schaden. Sein Wesen, sein Benehmen streifte über das Kindliche hinaus. Wer, ohne ihn zu kennen, den unsteten, zerstreuten Menschen sah und dabei Fragen hörte, die man gewöhnlich schon in Tertia abgetan hat, dachte an alles andere eher als an einen geistvollen Schriftsteller. Seine Zerstreutheit überschritt alles Maß. Unbeholfen in den Verhältnissen des Lebens, ging er oft mit einer Naivität auf sein Ziel los, welche heut zu den Wundern gehört ...
Obgleich er in der Unterhaltung vom Hundertsten auf das Tausendste übersprang und durch Kreuzfragen die Sprechenden aus der Fassung brachte, wurde er doch plötzlich zum begeisterten Redner, wenn die Unterhaltung eine Ader traf, wo er zu Hause war. ...
Ein Widerwille gegen alles Sentimentale war nicht Produkt seiner ästhetischen Anschauungsweise, sondern trug einen idiosynkratischen Charakter, der selbst belustigen konnte. Er wurde unruhig, seine Zerstreutheit nahm einen krankhaften Anstrich an, die innere Natur rebellierte, wenn er eine sentimentale Lektüre anhören mußte. Ja, instinktartig witterte er, wo etwas Derartiges kommen mußte, und seine Gesichtszüge bekamen einen Ausdruck, den man nicht besser als mit dem populären Worte »ihm wird schlimm« bezeichnen kann. So war für andere seine Angst belustigend, die er in der Nähe von Kirchhöfen empfand. Auf Spaziergängen mußte man ihnen ausweichen, wenn man ihn heiter erhalten wollte. Er konnte nicht begreifen, wie ein vernünftiger Mensch hingehen, sich auf Gräber setzen, die Inschriften lesen und mit geistiger Wollust der Gestorbenen gedenken könne. Daß es geschieht, hielt er für eine Krankheit der Zeit, die ihn besonders in Berlin anwiderte.
Als Kritiker war er oft ungerecht, wie er denn überhaupt nur traf, wo er eine verwandte Natur fand. Da aber sind seine Kritiken schlagend und dabei Meisterwerke in der Form.....Am unglücklichsten, ja, recht verloren kam er sich in der jüngst vergangenen Periode politischer Aufregung vor. Hier fehlten ihm die gewöhnlichsten Begriffe, und während er im romantischen Zauber seiner sinnlichen Naturwelt fortwebte, sah er sich immer mehr außer Verständigung gesetzt mit seinen Freunden, deren Sinnen und Treiben von den Weltbewegungen affiziert und geleitet wurde. Vergebens arbeitete er, zu einem Verständnis zu kommen. Die Politik und er waren nicht Pole, sondern sich abstoßende Elemente. Es klingt wie eine Parodie, daß Dr. Schiff einst in seiner Jugend ein halbpolitisches Wochenblatt in Hamburg redigiert hat. Doch war es der Fall. In seiner treuherzigen Gutmütigkeit bekannte er aber selbst, daß ihm der Eigentümer gekündigt habe, weil er Artikel verwechselt und die Interpunktion als Nebensache außer acht gelassen hatte. Es passierte auch später wohl, daß er ein Buch rezensierte und in seiner Zerstreutheit den Titel eines andern über die Kritik setzte.
Nächst der Politik war ihm das klassische Altertum verschlossen. Er begriff nicht, wie man von Homer entzückt sein könne. Alles, was sich dem Klassischen in Auffassung und Form näherte, ließ ihn ebenso kalt, als das sentimentale Element ihn anwiderte. Mit Schiller und was ihm anhing, konnte er sich nie befreunden. Gegen Raupach war er animos. Man rechne seine Ausfälle gegen diesen verdienten Dichter nicht, wie einige wollen, einem boshaften Gemüt zu: der Naturmensch Schiff hielt es für Pflicht, zu hassen, was ihm schlecht erschien, und das christliche und Moralprinzip der Liebe gegen unsere Feinde war ihm unverständlich. »Was wollt ihr denn an mir putzen?« sagte er. »Ich bin nun einmal, wie ich geboren wurde, und ihr solltet euch freuen, wenn ihr in eurer Kulturwelt noch einmal einen Menschen findet, der kein Produkt der Nildüng ist.«
Doch wäre es ungerecht, ihm in der Poesie einen Mangel an Fortbildung vorzuwerfen. Seine letzteren Novellen spielen in den feinsten Lebensnuancen der geistig bewegten bürgerlichen Welt, während seine früheren Dichtungen sich nur unter dem Moosschatten der romantischen bewegten. Er schildert hier Menschen und Verhältnisse mit einem so wahrhaften Pinsel, als man es einem Dichter, der wenig in jenen Kreisen sich behaglich fühlte, nicht zutrauen sollte. Aber die Wurzel, aus der jene wie diese Erzeugnisse hervorwuchsen, ist dieselbe. Aus der Physik der Empfindungen erzeugen sich hier wie dort seine Menschen. Nur soweit das Empfindungsvermögen reicht, läßt er sie handeln, sprechen und ist wahr. Ein richtiger Takt leitet ihn auch hier, nie über seine Sphäre hinauszugehen. Seit der Bearbeitung des Balzac hatte er sich in die sogenannte Romantik des Familienlebens hineinreißen lassen; glücklicherweise verließ er jedoch schnell diesen glatten, schlüpfrigen Weg. In dieser Blasiertheit der Gefühle ist das Feuer des echten Naturlebens längst erloschen, wie prasselnd auch die Flammen dann und wann herausschlagen.
Schwerlich konnte ein angehender Schriftsteller sich weniger durch sein persönliches Auftreten empfehlen, als es Schiff tat. Nicht daß diese Persönlichkeit abschreckend gewesen wäre, im Gegenteil hatten seine Züge etwas Edles, seine Gestalt war von Natur wohlgebildet. Aber er besaß die Kunst, alle diese Züge zu verwischen, und der Zufall spielte gewiß immer mit, was zu seinem Vorteil sprechen sollte, zu seinem Nachteil ausschlagen zu lassen. Zu einem Mann, der auf Eleganz hielt, kam er gewiß in einem dicken Mantel, bis an die Zähne zugeknöpft, und setzte sich so zu ihm auf das Sofa....
Es liegt in der Natur der Sache, daß ein so ungewöhnlicher Mensch nur von wenigen verstanden werden konnte, und daß die gar zu befremdende Außenseite auch solche abhielt, ihn zu würdigen, welche sonst nicht gewohnt sind, nach dem Schein zu urteilen. Daraus will ich die wenige Anerkennung ableiten, die Schiff bis jetzt gefunden hat. denn diese Annahme ist mir lieber, als an ein absolutes Unglück glauben zu müssen, das, wie ein Erbfluch auf ihm lastend, ohne eigene Schuld ihn verfolgte. Diese Rücksicht allein veranlaßt mich, ein flüchtiges Bild von ihm zu entwerfen, welches Züge enthält, die ein wohlwollender Biograph sonst lieber verschweigt....
In obligatorischen Dingen war insofern kein Verlaß auf ihn, als er materielle Dinge in ihrer Bedeutsamkeit, vermöge seiner Natur, nicht zu schätzen wußte. In allen ernsteren, tieferen Verbindlichkeiten bewährte sich sein treues Gemüt. Mit derselben Heiterkeit wie sein Familienunglück ertrug er auch das, was ihn als Schriftsteller verfolgte. Nie ging ihm die Hoffnung aus, mit ungeschwächtem Eifer ging er an jede neue Arbeit, immer gestählt von dem beseligenden Glauben »das muß doch endlich gelingen.« ... In seine »Agnes Bernauer« war er verliebt, wie Kleist in sein »Käthchen von Heilbronn«. Er hat sie mehrmals umgearbeitet, erst als Erzählung, Roman, dann als Drama.
Heine wurde zuerst auf sein Talent aufmerksam.
Für die Beurteilung der Persönlichkeit Schiffs ist diese Leichenrede auf den damals noch Lebenden von der größten Bedeutung. Sie eröffnet Einblicke in das Wesen eines weltfremden Mannes, dem die primitivsten Realitäten des Daseins die ärgsten Unbequemlichkeiten bereiteten, die er niemals überwinden konnte. An Justinus Kerner, den immer Kind Gebliebenen, der zeitlebens die Münzen nicht voneinander unterscheiden konnte und an den naivsten Spielereien stets Gefallen fand, wird man gemahnt. Nur daß Kerner seinen Berufspflichlen treu nachkam, indes Schiff niemals den Obliegenheiten selbst der kleinsten Anstellung gewachsen war. Daß er ein politisches Blatt redigiert hätte, wie Alexis behauptet, ist kaum glaublich. Es dürfte sich um die Mitarbeit an der Hamburger Zeitschrift »Die Biene« handeln, der Schiff 1823 eine Anzahl Theaterkritiken und sonstige kleinere Beiträge lieferte. Möglicherweise redigierte er das Blatt eineZeitlang, wahrscheinlich aber recht unglücklich, wie er auch in seinem späteren Leben einer länger währenden redaktionellen Tätigkeit niemals gewachsen war. Er konnte sich eben in das Leben nicht schicken und klagte dieses immer an, es werfe ihm Prügel zwischen die Füße. Das Unterlassen jeder Benachrichtigung seiner Berliner Freunde von seiner Ankunft in Hamburg verrät wohl nichts anderes als einen Mangel jedes Taktgefühles. Schiff konnte sich ebensowenig in der großen Welt benehmen wie unter seinen Freunden, die er immer ohne jeden Grund vor den Kopf stieß. Sobald er innerlich mit ihnen fertig war, brach er jeden Verkehr ab. Das ist die einzige Erklärung für sein stillschweigendes Verschwinden. Aber er erreichte es, daß man sich in ganz Deutschland mit seinem unerwarteten Hinscheiden beschäftigte (vgl. besonders »Phönix«. 1835. Nr. 307) und den Verlust, den die Literatur erlitten habe, beklagte.
Das Dementi der Nachricht vom Tode Schiffs erfolgte am 16. November 1835 im »Freimütigen« Nr. 228:
»Herr Doktor Schiff ist nach glaubwürdigen Nachrichten wirklich in Hamburg angelangt und lebt daselbst zurückgezogen bei seinem Vater. Der Verlust seiner Mutter, der ihn inzwischen getroffen, hat ihn vielleicht so erschüttert, daß er für einige Zeit es selbst vorzog, den Verschollenen zu spielen. Doch arbeitet er gegenwärtig wieder an einigen Dichtungen, welche in Hamburg erscheinen sollen.«
Schiffs Tat mit einer seelischen Erschütterung, die dieser erlitten hatte, zu motivieren, konnte nur ein ihm wirklich gutgesinnter Freund, der nicht wußte, daß der von ihm Totgeglaubte später noch einigemale im Mittelpunkte sensationeller Affären stehen würde. Denn bei Schiff begegnet man häufig der Tatsache, daß in entscheidenden Abschnitten seiner literarischen Entwicklung ein merkwürdiges Ereignis eintritt, das ihn dem Interesse der Allgemeinheit naherückt. Ein Gutes hatte die falsche Todesnachricht jedenfalls, daß man nämlich – wie auch das »Morgenblatt« 1835, Nr. 306 meinte – auf ihn, der bisher so wenig gewürdigt worden war, aufmerksam gemacht wurde. Jetzt hatte Schiff nur die Pflicht, das rege gewordene Interesse durch sein Schaffen zu befestigen und zu erhalten. Anfangs gab er sich in Hamburg redlichste Mühe, dies zu tun. Er publizierte bereits 1836 zwei Novellen, die wenigstens seine neu erwachte Arbeitslust beweisen konnten. Eine davon erschien im Verlage von Hoffmann und Campe, mit dem ihn Heine jetzt in Verbindung brachte. In dessen Korrespondenzen mit Campe wird Schiffs gedacht (vgl. z. B. den Brief vom 28. Juli 1836: Werke ed. Karpeles, IX. 151); an ihn direkt schrieb Heine nur selten, sondern bediente sich immer Campes, um Schiff Antworten auf Briefe zukommen zu lassen. Es ist kaum ein Zweifel möglich, daß Campe nur auf die Empfehlung Heines Bücher Schiffs in Verlag nahm, die seinen buchhändlerischen Erwartungen kaum entsprochen haben dürften. Dies gilt besonders von der ersten Novelle »Glück und Geld«. In dieser findet Schiff den Weg zu Balzac zurück: wie dieser fast in allen seinen Werken spricht auch er eingehend über die Macht des Geldes, für das man sich alles erkaufen könne. Einzelne Details der Novelle erinnern auffallend an den »Geizhals« in den »Lebensbildern«.
Schiff hat in dieser Novelle wieder einmal drei Binnenerzählungen in eine Rahmenerzählung eingeschaltet. Drei Freunden (einem Schauspieler, einem Musiker und einem Journalisten), die es in ihrem Metier nicht sehr weit gebracht haben, wird von einem Juden ein Los angeboten. Sie lehnen den Kauf ab, weil sie mit dem Spiel ihre bösen Erfahrungen gemacht haben, die sie sich zum besten geben. Der Schauspieler hat als Kind größtes Glück im Lotterie- und Kartenspiel gehabt und dadurch 15 000 Taler angesammelt. Er ist aber so unerfahren, daß er sich von einem Juden falsches Geld aufschwatzen läßt. Bei der Ausgabe wird er verhaftet und verurteilt. Er verliert die Liebe seiner Braut, einer Schauspielerin, die ihn nur des Geldes wegen geliebt hat.
In die zweite Geschichte spielen wohl persönliche Erlebnisse Schiffs hinein. Er führt einen jungen Mann vor, der aus reichem Hause stammt und eine gute musikalische Ausbildung erhalten hat. Plötzlich stirbt ein Onkel, und das väterliche Haus muß sallieren. Jetzt heißt es Erwerb schaffen, und er komponiert eine Oper, zu deren Libretto Tiecks »Fortunat« verwendet ist, über dessen Novellistik Schiff kluge Anmerkungen macht. Da aber seine Geliebte (wohl eine Kusine), deren Eltern einen Lotteriegewinn gemacht haben, ihn jetzt, da er arm ist, wegen eines reichen Mannes aufgibt, wirft er allen Idealismus fort, verbrennt seine Partitur und wird Musiklehrer.
Der Journalist erzählt eine Novelle »Die Blondine«. DieseGeschichte ähneIt den »Bekenntnissen eines Gesinnungsflohes«, dem vorletzten Werke Schiffs. Die Heldin gleicht schon durch ihren Beruf als Putzmacherin der im »Gesinnungsfloh«. Sie liebt einen satirischen Schriftsteller (in der späteren Novelle einen radikalen Politiker). Die Handlung der »Blondine« geht von Tiecks »Jahrmarkt« aus. Bei Tieck wird von einer Frau erzählt, die 13 rote Hühner und 25 blaue Tauben hat, die zusammen 38 Eier legen, die 13 Krebse ißt und 38 Gläser Bier dazu trinkt und ihrem Mann 25 Perücken aufsetzt. Diese 3 Nummern (13, 25, 38) will die blonde Pauline in die Lotterie setzen. Der Schriftsteller Bertram, ihr Geliebter, soll dies für sie tun. er versäumt die Zeit, die Nummern werden gezogen, und er hat das Nachsehen. Nun ist es wirklich gut geschildert, wie dieser Schreck das Mädchen trifft, wie es vor Schmerz fast wahnsinnig wird und seine Liebe erkaltet. Es wird bald darauf die Geliebte eines reichen Mannes und sinkt immer tiefer.
Die Rahmenerzählung zu diesen drei Binnengeschichten (das Motiv aus »Lumpazi«, nur daß der Kauf des Loses von den drei Freunden abgelehnt wird, während ein vierter es allein kauft) ist dürftig und uninteressant.
Dem Band angeschlossen ist ein Fragment: »Der Haßliche«. eine Icherzählung. Der Häßliche erzählt seine Lebensgeschichte. Er ist ein bedeutender Rechtsgelehrter und haßt das weibliche Geschlecht wegen seiner Schönheit, die ihm völlig abgeht. Plötzlich verliebt er sich in eine Magd Lottchen und heiratet sie nach ein paar Zwischenfällen belangloser Natur. Er läßt sie ausbilden, sie kann alles, nur nicht schreiben, und Liebesbriefe, die sie erhält, beantwortet er so weibisch, daß seine Frau dadurch in den Ruf eines Schöngeistes gerät. Schiff läßt die Geschichte zur Wertherzeit spielen und glossiert Goethes Werk sehr hübsch. Schon hier, wie später in einer Schrift über Gutzkows Selbstmord, spricht er sich eingehend über den Selbstmord aus und läßt einen Marquis Werthers Selbstmord künstlerisch unmöglich finden. Bei den Franzosen töte man sich um großer Dinge willen, nicht aus Liebe. Dem gegenüber wird die Geschichte von der letzten Liebe der Ninon de Lenclos erzählt, in die sich der eigene Enkel verliebte, der sich, als er nicht erhört wurde, tötete. In der Novelle Schiffs heißt der Rechtsgelehrte Albert, die Magd Lotte. Schon in diesen beiden Namen liegt die deutliche Bezugnahme auf Goethes Roman vor, und wie bei Goethe leben Albert und Lotte in glücklichster Ehe, ein Schiffs sonstiger Eigenart, die sich immer in tragischen Ausgängen gefiel, widersprechendes Ende.
Die Novellen dieses Bandes haben bei der zeitgenössischen Kritik stärksten Beifall gefunden, der einigermaßen überraschen kann. Schiff eroberte sich jetzt einen ersten Platz in der damaligen Novellistik; man konnte sich kaum genug tun, ihn laut zu preisen. Außer dem »Phönix« (Literaturblatt 1835, Nr. 50) waren namentlich die »Literarischen und kritischen Blätter der Börsenhalle« aufs stärkste bemüht, seiner dichterischen Persönlichkeit gerecht zu werden. »Glück und Geld« gab sogar zweimal ausführlichen Anlaß, Schiffs literarische Wirksamkeit zu charakterisieren, wobei ein Referent seine Kunst unter die Tiecks stellte, der zweite hoch über diese.
Im Jahrgang 1836, Nr. 1236 urteilte Ph. von Leitner: »Die Novellen Schiffs sind immer problematischer Natur. Schiff kämpft gegen die Wirklichkeit, gegen das Leben, das ihm durchaus klein und erbärmlich erscheint, er bekämpft den Egoismus. Seine Novellen spielen immer im kleinen bürgerlichen Leben, die Liebe tritt nur weichlich und unkräftlg auf, oder sie erhält einen Beisatz, wodurch sie lächerlich und abgeschmackt wird. Er erinnert in stärkster Weise an Tieck, wiewohl dieser alles mehr auf die Spitze treibt und deshalb schärfer und markiger, dadurch auch interessanter und anregender ist. Es vereinigt sich bei Schiff, wie auch, aber in höherer Weise, bei Tieck, die Vorliebe für die Schilderung der engsten Verhältnisse der Gegenwart mit der Neigung für das Märchen, worin er sich auch schon mit viel Glück versucht hat, und diese Neigung für zwei scheinbar entgegengesetzte Gegenstände kann nur durch einen Sprung von einem Extrem ins andere ermöglicht werden. Die Charaktere weiß Schiff gut zu nuancieren und durchzuführen; hie und da fällt freilich ein Zug auf, der sich mit den übrigen nicht zu reimen scheint. Ton und Stil sind elegant und zierlich, die Ironie fein, der Verfasser kennt die kleinsten Details im Leben und weiß, sie mit Glück zu benutzen und auszumalen, die Verwicklung ist einfach und ungezwungen, sowie die Entwicklung ursprünglich und ungesucht ist.«
Auf einen völlig anderen Ton war ein Aufsatz von F. von Florencourt (ib. 1838, Nr. 1500) gestimmt: »Schiff hat bisher keine Anerkennung gefunden. Und doch ist er bei der heutigen Armut unserer Literatur eine so seltene als erfreuliche und erquickliche Erscheinung. Was die Novelle vor allem auszeichnet, ist die lebensfreundllche. poetische Stimmung seines Gemütes. Bei anderen fließen die Novellen mühsam, so bei Sternberg und – ich wage dies auszusprechen – die meisten Novellen Tiecks.« Florencourt meint dann, daß es ohne poetische Gegenstände kein poetisches Gemüt und ohne poetisches Gemüt keine poetischen Gegenstände gebe. Beides müsse sich durchdringen, ineinander verweben und zusammenleben, daß es völlig eins werde. Diese Forderung erfülle Schiffs Dichtung, diese Forderung erfüllten Tiecks Novellen nicht. Er erhebt dann auch weiter noch Schiff immer gegenüber Tieck, nur findet er, daß Schiffs Gedanken nicht so geistreich seien wie die Tiecks, seine Empfindungen nicht so tief wie die Jean Pauls. «Aber er hat Gedanken, er hat Empfindungen, er gibt Charaktere. Am meisten Ähnlichkeit hat er mit Hoffmann. So keck und kräftig wie dieser legt er freilich seine Zeichnungen nicht an, aber Darstellung und Lebensauffassung hat viel Verwandtes. Die Schilderung des häuslichen Lebens einer Tischlerfamilie in »Glück und Geld« ist so drollig und wahr, daß mir ein Lächeln über das Gesicht fliegt, so oft sie mir in Erinnerung kommt.« –
Eine zweite im Jahre 1836 erschienene Novelle »Die Ohrfeige« ist wegen ihres merkwürdigen Schicksals einigermaßen interessant. Während sie bei der Kritik starken Beifall fand (vgl. z. B. »Blätter für Literatur und bildende Kunst« [Beilage zur »Abendzeitung«] 1836. Nr. 38; »Literarische und kritische Blätter der Börsenhalle«, 1836, Nr. 1236), wurde von dem Buche kaum ein Exemplar abgesetzt; erst als B. S. Berendsohn das Werk dem »Magazin für Buchhandel« abkaufte und es (gegen Schiffs Willen) unter einem neuen Titel:»Linchen oder Erziehungsresultate« 1841 neuerdings erscheinen ließ, eroberte es sich das Publikum. Dem Verfasser schwebte die Idee vor, die Pädagogik seiner Zeit zu ironisieren. Leider ist dieser zweifellos glückliche Gedanke wenig durchgeführt. Nur ein einleitender Brief, in dem sich Schiff über Erziehungsfragen ernst ausspricht, kann interessieren, die Fabel läßt völlig kalt. Schiff schildert einen jungen Menschen, Heinrich Wolters, der immer gehofmeistert wird, niemals aufhört, ein Kind zu sein und alles über sich ergehen lassen muß. bis ihn endlich die Ohrfeige seines Erziehers zum Manne macht. Dieses Thema hätte eine konsequente ironische Behandlung sehr gut vertragen, wie etwa Kurz-Bernardon und Hensler im »Dreißigjährigen A-B-C-Schützen« mit demselben Sujet verfuhren. Schiff schwankt aber in der Verfolgung seines Zieles beständig hin und her zwischen Ernst und Satire, wodurch sich niemals ein einheitlicher Eindruck ergibt.– –