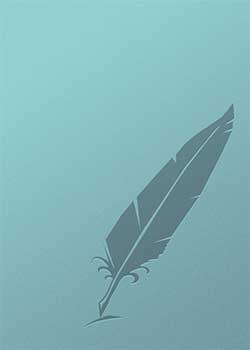Читать книгу Lebensbilder - Оноре де Бальзак - Страница 7
ОглавлениеGleich auf seine erste Novelle »Die Schuhflickerbude auf den Vorsetzen. Erzählung aus dem Anfang dieses Jahrhundertes« (»Freischütz« 1851, Nr. 32–42) treffen all diese Vorzüge zu. Es ist eine stark realistische Erzählung, in der die Liebe eines indischen Nabobs geschildert wird, die durch Intrigen und Betrug von Verwandten stark bedroht wird. Als er nach Indien reist und seine Geliebte in einem kleinen Hamburger Hotel zurückläßt, werden seine Briefe unterschlagen und der geliebten Amanda alle Subsistenzmittel von den Verwandten entzogen, bis sie stirbt. Diese Liebesgeschichte ist unwesentlich. Sehr gut charakterisiert sind ein Schuhflicker Emmerich, der aus den Schuhen, die ihm zur Reparatur übergeben werden, auf menschliche Berufe und Charaktereigenschaften schließen kann (also eine Art Sherlock Holmes ist) und sein Widerspiel, ein in Amerika reichgewordener Gastwirt, der voll Tücke und Neugier ist und für Gleichheit, die amerikanisch sein soll, schwärmt.
Recht unbedeutend ist die Lokalnovelle »Cavalier und Gauner« (1852, Nr. 78 – 85) im »Freischütz«, mit dem übrigens im Jahre 1853 die Beziehungen zu Ende waren, und den Schiff in einem »Silvesterscherz« der »Reform« (1853, Nr. 105) scharf angriff. Dieser gezwungene Scherz heißt »Agathe Frei-Schütz. Eine Grüneberger Lokalnovelle«; die handelnden Personen tragen, um eine Beziehung zu dem Titel der Zeitung »Freischütz« herbeizuführen, die aus der Oper bekannten Namen Max und Agathe.
Sie sind Weinhändler in Grüneberg geworden, konnten jedoch dabei nicht bestehen und gaben später den »Freischütz« heraus, der nur in Grüneberg gelesen wird. All die bekannten Wunderkräfte und Eigenschaften des Grüneberger Weines sind auf diesen übergegangen.
Für die »Reform« schrieb dann Schiff eine größere Anzahl von Novellen. Interessant ist, daß er auch jetzt seine Fähigkeit, sich in dichterische Vorbilder einzuleben, betätigte, wie er es schon zur Zeit der Abfassung der Balzacschen »Lebensbilder« getan hatte. In der »Reform« für 1851 war der Beginn einer Novelle »Die Proletarier« von Berthold Heitmann abgedruckt worden, die nicht weiter erscheinen konnte, da bei einer aus politischen Gründen erfolgten Verhaftung des Verfassers auch sein Manuskript beschlagnahmt wurde. Nun führte Schiff die Geschichte zu Ende.
Es ist ein hübscher Zug des Fortsetzers, daß er »Die Proletarier« mit einem Toast auf B. Heitmann schließen läßt. Man wünscht diesem, daß Not und Mißgeschick, welche manche edle Talente Deutschlands schon zugrunde gerichtet, ihm nichts anhaben mögen, damit er die reiche, ihm verliehene Gabe zu Ehren seiner Vaterstadt und seiner Mitbürger für alle Zukunft geltend mache. Sorgen und Gram mögen ihn nie mehr verbittern wider Welt und Leben, damit er, den Proletariern gleich, deren Interessen er vertrete, mit Ausdauer, Bescheidenheit und Lust seine Aufgabe vollende. –
Die umfangreichste von allen in der »Reform« veröffentlichten Novellen heißt »Luftschlösser«. (Eine Erinnerung an 1848; »Reform« 1851, Nr. 88–103; als Buch bei Hoffmann und Campe 1854.) Unter diesem gemeinsamen Titel vereinigt Schiff drei Novellen »Luftschlösser«, »Noch ein Luftschloß« und »Helden des dreißigjährigen Friedens«, durchaus verworrene, wildphantastische, durch die Sucht des Autors, immer neue grobe Effekte anzubringen, nicht sehr erfreuliche Geschichten, die märchenhafte mit novellistischen Motiven recht äußerlich vereinigen. Jede Einheitlichkeit und Planmäßigkeit, aber auch jeder Darstellungsstil fehlt. Relativ am besten sind noch die »Luftschlösser«, in denen Schiff ein Kontrastbild zwischen üppigem Wohlleben und tiefster Armut entrollt, die endlich zur Selbsthilfe greift und die Sturmtage des Jahres 1848 entfacht. Als echter Demokrat ergreift Schiff für die Armen und Gedrückten Partei. Er billigt die wüsten Ausschreitungen, die sie sich zuschulden kommen lassen. Auffallend ist, wie stark er auch hier noch unter BalzacsEinfluß sieht, in dessen Manier die handelnden Frauen und die prunkvolle Ausstattung eines Bankierhauses geschildert werden. Manche Szene ist direkt aus den »Lebensbildern« übernommen, wie z.B. die, in der sich ein Vater (vgl. »Der Ball im Freien«) vor seiner verwöhnten Tochter fürchtet, und der, ehe er sie empfängt, in seinem Arbeitszimmer peinliche Ordnung macht. – »Die Helden des dreißigjährigen Friedens« behandeln ein durch die Zeitereignisse etwas überholtes Sujet: Die Nichtigkeiten, mit denen man sich von 1815–1848 in Deutschland abgeben mußte, als man sich an Virtuosen, Tierkomödien, Wunderkindern und ähnlichen Abgeschmacktheiten bis zur Siedehitze begeisterte. In seinem »Duett« hatte schon Mundt diese Auswüchse des geistigen Lebens Deutschlands verhöhnt, und Schiffs Satire kam wohl etwas post festum. Wenn er sich über den Enthusiasmus, den Paganinis Auftreten in ganz Europa erregt hatte, in der bittersten Weise lustig macht, so borgt er dabei aus Laubes Parodie »Zaganini«, und nur Vergeßlichkeit mag es verschuldet haben, wenn er es verspottet, daß sogar »Bratschen-Heilande« sich bewundern ließen. Denn er selbst hatte ja versucht, Erlöser der Bratsche auf den Konzertpodien zu werden.
Schiffs novellistische Tätigkeit konnte ihm kaum den nötigsten Unterhalt erwerben. Im Hamburger Staatsarchive findet sich eine Abrechnung des Verlegers Richter über Honorare, die er seinem Mitarbeiter zahlte, aus der die wahrhaft kläglichen Summen bekannt werden, mit denen Schiff abgelohnt wurde. So erhielt er für den Schluß der »Proletarier« 12 Mark Banko, für »Luftschlösser« – 52 Mark. Dagegen mußte er für Kost und Logis monatlich 30 Mark an Richter bezahlen. Solche Honorare hätten einen festeren Charakter, als es Schiff war, moralisch verderben können; denn was er an Geld erhielt, damit würde sich heute kaum der letzte Reporter abfinden lassen. Natürlich mußte er trachten, sich andere Einkünfte zu verschaffen, und so begründete er unter Richters Beistand Mitte September 1851 in Altona ein politisches Volksblatt »Vetter Michel«, für dessen sechswöchige Redaktion er – 45 Mark erhielt. Von dieser Zeitschrift erschienen im ganzen elf Nummern, die zum größten Teil Schiff selbst schrieb. Wichtig sind darin jüdisch-politische Gespräche, wie solche in den Hamburger Zeitungen seit 1848 üblich waren. Die »Reform« brachte gelegentlich (1848 – 1851) Standreden und Briefe eines Isaak Moses Hersch aus Berlin über politische Angelegenheiten (mit stark antiösterreichischer Tendenz).
Schiff hat unter dem Titel »Schabbesschmuh der Familie Absatz« im »Vetter Michel« ständige Unterhaltungen des Kolporteurs Absatz, seiner Tochter Vögelche und Motje Schreiers eingeführt. Anfangs erschienen diese Gespräche unter dem Namen M. Cohen, in Nr. 3 des »Vetter Michel« gab sich aber Schiff als Verfasser zu erkennen. Es sind Klagen des Kolporteurs über die Lesebedürfnisse des Publikums, wobei Schiff diesen Stellung gegen das »junge Deutschland« nehmen läßt, das das Interesse für Romane vernichtet und proklamiert habe, jedes belletristische Werk müsse »Gesinnungen« enthalten. Die Ereignisse des Jahres 1851 werden ziemlich witzig glossiert, gegen Österreich sehr heftig Stellung genommen. Vögelche ist sehr gebildet, kennt Jean Paul und Goethe genau und wundert sich, daß Goethe in einer Zeit, wo alles verboten sei, nicht verboten werde, obwohl er gefährliche, anarchistische Grundsätze predige. Und sie staunt auch darüber, daß man die Schriften kleiner Literaten konfisziere, während die Goethes unbeanstandet bleiben. Sehrsonderbar findet sie es, daß man Kossuth in Österreich einen Galgen und in England eine Ehrenpforte baue, und ihr Vater erwidert: »Gönne Österreich den Galgen und England die Ehrenpforte« [* Dieser »Schabbesschmuh« erschien 1866 in Buchform bei Richter] .
Eines langen Bestandes hatte sich der »Vetter Michel« nicht zu erfreuen. Im Oktober 1851 wurde er behördlich verboten und Schiff verhaftet. In Nr.11 des »Vetter Michel« vom 21. Oktober befand sich nämlich unter der Überschrift »Unerhört, wenns wahr ist« ein Artikel, in dem ein Konflikt zwischen einem preußischen und einem in Rendsburg stationierten österreichischen Offizier erzählt und einzelne Bemerkungen daran geknüpft waren, die keine günstige Meinung von k. k. Offizieren erregen konnten. Infolgedessen wurde Schiff am 26. verhaftet [* Über diese Verhaftung vgl. Varnhagens Tagebücher VIII, 397] und gleichzeitig die fernere Ausgabe des Blattes verboten. Bei der Hausdurchsuchung wurde (nach dem Bericht der »Reform« Nr. 87) nichts gefunden, zumal Schiff damals mit der »romantischen Volksbibliothek« beschäftigt war, deren Herausgabe er für Richter besorgen sollte.
Das Verbot machte (Bericht der »Reform« Nr. 88) großes Aufsehen, und man petitionierte (aber erfolglos) von allen Seiten um Wiedergestattung des Blattes. Als Verfasser des betreffenden Artikels im »Vetter Michel« meldete sich ein Advokat, Dr. H. Evers, in Hamburg (»Reform«, 88). Dennoch wurde Schiff erst am 25. November gegen eine Kaution von 1500 Mark, die Richter erlegte, aus der Haft entlassen, das Blatt aber blieb weiterhin verboten. Auf Schiff war die Hamburger Behörde nun nicht mehr gut zu sprechen, obwohl er nichts weiter getan hatte, als daß er den Aufsatz des Doktors Evers in sein Blatt aufnahm. Dennoch suchte man sich seiner zu entledigen, und am 23. Dezember 1851 wurde er aus Hamburg ausgewiesen. Natürlich war nur seine österreichfeindliche und radikaldemokratische Schriftstellerei Anlaß dieser unberechtigten Maßregel, die jedoch, da man in einer Republik gegen demokratische Anschauungen, die übrigens beinahe von der ganzen Hamburger Bevölkerung geteilt wurden, nicht öffentlich Stellung nehmen wollte, damit motiviert wurde, daß Schiff durch seine – Verheiratung mit einer Ausländerin sein Hamburger Bürgerrecht und damit den Aufenthalt in Hamburg verwirkt habe.
In der an Heine gerichteten Vorrede zu den »Luftschlössern« äußerte sich Schiff in sehr amüsanter Weise über diese Ausweisung. Er spricht darin zunächst Heine seinen Dank für die Anerkennung des »Schief-Levinche« aus und fährt dann fort:
»Ich will dir aufrichtig sagen, wer ich bin. Laut Dekret des Senats vom zwölften Januar achtzehnhunderteinundfünfzig [* Ein Gedächtnisfehler Schiffs] Die Ausweisung war am 23. Dezember 1851 erfolgt] bin ich als geborner Hamburger aus Hamburg ausgewiesen.
Du wirst sagen, Ausweisungen aus Republiken sind klassisch. Themistokles, Miltiades, Cimon, Aristides usw. wurden aus Athen verwiesen, weil sie der Freiheit der Völker gefährlich schienen. Ich kann dir aber wirklich versichern, daß ich mich schämen würde, auf irgendeine Weise der Hamburger Freiheit gefährlich zu sein. Auch hat meine Ausweisung wenig Klassisches. Es wurde mir nicht einmal gestattet, Rekurs zu nehmen. Alle mir zustehenden Rechtsmittel wurden mir abgeschnitten mit dem Befehle: ›sofort Hamburg zu verlassen‹ und der Rekurs, den ich vom Auslande durch einen hiesigen Advokaten einreichen ließ, ward ignoriert.
Es gibt nuch mittelalterliche Ausweisungen, namentlich von Gelehrten, und auch dazu ist die meinige leider nur ein seltsames Widerspiel.
Leibniz zum Beispiel wurde aus Leipzig verwiesen, denn der dortige Magistrat fand, daß er gefährliche Ideen habe.
Leibniz war damals, was man nach unseren heutigen Begriffen nennt, ein der Obrigkeit mißliebiges Subjekt.
Nun kann ich mich allerdings von dem Verdachte nicht reinbrennen, daß ich nicht bisweilen auch Ideen habe. Es sind aber nicht die Ideen der Zeit, diese sind gefährlich. Diese Ideen haben sich am sechsten März achtzehnhundertachtundvierzig bei dem Magistrate sehr mißliebig gemacht. Der Hamburger Senat müßte nach meinem Dafürhalten eher die Zeit mit ihren Ideen vom Hamburger Territorium verweisen als mich mit den meinigen.
Thomasius wurde ebenfalls aus Leipzig verwiesen, denn er schrieb gegen Hexenprozesse. Er eiferte wider das Bestehende.
Thomasius war damals, was man nach unseren heutigen Begriffen nennt, ein Wühler.
Ich aber bemühte mich, dem Bestehenden aus dem Wege zu gehen. Es ist mir zu langweilig, ich befasse mich lieber mit Luftschlössern, und Gedanken sind ja zollfrei. – Auch habe ich ein sehr zartes politisches Gewissen. Es gibt Stunden, wo ich es mir zum Vorwurf mache, in einer Stadt, die eine republikanische Verfassung hat, das erste Tageslicht erblickt zu haben. Mein Trost ist dann nur, daß ich, in einer jüdischen Familie geboren, mithin bescheidentlicherweise ohne Ansprüche auf Staatsämter zur Welt gekommen bin. Als am neunundzwanzigsten September achtzehnhundertneunundzwanzig das dreihundertjährige Jubiläum der Reform unserer republikanischen Verfassung gefeiert wurde, fühlte ich mich bewogen, Hamburg auf vierundzwanzig Stunden zu verlassen, um jeder Freude an republikanischen Formen aus dem Wege zu gehen.
Auch den Philosophen Wolf laß mich erwähnen, der aus Halle verwiesen wurde, weil man dem Könige Friedrich Wilhelm I. vorgestellt hatte, seine Lehren könnten die Potsdamer Grenadiere zur Desertion verleiten.
Wolf war damals in den Augen des Königs in Preußen, was man nach heutigen Begriffen einen Militäraufwiegler nennt.
Aber Novellen sind keine dogmatischen Sätze. Der Dichter schildert, aber lehrt nicht, und sämtliche Militärärzte des zehnten Armeekorps mögen meine Novellen prüfen, ob sie auch nur einen einzigen Hanseaten zum Desertieren verleiten können.
Kurz, meine Ausweisung hat auch nicht einmal etwas Mittelalterliches. Sie ist durchaus spezifisch-hamburgisch und unterscheidet sich von den Ausweisungen früherer Zeiten und fremder Staaten dadurch, daß der aus Hamburg verwiesene Hamburger gezwungen ist, in Hamburg zu bleiben ...
Du wirst aber fragen: ›Woher kann man Hamburg als ausgewiesener Hamburger nicht verlassen?‹
Es hat damit folgende Bewandtnis. Als ich um einen Paß bat, um augenblicklich abzureisen, nicht um einen Kanzleipaß, wie ihn der geborene Hamburger erhält, sondern um einen Polizeipaß, den man jedem Fremden gibt, erhielt ich zur Antwort: »Ausgewiesene erhallen keine Legitimationspapiere.«
Da es mir unmöglich war, meiner Obrigkeit zu gehorchen, mußte ich allerdings bitten, meinen loyalen Gehorsam und guten Willen durch Zwangsmittel zu unterstützen.
Mein nächstes Ausland heißt Altona. Und bis dahin gab man mir einen einzigen Polizeidiener mit, der an der Grenze kehrt machte und wieder nach Hause ging. Als ich aber von der Altonaer Polizei eine Aufenthaltskarte verlangte, weil ich aus Hamburg verwiesen sei, wurde ich ausgelacht und augenblicklich wieder mit der Polizei zurückgeführt. Ich habe noch ein zweites Ausland, welches Harburg heißt, ein drittes Namens Wandsbeck, ein viertes Eimsbüttel und mehr dergleichen Ausländer. Auch nicht verwiesene Hamburger gehen bei schönem Wetter nach allen diesen Ausländern spazieren; mir aber wurde ein für allemal verboten, mich in den Ausländern blicken zu lassen, wenn ich nicht augenblicklich mit der Polizei nach Hamburg zurücktransportiert werden wollte.
Die Zwangsmaßregeln, welche meine Regierung in Anwendung brachte, waren offenbar viel zu schwach. Ein einzelner Polizeidiener, der mich bis an die Grenze bringt, ist zu wenig. Die ganze Bürgergarde, die ganze hanseatische Garnison, die Artillerie vom Dammtorwall und eine gefüllte Kriegskasse, dann könnte ich dem Beschluß meiner Obrigkeit im Auslande Anerkennung verschaffen.
Wie du weißt, lieber Heine, hat jeder Deutsche zweierlei Patriotismus. Einen allgemeinen für das große deutsche Vaterland und einen speziellen und konzentrierten für das engere spezifische, wenn dieses Vaterland auch nur eine Vaterstadt ist.
Nun glaubst du nicht, lieber Heine, was ein aus Hamburg verwiesener Hamburger bei diesem Konflikt des doppelten deutschen Patriotismus zu leiden hat. Ich bin ja nicht bloß der Obrigkeit meines engeren Vaterlandes meinen treuen Untertanengehorsam schuldig, sondern auch allen Obrigkeiten meines größeren, des gesamten deutschen Vaterlandes. Auf Befehl der Obrigkeit meines engeren deutschen Vaterlandes verlasse ich Hamburg mit aller Rührung, allen Dankgefühlen, mit der man aus solch einer von sechsundzwanzig Herren vortrefflich regierten Stadt scheidet. Und mit dem Stolz eines Deutschen, der noch einige dreißig andere Herren hat, betrete ich mein größeres und Gesamtvaterland, Altona. Dort wird mir befohlen, umzukehren und der Obrigkeit meines engeren Vaterlandes ungehorsam zu sein, hier wird mir befohlen, in mein größeres Vaterland zurückzukehren, um irgendeiner meiner vielen Obrigkeiten Gehorsam zu leisten. Kann man das von einem Deutschen verlangen?
Und ach! Hier in diesem Zimmer sitze und schreibe ich, ohne polizeiliche Erlaubnis dazu zu haben. Unter einem unlegitimen Obdach begebe ich mich nachts zu Ruhe, in ein unlegitimes Bette lege ich mich schlafen. Und ach! wie greift es meine Loyalität an, wenn ich Miete zahle. Dieses Sündengeld, womit ich mir Ungehorsam gegen meine Obrigkeiten erlaube! – Richard III. ist ein Knicker. – Ein einziges Königreich für ein Pferd! – Fünfunddreißig Bundesstaaten für eine Quadratelle deutschen Bodens, wo ein gewissenhafter Deutscher sich hinstellen kann, um sich auf dem Boden des Rechtes und Gesetzes zu erhalten.
Schon aus diesen Zeilen kannst du ersehen, welch ein Lokalschriftsteller aus mir geworden ist. Die Luftschlösser sind noch aus der früheren Periode. Bei der jetzigen trübseligen Jahreszeit und dem unwirtbaren geschichtlichen Boden ist fast nichts anderes als Luftschlösser zu haben.
Die sogenannte große deutsche Zeit, was hat sie anderes hervorgebracht als Luftschlösser?
Selbst das unbedeutende Portugal hatte seine große Zeit, die freilich auch nur sehr kurz war und spurlos dahinschwand, wie die große deutsche Zeit. Aber es hatte doch einen Dichter, der die Helden- und Kriegstaten seiner Völker besang.
Ich schildere nur Luftschlösser und Friedenstaten. Ich bin kein Camoens, und das ist ein Glück.
Wenn ich die schleswig-holsteinischen Feldherren, die deutschen Grundrechte, den Gothaer Mittelmäßigkeitsverein, die deutsche Flotte, die Helden des passiven Widerstandes und der friedlichen Demonstrationen besingen sollte, es würde eine schreckliche Lustade werden.«
So heiter wie hier Schiff seine Ausweisung 1854 schilderte, war sie nicht. Da er sich dem Senatsdekrete nicht fügte, wurde er am 12. April 1852 verhaftet, weil er sich unberechtigt in Hamburg aufhielt. In einem Bericht an Sr. Hochweisheit Herrn Senator Meier, Dr. p. t., Patrono der Vorstadt St. Pauli, heißt es, »daß Schiff (51 Jahre alt), der von hier verwiesen ist, in der Gegend des Aktien-Theaters verhaftet wurde. Er wollte seine Wohnung nicht angeben, um die Leute, bei denen er sich heimlich aufhielt, nicht in Verlegenheit zu bringen.« Entscheidung: Verbot an den Arrestaten, sich wieder in Stadt und Geblet betreten zu lassen, welcher versprach, mit I.F. Richter vor dem Altonaer Magistrate zu erscheinen. Daraufhin wurde er mit Richter entlassen. Inzwischen war nämlich ein Brief Richters bei der Hamburger Polizei eingelaufen, worin er schrieb, daß er von Schiffs Verhaftung gehört und für ihn in Altona eine Kaution von 1500 Mark Bco. deponiert habe, welche ihm nicht früher ausbezahlt würde, bevor Schiff nicht in Altona verhört werden könne. Er bat, Schiff, den er seit vier Wochen vergeblich gesucht habe, zur Anhörung eines ihn betreffenden Erkenntnisses an den Magistrat zu Altona auszuliefern. Das geschah: Richter erhielt die deponierte Kaution zurück, und Schiff wurde in Altona entlassen.
Aber die Gefahr der Ausweisung und Verhaftung drohte ihm auch weiterhin, immer unter dem Vorwande, daß er unberechtigt eine Ausländerin geheiratet habe. Auf diese war der Hamburger Senat ebenfalls schlecht zu sprechen, zumal sie einen wenig einwandfreien Lebenswandel führte und ihren außerehelich geborenen Kindern immer wieder die Heimatsberechtigung in Schiffs Vaterstadt sichern wollte. Darüber erhob sich ein langwieriger Aktenwechsel zwischen dem sächsischen Ministerium des Äußeren und dem Hamburger Senat. Er ist ungemein lehrreich, weil er zeigt, mit welchen Nichtigkeiten sich deutsche Behörden monatelang beschäftigten, und wie ungerecht man gegebenenfalls vorging, um sich von einem unbequemen Menschen zu befreien. Schiffs Frau hatte schon 1843 und 1844 vergeblich versucht, für ihren Sohn einen Hamburger Heimatsscheln zu erwerben. 1847 wurde auf ein neuerliches Ansuchen dekretiert, daß das Kind auf einen solchen keinen Anspruch habe, da Schiff als Vater wegen der Heirat sein Heimatsrecht verwirkt habe. 1854 erfloß indes eine günstigere und gerechtere Entscheidung in dieser kleinlichen Angelegenheit. Das königlich sächsische Ministerium des Äußeren schrieb damals an den Hamburger Senat:
»Luise Amalia Auguste geborene Leuthold hält sich gegenwärtig (11. November 1853) in Leipzig auf, und erscheint auch ihr Aufenthalt unbedenklich, so ist es doch nur unter der gewissen Voraussetzung der Fall, daß über die Staatsangehörigkeit derselben kein Zweifel obwalte, vielmehr solche gehörig festgestellt sei.
Da der Ehemann dieser Frau geborener Hamburger und sie von demselben nicht getrennt ist, so würde jene Staatsangehörigkeit sich hiernach einfach regeln, wäre nicht erinnerlich, daß, als im Jahre 1847 unter dem 29. Juli das unterzeichnete Ministerium in dem Fallewar, den hochverehrlichen Senat der ... Stadt Hamburg zu benachrichtigen, daß die hiesige königliche Regierung genötigt war, nächst anderen sogenannten Literaten auch den Doktor Schiff von Leipzig auszuweisen. Dagegen äußerte sich Hamburg am 20. Dezember desselben Jahres, weil sich Schiff 1841 zu Schkeuditz verheiratet habe, er dadurch sein Hamburgisches Heimatsrecht gesetzlich verloren und gehöre dem Hamburgischen Staatsverbande nicht mehr an. Die hiesige Regierung hatte an diesem Umstande damals kein Interesse. Jetzt aber wird es erforderlich, darüber Gewißheit zu erlangen.
Das unterzeichnete Ministerium vermag den Grund nicht einzusehen, weshalb Doktor Schiff lediglich wegen seiner Verheiratung mit einer Ausländerin seiner angeborenen Heimatsrechte verlustig gegangen sei. Wenn aber Schiff am 2. Mai 1848 (also lange nach seiner Verheiratung) ein Paß als Hamburger ohne allen Vorbehalt ausgestellt wurde, gleiches auch seiner Ehefrau gewährt wurde, so wäre zu schließen, daß die Wiedereinsetzung in seine früheren Rechte stattgefunden habe. Wäre dies der Fall, so gehört die Frau zum Manne und ist also auch Hamburgerin.