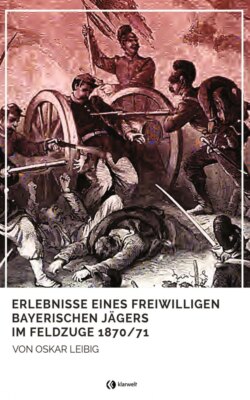Читать книгу Erlebnisse eines freiwilligen bayerischen Jägers im Feldzuge 1870/71 - Oskar Leibig - Страница 7
III. Auf dem Marsch und im Quartier.
ОглавлениеUnter fröhlichem Gesang marschierten wir auf herrlicher Straße dahin, bis in den Weg sich legende Höhenzüge, Ausläufer der Vogesen, es ratsam machten, mit der Lunge haushälterischer umzugehen. Wir kamen allmählich in den Wald, aber in diesem herrschte eine glühende Augustschwüle, so dass wir bald von Schweiß troffen. Dazu kam, dass im lebhaften Tempo marschiert wurde und dass die Straße fast ununterbrochen stieg. Nach jeder erstiegenen Anhöhe tat sich nach kurzer Talsohle eine höhere vor uns auf. Wer in Lembach — das hatten wir heute noch zu erreichen — gewesen ist, wird sich des Ortes als eines sehr hoch gelegenen erinnern. Der Marsch ward uns sauer: die Brust hatte schwer zu arbeiten unter der Last des Gepäcks, die Fußsohlen fingen an zu brennen. Der Weg war wie ausgestorben, ich könnte mich nicht erinnern, dass uns eine Seele begegnet wäre: ein einziges Mal passierten wir eine Ortschaft, wahrscheinlich Klimbach. Manchmal wurde noch ein Lied gesungen aber es wollte nicht mehr recht heraus, nicht zum wenigsten wegen des brennenden
Durstes, an dem die Mehrzahl der Truppe litt; man war anfangs nicht recht sparsam mit der Feldflasche umgegangen, weil man sich einer solchen Leistung für heute nicht mehr versehen hatte. Mancher Seufzer rang sich los, die halblaute Frage: ist’s denn noch nicht bald aus? ward gar manchmal getan. Aber unverdrossen schritt unser Führer voraus, mit einem Schritt zwei der meinigen zurücklegend. Mir speziell ist es auf diesem ersten Marsche nicht schlechter ergangen als meinen Kameraden auch; auch die besten Marschierer — und wir hatten treffliche unter uns — hatten an diesem Tage genug. Die Abenddämmerung war stark hereingebrochen, als wir endlich das heiß ersehnte Marschziel ganz nahe vor uns auftauchen sahen. In der Mitte des Dorfes angekommen, wurde die Wachmannschaft bestimmt, wir andern erhielten den Befehl, uns truppweise ohne weiteres in die umliegenden Häuser zu begeben, hierhin 10, dorthin 5, 8, 4, 2 Mann, je nach der Größe und Ansehnlichkeit des Hauses. Nach der Erklärung, dass morgen um ½ 6 Uhr das erste und in viertelstündigen Pausen das zweite und dritte Signal gegeben und dann abmarschiert werde, verteilten wir uns in die Quartiere. Ich kam mit sieben Mann in ein stattliches Anwesen, dessen Bewohner sehr unangenehm berührt bald am Fenster erschienen. Bevor noch das Haus geöffnet wurde, erbaten wir uns einen Krug Wasser, um unseren brennenden Durst zu löschen. Nachdem wir eingetreten, erklärten sich die Leute bereit, uns noch Kaffee kochen zu wollen, was wir sehr gerne annahmen. Nach aufgehobenem Kaffee ging in der Scheuer, welche gut mit Stroh belegt war, unter Laternenlicht die Pflege der Füße an; ach sie brannten mir wie helles Feuer, ohne dass ich Blasen gehabt hätte. Hirschtalg brachte große Linderung, aber mich beschlich die Sorge, wenn das so 14 Tage fortgeht, wirst du’s, werden es deine Fußsohlen leisten können? Um Körper und Brust brauchte es mir nicht bange zu sein, aber in den Füßen saß der Schaden. Nach ganz kurzer Unterhaltung schliefen alle den Schlaf des Gerechten auf dem harten Pfühl des Tornisters, bis die Morgenreveille uns schnell und flink vom Lager aufstehen hieß.
Ich könnte nicht sagen, dass ich recht gestärkt und erfrischt dem Rufe des Hornes gefolgt bin: die Glieder taten weh von dem harten Lager und kaum stand ich auf den Füßen, als ich sie schon recht deutlich „spürte“. Nach einer ganz oberflächlichen Waschung im Hofe wurde eiligst zusammengerafft, was man abgelegt oder etwa ausgepackt hatte, Schuhe und Lederzeug mit der Bürste, das Gewehr mit einem Lappen überfahren; unter gegenseitigem Beistand wurden die Mäntel, in die man sich zum Schlafen eingewickelt hatte, gerollt und alles parat gestellt, um auf das dritte Zeichen nur noch umhängen und auf den Alarmplatz eilen zu können. Ja, es hieß sich alle Morgen tüchtig tummeln, denn die Pausen zwischen den Signalen waren oft verwegen kurz, so dass der von den Quartiergebern oder von einem Kameraden bereitete Kaffee manchmal siedend heiß hineingeschüttet werden musste. Manchmal brachte man es auch gar nicht zu einem solchen, denn mit dem Fassen stand es sehr schlecht, und lange nicht alle Quartiergeber waren freundlich genug, uns morgens Kaffee zu bieten. So marschierte man oft ab mit einem Trunk Wassers in der Feldflasche und einigen Bissen trockenen Brotes. Sich mit letzterem zu versehen, auch Wein und Cognac zu kaufen, dazu bot sich beim Durchmarsch durch die Städte und Städtchen, in deren Nähe häufig die Rast verlegt wurde, leicht Gelegenheit. So es möglich war — es war freilich nicht oft der Fall — wurde uns von deutschen Verpflegsstationen und Etappenkommandos, wo oft hübsche Vorräte lagen, Brot und Fleisch verabfolgt. Zudem ging das Obst der Reife entgegen .und musste auch manchmal gegen den Hunger helfen. Einmal des Tags bekamen wir doch stets warm zu essen; in der Regel bestand die Mahlzeit aus geräuchertem Schweinefleisch, von dessen Brühe dann eine Suppe angerichtet wurde, welche an Dünnheit nichts zu wünschen übrig ließ; selten war ein Gläschen Wein dabei. — Nimmt man hinzu, dass wir privatim auch ganz gelinde requirierten, einen uns in die Hände gefallenen Brotlaib tüchtig zusammensäbelten, ein Hühnchen oder auch Eier, Kaffee, Zucker mitgehen ließen, wo und wie sich gerade Gelegenheit bot, so wird man einsehen, dass sich die Ernährungsfrage .leicht und glücklich löste. So war es wenigstens bis Bar le Duc, auch noch bis Clermont; von da an aber wurde die Sache oft kritisch: Verpflegsstationen waren noch nicht errichtet und die Gegend war von den Tausenden von Deutschen und Franzosen, welche vor uns durchmarschiert waren, wie ausgefressen, was sich je näher auf Sedan zu, desto mehr steigerte. Eine glänzende Ausnahme brachte Varennes, wie ich berichten werde. Die meiste Zeit über waren wir hungrig, wenn wir auch so viel erlangten, als wir bedurften, um bestehen zu können. —
Unsere Lembacher Franzosen, welche deutsch sprachen und uns von vielen tausend Bayern erzählten, die vor der Wörther Schlacht ihren Ort passiert hatten, waren so freundlich gewesen, uns wieder Koffer zu machen. Kaum waren wir damit fertig, als der Generalmarsch uns auf den Sammelplatz zusammenrief. Der Marsch begann und führte bald in ein ziemlich enges Tal herab, welches ein Bach, wohl der Sulzbach, durchfloss; die bald sehr kräftig scheinende Sonne setzte uns hart zu. Aus einem Seitental heraus waren die mit uns gekommenen Abteilungen des 5. und 14. Regiments getreten und wir marschierten nun zusammen, die Jäger an der Spitze. Aber dies geschah unsrerseits in so raschem Tempo, dass von Regimentswegen bald erklärt wurde: Wenn die Jäger so schnell marschieren, ist kein Zusammengehen mit ihnen möglich. Der Verband löste sich denn auch, wir gingen unsere Wege und bis wir auf dem Wörther Schlachtfeld ankamen und nach halbstündiger Rast die Fröschweiler Höhe hinanstiegen, sahen wir von den roten Krügen und Aufschlägen keine Spur mehr.
Die Gegend, je näher auf Wörth zu zeigte immer mehr den Charakter der großen Katastrophe, die kurz vorher da stattgefunden hatte. Kein Mensch war weit und breit zu sehen, die Felder, soweit sie in ihrer Zerstampftheit noch den Namen verdienten, lagen verlassen, die anliegenden Wälder schienen ohne Leben, kein Vogel rührte sich. Es ging wohl allen meinen Kameraden wie mir, denn im Zuge ward es immer stiller. Es legt sich einem aufs Gemüt, über ein Schlachtfeld zu marschieren; eigentümliche Gedanken und Gefühle durchrieseln wie Geisterschauer den Betrachtenden. Nicht dass noch Tote oder Verwundete dagelegen wären, oder die ganze Fülle der abgelegten und erbeuteten Waffen. Das alles war geborgen und an seinem Ort. Aber was zu sehen war, war gerade noch genug, um die ganze Schrecklichkeit eines solchen Ringens erkennen zu lassen. Offenbar war von Waffen nur das noch taugliche aufgelesen; denn zerbrochene und verbogene Gewehre und Pistolen, Säbelscheiden und Klingen lagen zahlreich umher; dazwischen hinein zerstreut Uniformteile, Helme, Mützen, Patrontaschen, Tornister, halbe Trommeln, Papierfetzen in Fülle. Da und dort eine zerstückte Lafette, Geschützrohre, Räder und die verschiedensten Trümmer der verschiedensten Wagen. Hier gähnte ein von Granaten gerissenes Loch; dort fristete ein zerschmetterter Baum sein kümmerlich Leben. Hecken und Verhaue waren bis zur Unkenntlichkeit zusammengestampft und -gefahren. Einzelgräber und die schwarzen Hügel von zahlreichen Massengräbern erinnerten an die überreiche Ernte, die der Tod da jüngst gehalten. Ein preußischer Stabsoffizier, welcher mit einer Dame am Arme uns hier begegnete, sprach uns an: Da haben eure bayerischen Brüder mit großer Tapferkeit gekämpft! Wir werden das auch tun, kommt‘s an uns, tönte es ihm aus unseren Reihen entgegen.
Mitten auf dem Schlachtfeld ließen wir uns nieder zur Rast. Noch sehe ich Wörth mit seinem Kirchturm und wenigen Häusern umher, etwa 10 Minuten von uns entfernt, zu Füßen einer bedeutenden Höhe, welche die Deutschen zur Schlacht herabsteigen mussten, um im heißen Kampfe die noch bedeutendere zu gewinnen, auf welcher Fröschweiler liegt. Es war heute der 19. August, noch nicht zwei Wochen also waren verstrichen seit der furchtbaren Niederlage der Franzosen. Welch staunenswerter Mut gehörte dazu, diese Höhen zu nehmen, in welchen sich die Franzosen seit dem 22. Juli eingenistet und auf alle Weise befestigt hatten wie Kleins „Fröschweiler Chronik“ erzählt. Auf dem Boden liegend und eine Zigarre rauchend übersah ich die ganze Gegend und suchte sie meinem Gedächtnis einzuprägen. In Wörth war inzwischen unser Eintreffen bekannt geworden und mehrere dort in Tätigkeit stehende Diakonen, Erlanger Studierende, waren herausgekommen, um etwaige Freunde und Bekannte zu grüßen, unter ihnen ein lieber Studiengenosse, der mir in Erinnerung an eine kleine Gymnasialuntugend auf diesem welthistorischen Platze feierlich eine Schnupftabaksdose übergab. Ich trug sie in alter Liebe in der Rocktasche leer bis nach Paris; dort habe ich sie auf seine vielfachen Bitten einem unserer Unteroffiziere geschenkt.
Die Rast war zu Ende: unter peinlichen Schmerzen, wie wenn lauter Nadeln in den Fußsohlen säßen, wurden die ersten fünfzig Schritte gemacht, dann ging’s immer gut. Wir stiegen die Straße nach Fröschweiler hinan. Bei jedem Blick rechts oder links gewahrte man deutlich die ungemeine Stärke der von den Franzosen innegehabten Stellung; nicht nur bot die Natur hier alle zu einer ausgiebigen Verteidigung günstigen Mittel, als Bergvorsprünge, Taleinschnitte, Rebengelände, sondern auch die in diesem Fach anerkannt große Kunst der Franzosen hatte die Festigkeit der Stellung noch bedeutend erhöht durch Schützengrüben, Verhaue, Erdaufwürfe, Abgrabungen usw., deren Überreste noch deutlich zu erkennen waren.
Bald war das auf der Hochebene liegende Dorf Frösch•weiler erreicht und ohne Stillstehen passiert. Es bot noch ganz den Anblick eines in der direkten Feuerlinie gelegenen Fleckens: niedergebrannte Häuser, klaffende Wände, zerschlissene Dächer auf allen Seiten. Die in Trümmern liegende Kirche und ein rechts am Eingang des Dorfes liegender überdeckter Brunnen sind mir lebhaft im Gedächtnis geblieben. Kein Ziegel des Dächleins war mehr ganz, das Balkenwerk von unzähligen Gewehrkugeln .zersplittert. Gewiss war dieser Brunnen von den von Durst und Anstrengung ermatteten Franzosen viel umlagert und mancher hat sich statt Erquickung dort Wunden und Tod geholt. Es war ein trübes Bild, dieses zerstörte Dorf, und trübe und finster schauten auch die wenigen Einwohner drein, welche sich blicken ließen. Aus einer Seitengasse heraus betrachtete uns ein Mann, welcher in Gewand und Haltung an einen Geistlichen erinnerte; es wird wohl der unermüdlich treue Ortspfarrer gewesen sein. —
Sobald wir den Ort passiert hatten, gewahrten wir rechts und links an den Straßengräben und in den Feldern noch viel zahlreichere Überbleibsel der stattgefundenen Schlacht; aber während es unten im Grund und die halbe Straße herauf meist Armaturstücke der deutschen Armee gewesen waren, die wir sahen, waren es hier durchaus einstige Besitzgegenstände der geklopften Rheinarmee; und wie sie immer dichter, immer mannichfaltiger wurden, erwiesen sie sichtlich, wie der Rückzug dieser Armee mehr und mehr in die schleunigste Flucht übergegangen war. Da fehlte vom größten bis zum kleinsten Gegenstande, welcher zur Ausrüstung einer Armee gehört, auch gar nichts, jeder war in zahlreichen und mehr als zahlreichen Exemplaren vertreten. Käppis, Tschakos, Helme, kurz die Kopfbedeckungen aller Waffengattungen verliehen dem Boden stellenweise eine förmliche Buntheit; neben glänzenden Blechinstrumenten lagen die dunkelbraunen, länglich viereckigen Kästchen, aus welchen noch die Mitrailleusenpatronen ihre Zähne wiesen; ein zerbrochener Munitionskarren hatte sie im Umfallen zur Erde gebettet oder auch zerstreut. Weggeworfene Tornister in Massen, ihr Inhalt lag zerstreut umher, darunter vielfach Briefe, Gebetbücher, Fotografien. Einer scheint einem Listenführer oder Feldwebel gehört zu haben, ein ganzer Papierladen umgab ihn, und als mein Rottengenosse einen Griff darnach tat, hatte er die Hand voll Befehle, Kompagnielisten und verschiedener Formulare. Und dies ging so fort bis nahehin an Niederbronn, alle Augenblicke Neues aufweisend. Unser alter Hornist, der sich einer ziemlichen Freiheit der Bewegung erfreute, hatte sein besonderes Gaudium an einer blinkenden Posaune: er las sie auf, probierte sie öfters und trug sie bis aus dem Wald heraus ein gut Stück noch auf der breiten Straße nach Niederbronn. Und als wieder einmal eine Lafette am Wege stand, kletterte er hinauf, blies mit der ganzen Kraft seiner Lungen in die Welt hinaus und schmetterte dann mit einem Kraftwort zu unserer allgemeinen Belustigung das schöne Instrument unter ihre Räder.
Bald nach Fröschweiler waren wir in einen Wald eingetreten. Da war es nun hochinteressant, die Versuche zu sehen, welche von den Franzosen gemacht worden waren, sich nochmals zu stellen oder wenigstens die Verfolgung zu erschweren und aufzuhalten. Denn öfters war plötzlich die Straße mehrere Fuß tief und breit abgegraben, so dass alles Passieren für Fußgänger, Reiter und Wagen völlig unmöglich war; jenseits der Abgrabung erhoben sich ein niederer Wall, und rechts und links der Straße Verhaue. Vergeblich! Denn ebenso deutlich war zu erkennen, wie der breite Strom der Fliehenden und Verfolgenden rechts und links des Hindernisses durchgebrochen war, unaufhaltsam alles vor sich niederwerfend.
Es, wird etwa mittags 1 Uhr gewesen sein, als wir schweißtriefend und staubbedeckt in Niederbronn einmarschierten und vor der Mairie, in deren unterstem hallenmäßigem Stockwerk das Etappenkommando sich niedergelassen hatte, die Gewehre in Pyramide setzten. Der Kommandeur desselben war ein bayerischer Artilleriehauptmann, ein energischer Mann, der die Franzosen den Sieger fühlen ließ; wie er so würdevoll dasaß vor seinem Amtstisch, musste er jedem, der mit ihm zu tun hatte, eine kleine Besorgnis einflößen, ob‘s wohl gut ablaufen würde. Dennoch wagte es ein Niederbronner in blauer Bluse, ihm sein Anliegen in französischer Sprache vorzubringen; wie freute mich’s, als ihm der Mann sofort dazwischenfuhr mit einem: „Donnerwetter, reden Sie Deutsch; Sie können deutsch!“ was sich auch sofort ergab. Item, sie waren schon recht, diese Männer. Klein kann in seiner “Fröschweiler Chronik“ keinen andern Mann gemeint haben als diesen, wenn er von dem gravitätischen Etappenkommandanten von Niederbronn spricht, bei dem er um ein Pferd gebettelt habe. Auch in einem Jahrgang des „Daheim“ habe ich ihn unter einer hübschen Episode betitelt: „Ein Besuch beim Etappenkommandanten von Niederbronn“ wieder erkannt. Merkwürdig war die Umgebung, in welcher dieser Mann amtierte. Denn die Halle war in ein Magazin umgewandelt. Da standen herum: Habersäcke, Fässer mit Brot und Zwieback, Strohbündel usw.; in einer Ecke die Gewehre seiner Wachmannschaft, von welcher etliche Leute auf den Habersäcken fest schliefen. Ich setzte mich auch hinein, um zu ruhen; schlafen mochte ich nicht, was ich sah, war mir zu interessant. Im Städtchen selbst habe ich mich nur ganz wenig umgesehen. Es stand lange an, bis wir endlich menagieren konnten, aber das war gut; denn bei früherem Ausbruch hätte uns ein starkes Gewitter ohne Frage bis auf die Haut durchnässt. Beim Aufbruch nahm• uns unser Führer, wie Er das gerne tat, beim Ambitionszipfel und forderte uns halblaut auf, recht stramm aus dem Städtchen hinauszumarschieren; seinem Wunsche wurde prompt willfahrt: aufs exakteste wurden die wenigen Bewegungen ausgeführt und unter dem Klang unserer zwei Trompeten, die bald von kräftigem Gesang abgelöst wurden, so fest und sicher aufgetreten, als marschierten wir auf dem Exerzierplatz und täte keinem ein Bein weh. — Schmunzelnd sah uns der gravitätische Etappenkommandant nach, bis wir um eine Ecke verschwunden waren. Aber die Füße — noch fühl ich‘s! Es wäre ein wahrer Genuss gewesen, in der köstlich erfrischten schönen Gegend noch die 7—8 Kilometer bis nach Zinsweiler zurückzulegen, wenn nicht die Füße bei jedem unguten Tritt, bei jeder Berührung mit einem Stein lauten Protest gegen alles Marschieren erhoben hätten. Zinsweiler also war das heutige Quartier, ein Dorf, in dessen Mitte eine große Fabrik steht. Ich wurde mit einem Kameraden bei einer Witwe einquartiert, die uns klagte, dass die Preußen ihr zwei Ochsen weggeführt, den einen davon aber gleich bei dem Dorfe in den Weiher geworfen hätten. Unser Nachtquartier war auch diesmal in der Scheuer, wohin wir natürlich unsere ganze Armatur mitnahmen. Während der Nacht stand der erste Halbzug auf Vorposten, weil unserem Kommandeur Vorsicht anempfohlen war, indem die Gegend noch zahlreiche versprengte Franzosen berge. Morgens verspäteten wir uns über dem Gewehrputzen und wurden zu einer Strafwache aufnotiert; wir hatten den Befehl zu wörtlich genommen und das zerlegte Gewehr noch nicht recht beisammen, als uns der Generalmarsch überraschte.
Die furchtbar schwüle Temperatur, die Samstag den 20. August herrschte, ließ schon früh ahnen, dass der Tag sehr anstrengend werden würde. Und es kam auch so; ich glaube, dass dieser Samstag allen meinen Kameraden unauslöschlich im Gedächtnis sitzt als einer der schwersten Marschtage, die speziell wir im ganzen Feldzuge zu leisten hatten. Unter schrecklicher Schwüle marschierten wir den vormittags hindurch; es wird Weinburg gewesen sein, in dessen Nähe wir in einem Wäldchen Mittagsrast hielten; wir fassten hier Wein, welchen wir selbst mitgebracht hatten; außerdem veranlasste unser Führer einen vorüberfahrenden Marketender aus der Pfalz, uns Wein zu verkaufen, was denn auch fast von allen benützt wurde, so dass, wie unser Führer nachdrücklich hervorhob, alle den bevorstehenden Marschschwierigkeiten gewachsen sein sollten. Kaum hatten wir einige hundert Schritte zurückgelegt, als die Straße, eine schöne, echte Militärstraße, in regelrechten Wald einbog und zugleich merklich zu steigen begann. Man nahm‘s mit Humor hin, als einige Male um die Ecke herum dasselbe Gemälde erschien: Wald und ansteigende Chaussee; aber als die Geschichte stundenlang so fortging, da meinte man doch aus der Haut fahren zu müssen. Jede Ecke das alte Bild. Kein Dorf, kein Haus, keine Seele; nur hin und wieder am Straßengraben der unschöne Anblick eines gefallenen Pferdes. Und dies alles unter Regen, der anfangs so ausgiebig fiel, dass die Mäntel angezogen wurden; man glaubte unter ihrer Last vergehen zu müssen und nicht mehr genug Atem herbringen zu können. Dies erzeugte im Verein mit dem genossenen Wein einen quälenden Durst, welcher bald jeden Versuch, durch einen Kantus uns zu ermuntern, oder uns zu unterhalten, lahm legte. Aufs äußerste erschöpft zogen wir dahin; auch die kräftigsten und tüchtigsten Marschierer schauten sehnsüchtig aus nach dem Ende. Und was erst ich ausgestanden habe, mit meinen wunden, halb offenen Füßen, das kann ich nicht sagen. Es bedurfte meiner ganzen moralischen Kraft, meiner ganzen glühenden Vaterlandsliebe, um nicht zusammengebrochen am Wege liegen zu bleiben. Aber dass ich einmal gedacht hätte: wärst du zu Hause geblieben! niemals, heute so wenig wie bei den größten Strapazen und den Gefahren des aufreibenden Vorpostendienstes ist mir dieser Gedanke gekommen; ich kannte ihn als einen unehrenhaften nicht. Ich muss den Eindruck furchtbarer Leiden gemacht haben, denn unser Führer kam öfters zu mir, mich ermunternd und auf das baldige Ende des Marsches vertröstend; und unser junger Hornist erbot sich, mir das Gewehr zu tragen; ich gab‘s nicht her. Mein alter Grundsatz: was andere können, kannst du auch, litt es nicht, ich musste es aushalten und ich hielt es aus, ohne aus dem Glied zu treten oder auch nur einen Schritt zurückzubleiben. Endlich, endlich war auch die letzte Ecke passiert und vor uns lag schön und niedlich, ihre roten Bastionen auf abschüssigen Hügeln weit vorschiebend, die Bergfestung Lützelstein, la petite Pierre.
Der Anblick versöhnte ein wenig mit den gehabten Strapazen, man versprach sich, ich weiß nicht warum, angenehme Quartiere. Am Brückenkopf wurde Halt gemacht, während der Lieutenant Stadt und Festung betrat, um Quartier zu machen. Wir hatten uns sofort nach dem Halt nicht nur niedergesetzt, sondern, wo es auch immer war, niedergelegt, den Tornister unter den Kopf schiebend. War das ein Genuss ohne gleichen! War‘s einem auch bang vordem Aufstehn, in ganz kurzer Zeit hoffte man ja doch definitiv ruhen zu dürfen. Der Lieutenant blieb ziemlich lange aus, wohl weil er sich tüchtig für uns verwandte; aber umsonst, wir sollten heute noch nicht ruhen dürfen. Noch liegend hörten wir den Bericht, dass man uns nicht aufnehmen könne wegen Mangels an Platz, dagegen uns vorschlage noch bis Petersbach, 4 Kilometer, zu marschieren. Was half alles Schimpfen, Fluchen und Raisonnieren. — Unser Führer ließ uns noch eine Weile liegen und zu der neuen Anstrengung uns erholen. Endlich nahmen wir die letzte Strecke unter die Füße. War das eine Qual, bis alles wieder im Gang war und alle Gelenke wieder funktionierten! Es machte sich besser als man gefürchtet hatte, denn der Weg war eben. In einer Stunde hatten wir Petersbach, ein weit auseinanderliegendes Dorf, erreicht und ich hatte noch das Spezialvergnügen, recht weit draußen einquartiert zu werden. Es war ein Bauernhaus, dessen Bewohner, bis auf die verwitwete Eigentümerin lauter junge Leute, uns bange machen wollten mit dem nahen Pfalzburg, was aber durchaus nicht verfing. In der Wohnstube wurde uns das Lager zurechtgemacht, welches wir bald genug aufsuchten.
Ja das Marschieren! Es ist das schwerste, was der Soldat zu leisten hat, und nichts nimmt so alle Kraft in Anspruch als das Marschieren. Mein Gott, wir haben als Studenten auch hübsche Touren gemacht nach Pommersfelden, nach Bamberg, in die fränkische Schweiz; aber man gönnt sich dabei ja jede mögliche Erleichterung und Bequemlichkeit: wenn man hungrig und durstig ist, kehrt man ein, ist man müde, bleibt man sitzen oder fährt vollends heim. Aber hier gilt es ununterbrochen ein Gewicht von 40 Pfund tragen, dazu das 8 Pfund schwere Gewehr, den Hals in enger Krawatte, den starken Rock stets zugeknöpft, auf dem Kopfe den Helm, in dem sich trotz seines Luftlöchleins bald der Schweiß als weißlicher Schimmel ansetzte. Und wer noch dazu weiche Füße hat, der empfindet doppelte Qual; aber ich kann ihm zum Trost aus eigenster Erfahrung versichern: auch die weichsten Füße werden allmählich hart und zu den schwersten Leistungen fähig. Die meinigen überzogen sich bald mit einer lederartigen Haut, so dass ich die gewaltigsten Märsche mitmachen konnte, ohne dass mir im geringsten etwas wehe getan hätte; und ich bin überzeugt: hätte unser Führer nicht so sehr gestrebt, unser Bataillon zu erreichen, uns also nicht so furchtbar angestrengt, so hätte ich nicht so schweres ausstehen müssen. Er hat es mir später in Erlangen einmal selbst gesagt, dass er uns zu viel zugemutet; aber er dachte eben von so vielen jungen begeisterten Männern auch etwas fordern zu können, und es ging ja auch im ganzen; und nicht um viel würde ich den Anblick der Stätte hingeben, auf welcher Napoleons Kaiserthron in Scherben geschlagen wurde; er wäre uns ohne diese Eilfertigkeit nicht geworden.
Dieselbe Erfahrung durfte ich auch noch in anderer Hinsicht machen: der Durst nämlich, von dem wir anfangs fast verzehrt wurden, verschwand allmählich und machte sich gar nicht mehr geltend; ja ich bin zwischen Sedan und Paris morgens öfter als einmal abmarschiert, ohne auch nur einen Tropfen in der Feldflasche zu haben. Nur ein einziges Mal, bald nach Sedan, habe ich starken Durst gelitten und musste meinen privaten eisernen Bestand, ein ganz kleines Gläschen voll Kognak, angreifen. So lernt sich alles.
Und noch eins: man glaubt nicht, wie sauer es einem anfangs wird, tagelang das schwere Gewehr zu tragen. Jeder glaubte, die beste Art des Tragens zu haben und pries sie an, aber sein häufiges Wechseln ließ ihn nicht immer Glauben finden; Alle Arten wurden durchprobiert, bis immer wieder der betreffende Arm und die Schulter ermattet waren. Bald hatte man Hochgewehr auf der linken, bald auf der rechten Schulter, bald hing es an einer Schulter, bald um den Hals, bald mit dem Riemen noch um den Tornister; kurz jede nur mögliche Art wurde durchprobiert. Nun auch das lernt sich und später trug ich es stundenlang an der rechten Schulter hängend. Item, die ersten acht bis zehn Tage bezahlte ich ein schmerzhaftes Lehrgeld, dann aber war ich fest und es wäre mir eins gewesen, auch noch bis an das Meer zu marschieren.
Freilich, wenn man die flotten Reiter sah, überkam einen so etwas wie Neid, dass diese ohne sonderliche Anstrengung die Märsche zurücklegen konnten; aber wenn wir sie dann sahen mit den Pferden nach Ställen suchend oder nach Rationen laufend, während wir schon lange der Ruhe pflegten, oder wenn sie zum Füttern heraustrompetet wurden, während wir uns nochmal ganz gemächlich umdrehten, da wurden wir mit unserem Los doch immer recht zufrieden; oder wenn gar auf Rasttagen Propretätsparade gehalten wurde, da waren wir mit dem Putzen und Reinigen im dritten Teil der Zeit fertig als wie Kavallerie und Artillerie.
Doch ich will nicht vorgreifen, und nur noch berichten, wie wir, so lange wir allein waren, Abwechslung in das Marschieren zu bringen suchten. Gesungen wurde natürlich viel, Vaterlands- und Soldatenlieder, die wir schon ehedem kannten; wir Studenten und Studierten waren die Mehrzahl und manches Lied haben unsere anderen Kameraden, die wir sehr liebenswürdig behandelten, nur dass wir sie nicht duzten, wie auch sie alle uns sehr zugetan waren, von uns gelernt und gerne mitgesungen, so das prächtige Landesknechtslied: „Trink, Kamerad“, dessen letzter Vers: „Guckt der Tod uns in das Glas — ist die Neige noch nicht aus — schlagen wir ihn auf die Nas — und marschier’n zum Tor hinaus“ immer mit erhebender Kraft erschallte. Vor allem aber bildete die „Wacht am Rhein“ immer wieder gemeinsamen Boden. An den Gesang schloss sich häufig eine erheiternde improvisierte Musik an, die sich gar sonderbar zusammensetzte: eine Mundharmonika übernahm die Leitung, um sie her gruppierten sich eine Maultrommel, ein Triangel, hervorgebracht durch Anschlagen an den freigehaltenen Entladestock, ein Brummbass, durch Blasen in die leere Feldflasche erzeugt, endlich ein Blasinstrument, bestehend aus einem mit Papier überdeckten Kamm. Und es ist wahr, unsere Offiziere hatten Recht, wenn sie uns fleißig aufforderten zu singen: es belebte und erhielt frisch, unwillkürlich richtete man sich auf und verfiel in Taktschritt und marschierte, Schmerz und Müdigkeit vergessend, kräftig vorwärts. Oder aber man musste herzlich lachen über die schlechten Witze und die tollen Einfälle des Humors, der unter so vielen jungen Männern niemals ausstirbt, auch nicht in den schwersten Lagen und unter dem aufreibendsten Dienste. Das alles war natürlich im verstärkten Maße der Fall, als wir im Bataillon aufgegangen waren, und verdankt mein Liederschatz dieser Zeit manche Bereicherung; ist sie auch nicht alle Zeit veredelnd gewesen, so denke ich doch noch manchmal mit Vergnügen dieser kraftvollen derben Lieder.
Am andern Morgen, dem ersten Sonntag in Feindesland, wurde uns länger Ruhe gegönnt und erst um 8 Uhr aufgebrochen. In Petersbach muss eine Etappe oder wenigstens ein Magazin gewesen sein; denn bevor wir abmarschierten, wurde ein requiriertes Wägelein mit kleinen Brotlaiben beladen und einige Zeit uns nachgefahren, auch dazu benützt, die Marschkranken aufzunehmen. Wo das Brot schließlich hingekommen, oder stehen geblieben ist, kann ich mich nicht erinnern. Gegessen haben wir’s nicht, ich wüsste es, denn ich verließ die Truppe keinen Augenblick. Unter Regenwetter marschierten wir ab, aber bald war es wieder schön, ohne schwül zu sein. In der Nähe des Ortes Trulingen machten wir kurze Rast und die Leute kamen eben aus der Nachmittagskirche, als wir in Postroff, unserem heutigen Quartier, einrückten. Es war ein sauberes Dorf mit breiter Hauptstraße; ich hatte bei einer Witwe, die uns gut bewirtete, sehr angenehmes Quartier; in demselben Hause etablierte sich auch die Wache. Der gestrige Marsch hatte meinen wunden Füßen den Rest gegeben; als ich sie heute ansah, bluteten sie an mehreren Stellen, stellenweise war ich auf dem bloßen Fleische gelaufen. Meine Kameraden erklärten es für unmöglich, mit solchen Füßen noch weiter zu marschieren und ich selbst fürchtete, wenn ich es übertriebe, zuletzt für lange Zeit marschunfähig zu werden. Dass ich unter solchen Umständen keine Lust hatte, nochmal in die Stiefel zu schlüpfen und einige Stunden im Dorfwirtshaus zuzubringen, wie die Mehrzahl meiner Kameraden tat, lässt sich leicht einsehen. In einem Paar geliehener Schuhe steckend verbrachte ich den Nachmittag und Abend mit Lesen, Rauchen und Plaudern mit den freundlichen Quartierleuten. Ja, ich war oft ganz unglücklich über meine Füße und es geschah mit schwerem Herzen, dass ich mich am andern Morgen marschkrank meldete. Der Führer hatte diesen Zeitpunkt schon vorausgesehen und hieß mich für heute auf das Brotwägelein sitzen. So oft ich auch wieder kam, er ward nie ungeduldig oder unfreundlich, er hatte die Überzeugung und sah es ja, dass ich leistete, was meine Kräfte vermochten, wie er sich ausgesprochenermaßen von seinen Freiwilligen nur des Besten versah. Trotz der Strenge des Dienstes, die er stets aufrecht erhielt, war er väterlich besorgt um das Wohl seiner Mannschaft, und die kleinsten Dinge, von denen das Wohlbefinden eines Mannes abhängen kann, waren ihm nicht zu gering, daran zu denken und davon zu reden. — Wer aber glaubt, ich wäre allein marschkrank gewesen, der täuscht sich sehr, denn ich hatte viele Leidensgefährten, und das Wägelein und später, als dies wegfiel, der große Wagen, wurden niemals ganz leer. Aber während ich nach den ersten vier Tagen marschkrank wurde, brachten es manche Kameraden bis auf den 6., 8., 10. Tag und fielen dann ab; ja einige sind mitten im Marsche zusammengebrochen und etwa 10 ließen wir in Nanzig und Ligny krank zurück. Da die marschierende Truppe oft einen Vorsprung gewann gegen die Wagen, so wurde denselben in der Regel eine Bedeckung von 3 Mann und einem Unteroffizier beigegeben, ein Umstand, welchen die Bamberger gerne zu einem gelinden Marodieren in den passierten Dörfern benützten. —
Am andern Morgen erreichten wir nach kurzem Marsch über hügeliges Terrain das Städtchen Finstingen, Fenestrange, und damit den ersten lothringischen Flecken, der ohne Aufenthalt passiert wurde. Auf schöner, breiter Straße ging‘s dahin, vorüber an großen Gehöften, in deren Nähe das Getreide in mächtigen Haufen aufgetürmt stand, lange Zeit an einem eingegangenen Kanal hin, auf welchen uns der Fuhrmann aufmerksam machte. Am Spätnachmittag erreichten wir Dieuze, ein hübsches Städtchen, auf dessen bedeutendstem Platz wir hielten, resp. abstiegen und wieder eintraten. Wer etwa gehofft hatte, dass für heute Feierabend sei, der sah sich getäuscht. Es war wohl beabsichtigt, hier zu bleiben, aber nicht durchführbar, und so hatten wir noch einige Kilometer zu marschieren bis nach Genestroff. Diese häufig eintretenden Enttäuschungen wirkten immer sehr niederschlagend: einesteils wollten die Füße nicht mehr recht tragen, andernteils versprach man sich mit Recht in den Städten und Städtchen bessere Quartiere und angenehmeren Aufenthalt als auf dem platten Lande. Ich litt heute nicht unter der weiteren Ausdehnung des Marsches; die Ruhe und Schonung, die ich genossen, war den Füßen sehr ersprießlich geworden, und da es mir gar nicht schwer fiel, die Strecke nach Genestroff in Reih und Glied zu marschieren, so beschloss ich bei mir, morgen wieder das Gehen zu probieren. . .
Also zum ersten Mal bei Französisch redenden Franzosen einquartiert werden, wie wird das gehen? so fragte man mit einigem Bangen. Es ist recht sehr zu bedauern, dass man auf dem Gymnasium gar nicht im Sprechen der schönen Sprache geübt wird. Aber jetzt war man doch recht dankbar auch für das wenige, was man davongebracht hatte. Mein Schicksal wollte, dass ich es zum ersten Male an einem Vertreter der edlen Schuhmacherzunft zu probieren hatte. Es war ein lediger Mann, der mich sehr freundlich aufnahm, wie dies das ganze Dorf tat, woraus wir schlossen, dass wir die ersten Deutschen in loco waren. Am Abend machte er sich ein Vergnügen daraus, mich in die Dorfschenke zu führen und mit Speise und Trank zu regalieren. Nun mit dem Französischen machte es sich ganz leidlich: das Vermögen, Gesagtes zu verstehen, erwies sich recht brauchbar; aber selbst zu sprechen, davor hatte man eine gewisse Scheu, man traute sich nicht recht heraus damit, konnte auch sicher sein, wenn man mehr als die allergewöhnlichsten Worte gebrauchte, sofort von den Franzosen gefragt zu werden: Parlez-vous français? Was war da anders zu tun, als sich für jetzt und später mit dem hundertmal angewandten, verlegen hervorgestoßenen: un peu! zu salvieren. Am andern Morgen gab‘s denn auch manchen Spaß zu erzählen, manches nette Missverständnis kam an den Tag, und allgemeine Heiterkeit erregte es, als einer der Kameraden bemerkte, er wisse nicht, habe sein oder der Franzosen französisch nicht gelangt: immer wenn sie etwas haben oder hergeben sollten, sei er nicht verstanden worden. Natürlich existierten in unserer Truppe auch mehrere der kleinen Büchelchen für der Sprache völlig Unkundige mit den vermutlich am meisten vorkommenden Fragen, denen die Aussprache in deutschen Lettern beigesetzt war; mit ihnen half sich so mancher leidlich durch, und es war köstlich zu hören, wenn unsere völlig sprachunkundigen Kameraden auf dem Marsche sich und andere daraus instruierten und sich Fragen einzuprägen suchten wie: Haben Sie Wein? Haben Sie Kartoffel? Wo wohnt der Maire? — Der Umstand, dass die schöne Sprache anders ausgesprochen als geschrieben wird, reizte sie zu sehr unliebsamen Bemerkungen und zu derben: Spott, dem einer die Krone aufzusetzen vermeinte mit dem eleganten Witz: Ochs schreibt man’s und Rindvieh spricht man’s. Es gab auch solche unter ihnen, die das ganze Zeug für unnötig erklärten und meinten, sie würden‘s den Roten schon sagen und weisen und sich selber holen, was sie wollten. Sie werden wohl kaum mehr als ein halbes Dutzend französischer Vokabeln von ihrem dreivierteljährigen Aufenthalt in Frankreich mit heimgebracht haben.
Meinem Vorsatze gemäß marschierte ich andern Tags tapfer mit, wenn auch meine Füße empfindlich schmerzten. Ohne das Städtchen Moyenvic oder die Festung Marsal zu berühren, hielten wir auf einem schönen Landgut die Mittagsrast; die Mehrzahl unter uns verbrachte sie in einem Schafstall, auf dessen frischer Streu es sich prächtig schlief. Als ich mich nach der Rast gar nicht wieder zusammenraffen und vor Schmerzen kaum auftreten konnte, hieß mich der Führer den Wagen erwarten und nochmals fahren. Ich traf schon mehrere Kameraden auf demselben an und auf dem Weitermarsche erhielt seine Befrachtung noch Zuwachs, indem ein Kamerad, nachdem er plötzlich zusammengebrochen war, wie ein Toter auf ihn gelegt werden musste. Er hatte sich bis zum andern Tag ziemlich erholt, wurde aber in Nanzig gelassen und von mir nicht wieder gesehen, was nicht ausschließt, dass er später nachkam und einer andern Kompagnie zugeteilt wurde.
Der heutige Abend brachte mir ein Quartier, an das ich mit Vergnügen denke. Es war in Réméreville im Departement Meurthe, etwa 6 Stunden von Nanzig. Als wir nach Empfang der Quartierzettel, welcher auf dem großen Platz mitten in dem freundlichen Flecken stattfand, uns auf die Suche machten, war die meinige sehr bald beendet, denn einige Jungen bezeichneten ein am Platze selbst liegendes, von einem freundlichen Garten umgebenes Haus als das meinige. Es hatte zwar alle Läden geschlossen wegen der Fliegen, wie ich nachher erfuhr und auch sonst oft sah, aber als ich eintrat, wurde ich von dem kinderlosen Kaufmannsehepaar Jésserond sehr freundlich begrüßt; den Namen ersah ich aus einem mir überreichten Rechnungsformular, wogegen ich mich mit einer Visitenkarte revanchierte. Dem stattlichen brünetten Mann sah man sofort den ehemaligen Soldaten an und ich war noch nicht lange unter seinem Dach, da hatte er schon mit Stolz auf seinen imposanten Militärabschied unter Glas und Rahmen hingewiesen; er hatte in der Krim mitgekämpft und längere Zeit auf der Insel Martinique gestanden. Seine hübsche Frau war sehr gütig gegen mich; sie bedauerte mich lebhaft um meiner Füße willen, sie strich mir durchs Haar und als ich abends schon halb entkleidet war, kam sie, von ihrem Gatten begleitet, nochmal, um mich zu fragen, ob ich noch etwas bedürfe. Nach meinem Alter wurde ich sehr häufig, hier zum ersten Male, gefragt und die Mitteilung desselben stets unter lebhaftem Bedauern vernommen. Trotz der mangelhaften Konversation — die Frau konnte von einem Straßburger Aufenthalte her einige deutsche Brocken — war es so gemütlich und behaglich in diesem Hause, dass ich dachte, das Frankreich lasse sich recht gut an. Noch vor dem Abendessen kamen einige in der Nachbarschaft liegende Kameraden, auf Zuspruch und unter der Leitung eines französisch Sprechenden ging eine leidliche Unterhaltung zusammen; als sie gegangen waren, blieb ich wie der Sohn des Hauses zurück und wir setzten uns zu Tische. Es gab trefflich bereitete Tauben, mehrere Kompotts, Salat und Honig, an Wein gebrach‘s natürlich auch nicht. Als wir uns setzten, glaubte ich mein bon appétit anbringen zu müssen: wie erstaunte ich aber, als auf dies die Ehegatten sich ansahen, die Frau aber laut sagte: Protéstant. Als sich ihre Blicke auf mich richteten, bejahte ich dies. Diese Entdeckung ihrerseits hatte aber nicht den geringsten Einfluss auf ihr Verhalten gegen mich, es blieb bis zum Schluss gleich liebevoll und freundlich. Während des Essens bemühte sich die Frau vergeblich das Wort „Honig“ zu sprechen; trotz aller Versuche brachte sie es nur zu den Lauten „Chillich“. Beim Abschiednehmen musste ich versprechen, zu schreiben. Ich bin aber nie dazu gekommen, werde also vielleicht von den guten Leuten für tot angesehen. Sie begleiteten mich beide hinaus bis zur Gartenpforte, wo Frau Jésserond stehen blieb und mit einer Lorgnette die sich sammelnden Jäger betrachtete, während der Herr sich zu entfernter stehenden Männern begab. Das halbe Dorf war auf den Beinen und unsere Uniform schien es den Lothringern angetan zu haben. Während wir so dastanden — unsere Offiziere waren noch nicht da — kam einer meiner Kameraden, der abends zuvor auf Einkehr gewesen war, auf den Einfall, die lorgnettierende Frau Jésserond küssen zu wollen. Wir bestärkten ihn darin und nicht lange, so hatte er sich an der Gartenmauer herangeschlichen, die Frau in die Arme genommen und geküsst unter unserem und der umstehenden Französinnen Gelächter und Gekreische. Sie zog sich selbst lachend bis an die Haustüre zurück und erwiderte von dort die Abschiedsgrüße, die wir ihr noch zuwinkten.
Das außergewöhnlich lange Ausbleiben unserer sonst äußerst pünktlichen Offiziere gab uns allerlei zu denken, erwies sich aber endlich für uns von sehr angenehmen Folgen. Unser Führer hatte gesehen und wohl auch gehört, dass in Réméreville ein auffallend großer Reichtum an Pferden herrsche. Sofort hatte er dabei an seine Jäger gedacht, welche wieder zwei sehr starke Marschtage hinter sich hatten, und beschlossen, ihnen daraus ein Bene zu bereiten. Denn fast gleichzeitig mit ihm fuhren drei vierspännige Wagen deutscher Art vor und der Befehl erging, sämtliche Tornister abzunehmen und auf einen derselben zu legen, während alle, die sich schwach oder fußkrank fühlten, die beiden andern besteigen sollten. Davon wurde denn ausgiebiger Gebrauch gemacht und war es eine Lust, aus diesen geräumigen Wagen — es war das erste und bis jetzt einzige Mal, dass ich vierspännig fuhr — in den Morgen hineinzufahren.
Um die Mittagsstunde marschierten wir in Nanzig ein; die Fahrenden hatten eine halbe Stunde vor der Stadt die Wagen verlassen und waren wieder eingetreten. Durch schöne, äußerst belebte Straßen hindurch ging‘s auf den prächtigen Stanislaus-Platz, welcher von einem hohen, goldverzierten Gitter umgeben und von den stattlichsten Gebäuden umschlossen ist. Von den umstehenden oder passierenden Franzosen bekamen wir verschiedenartige Bemerkungen zu hören, welche sich bezogen auf unser flottes Aussehen, auf unsern Wagen, in dem sie Proviant vermuteten, oder aber auf die Unerschöpflichkeit Deutschlands an Soldaten. Mon dieu, quand céssera ça! machte ein feiner Herr seinem gepressten Herzen Luft, und wie mit einer gewissen Befriedigung tauschten einander Begegnende nur das Wort aus: Bavarois.
Nachdem noch der Befehl erteilt war, um 4 Uhr zur Gewehrvisitation wieder anzutreten, wurden wir mit Quartierzetteln entlassen. In einer der schönsten und frequentesten Straßen lag das sonst einfache Haus des Bankiers Weille, es war wohl der Name Weil, welchem den Franzosen zu lieb das le angehängt war. Ich hatte das Haus sehr rasch gefunden, wen ich auf der Straße französisch ansprach, der antwortete mir deutsch. Ich traf schon zwei Soldaten dort, ich weiß nicht mehr welchen bayerischen Regiments. Von unserem im 3. Stock gelegenen Zimmer, einer reinen Soldatenstube, hatten wir eine schöne Aussicht auf unsere und einige anliegende Straßen. Die Hoffnung auf ein gutes Quartier bei solchem Stand erwies sich sehr trügerisch. Denn das Essen war abends recht einfach und schmal und morgens mussten wir, freilich schon um 5 Uhr, ohne Frühstück fort. Nach Herstellung allseitiger Propretät wurde zur Gewehrvisitation gebummelt. Es tat einem wohl, wieder einmal in einer so großen und so schönen Stadt zu weilen. Zur Gewehrvisitation waren auch einige Erlanger Bekannte, lauter Felddiakonen, erschienen und fand herzliche Begrüßung statt. Der Stanislaus-Platz gefiel mir jetzt noch besser; eben zog ein preußisches Bataillon mit Trommeln und Pfeifen darüber hin, und vor den eine ganze Seite des Platzes einnehmenden Cafés lebte es nur so von deutschen Offizieren, wie denn in allen Deutschen eine freudige Stimmung herrschte: Bazaine saß ja nun definitiv in der großen Mausefalle Metz. Nach der Gewehrvisitation nahm mich ein Erlanger Freund mit in sein herrliches Quartier, bestehend aus zwei schönen Zimmern, deren eines eine juristische Bibliothek enthielt; der Sohn des Hauses studierte Jus. Man hat den Diakonen wohl sehr viel zugestanden, als man ihnen Offiziersquartiere und einen Bedienten bonierte. Ihren Opfersinn und die Hingabe in allen Ehren, aber Ärzte waren sie ja doch nicht. Wir waren kaum eingetreten in das Zimmer, als hinter uns drein die Dame des Hauses rauschte, Entrüstung im Blick, wie es ihr Zimmerherr hatte wagen können, einen Soldaten mit Gewehr einzuführen. Sie sagte zwar nichts und wir ließen uns in unserem Geplauder nicht im Geringsten stören, erst recht nicht. als sie mit zorniger Gebärde an einem Rouleau sich zu schaffen machte. Die ganze Sache war die, dass ich von ihr als ein in diebischer Absicht Gekommener angesehen wurde. Abends bummelte ich noch ein wenig und kaufte einiges, dann aber begab ich mich bald nach Hause, um morgen früh 5 Uhr möglichst frisch antreten zu können, denn es stand für den folgenden Tag ein starker Marsch zu erwarten.
Am Abend erwies uns die Dame des Hauses die Ehre, uns in unserem Zimmer zu besuchen und ein wenig mit uns zu plaudern. Der Löwenanteil des Gesprächs unsrerseits ruhte natürlich auf mir. Das Woher war bald erledigt und mit Interesse vernahm sie, dass ich von Augsburg sei. Sie war einmal dort gewesen. Anders gestaltete sich das Wohin. Denn unsere stete Antwort: nach Paris! erweckte bei der Frau zunächst eine helle Lache, dann aber wurde uns allen vor Paris der Tod verkündet und dessen Unbesieglichkeit mit einer drastischen Beschreibung seiner Verteidigungsmittel geschildert: Pech und Schwefel und siedendes Wasser, unzählbare Kanonen, Granaten und Bomben so groß als sie mit beiden Armen spannen konnte, würden uns empfangen und Tod und Verderben bringen. Je ruhiger sie uns bei dieser haarsträubenden Schilderung bleiben sah und je gelassener wir entgegneten: das macht uns nichts, wir gehen nach Paris und nehmen es! desto lebhafter ward unsere Dame und verabschiedete sich zuletzt uns alle für verloren gebend. Solche Dispute hatten wir öfters zu bestehen und wurden dieselben für uns geradezu spaßig, wenn die „an der Spitze der Zivilisation marschierende große Nation“ jammervolle Kenntnisse in der Geographie an den Tag legte.
Andern Tags 5 Uhr früh kehrten wir der schönen, noch schlafenden Stadt den Rücken und marschierten zunächst nach dem Bahnhof, wo sich nach und nach mehrere Abteilungen versammelten, auch ein Nachschub des 3. Infanterieregiments, in dem ich einen Landsmann begrüßen konnte. Nach reichlich 1 ½ stundenlangem Warten — wir schmeichelten uns zuletzt, wir würden Eisenbahn fahren — wurde endlich in großer Kolonne abmarschiert. Aus welchem Grund dies geschah und warum sie dann doch wieder sich bald auflöste und wir allein marschierten, darüber kann ich nicht Ausschluss geben; ich kann nur vermuten, dass die vor uns liegende, noch in Feindesgewalt befindliche Festung Toul mit diesen Vorkehrungen im Zusammenhang stand. Indem sie uns zwang, südwärts auszuweichen, brachte sie uns in die Nähe der klassischen Orte Vaucouleurs, Gondrecourt, Domremy. Deutlich erinnere ich mich einer prächtigen Aussicht von einem Plateau herab auf eine immer tiefer verlaufende, von einem Fluss durchströmte Gegend; deutlich eines Dorfes, in welchem die ganze Kolonne Halt machte, und hat sich mir besonders ein Regenschirmmacher eingeprägt, der von Haus zu Haus ging und auf mich den Eindruck eines Spionen machte. Dadurch, dass wir gleich von Nanzig aus südlich marschieren mussten, um bei Pont St. Vincent den Übergang über die Mosel zu gewinnen und dadurch, dass dieser Umweg wieder eingebracht werden sollte, wurde der heutige Marsch trotz des Königstags in der Heimat ein 11 ½ Stunden umfassender, an Strapazen, Hunger und Durst überreicher. Ich konnte auch nur die größere Hälfte leisten; einige Leute brachen zusammen, darunter ein Kamerad, der wenige Jahre nachher als Unteroffizier in Erlangen verstarb. In der Dämmerung kamen wir in einem ziemlich l)och gelegenen Flecken an, in dem soeben eine preußische Kavallerieabteilung abgesessen war. Dies war wohl der Grund, weshalb wir noch eine Stunde in die Nacht hinein marschieren mussten, bis wir endlich in einem elenden Dorfe Ruhe fanden. Ich kam mit drei Kameraden zu einem ganz armen Manne, dessen Weib mich um ein bisschen Tabak für denselben bat, als sie mich morgens ein Pfeifchen stopfen sah.
Andern Tags war Regenwetter; deshalb und um des gestrigen furchtbaren Marsches willen rückten wir bald nach Mittag ins Quartier und zwar in dem an der Maus gelegenen Dorfe Ugny, wo wir von einer Kinderschar fröhlich empfangen wurden; es waren aber auch alte Kinder dabei, und deutlich erinnere ich mich eines alten Schweden, der gar rührig mit Händen und Lippen uns ein „Rataplan, Rataplan“ vortrommelte. Waren wir von alle dem schon sehr angenehm berührt, so stieg die allgemeine Zufriedenheit auf den höchsten Punkt, als unser verehrter Führer erklärte, dass morgen Rasttag sei; nur im Laufe des Vormittags werde eine Propretätsparade stattfinden, sonst gehöre uns der ganze Tag zur Ruhe und Erholung. Noch erhielten wir den Befehl, die Gewehre zu laden und nicht in den Gärten umherzustreifen. Dann wurden wir entlassen und ich kam mit noch einem Kameraden in ein recht wackeres Bauernhaus. Den Rasttag benutzte ich, meinen ersten Brief aus Frankreich nach Hause zu schreiben.
Am Nachmittag des Rasttages geriet mein Hausherr in heftigen Schreck, als er von weitem einen preußischen Trainsoldaten mit einem Zaum in der Hand das Dorf bedächtig durchstreifen sah; er erkannte in ihm sogleich einen, der ein Pferd suche und da er im Besitz eines solchen war, bat er mich, da ich gerade unter der Haustüre stand, hereinzugehen, damit ich nicht etwa von dem Manne gefragt würde. Ich willfahrte seiner Bitte und er hat für diesmal sein Pferd gerettet; war’s ein gutes, taugliches, so wird er’s wohl nicht durchgebracht haben.
Der Rasttag nahm auch wieder sein Ende und andern Tags legten wir die im Brief erwähnten 7 Stunden nach Ligny zurück, einem hübschen, ganz in schönen runden Weinbergen steckenden Städtchen. Man sah es gar nicht eher, als bis man fast schon drinnen war. Wir wurden mit Zetteln einquartiert. Solche Zettel waren in den Städten durchaus im Gebrauch. hin und wieder auch auf dem Lande; sie hatten etwa den Wortlaut: Mr. . . . logera . . . hommes a . . jour avec/sans nourriture. Datum und Ort. Le maire. In der Regel wurde einer der besten Marschierer unserer Truppe vorausgesandt als Quartiermacher an den jeweils zu erreichenden und zum Quartier bestimmten Ort, so dass, wenn wir ankamen, alles schon fertig und bereit war. Ich kam mit zwei Kameraden, davon einer unser alter Hornist war, in eine große Schreinerwerkstätte, wo schon zwei Soldaten des 3. Reg. aus der Babenhauser Gegend lagen. Die Franzosen waren freundliche Leute, die uns alle in einem Zimmer quartierten, so gut es eben ging. Unser alter Hornist war kaum eingetreten, als er sich krank zu Bette legte und in kurzer Zeit vom heftigsten Fieber ergriffen war. Die erschreckten Franzosen taten im Verein mit uns alles, was zu dessen Dämmung geschehen konnte. Noch selbigen Tages meldeten wir es dem Führer, der einen Arzt ausfindig zu machen versuchen wollte. Der Kranke befand sich andern Tags nicht besser und musste unter diesen Umständen in L. zurückgelassen werden. Vor Paris wurde uns expediert, dass der Hornist K. in einem Spital gestorben sei. Er war ein Mann von Ehre; denn als einmal ein Soldat sich vergaß und ihn einen alten Planisten nannte, machte er höchst entrüstet dem Herrn Oberlieutenant hievon Meldung, was jenem eine Strafwache eintrug. Das Wort „Planist“ (= Herumschweifer, Streuner) war für einen Soldaten die größte Beleidigung, so wurde es allgemein angesehen, und ein Streit war entweder schon ernst oder wurde es sofort, sobald das Wort „Planist“ fiel.
Auf dem Marsche hatten wir uns dem Städtchen Vaucouleurs — es zeichnete sich später als Franktireurnest aus — aus eine halbe Stunde genähert und die an einem Kanal gelegene Stadt Void gestreift, so dass wir nur eben den Kanal und die Schiffe darauf sahen; die sehe ich aber auch heute noch. —
Von da an ungefähr fing unser Führer eine etwas veränderte Marschweise an, die sich sehr bewährte und gewiss auch mir mehr Widerstandskraft gegen die Strapazen des Marsches verlieh. Wir brachen nämlich sehr frühzeitig auf, meist noch in der Dämmerung, und marschierten dann bis 11 Uhr, 12 Uhr mittags, wo wir auf 3 Stunden einquartiert wurden. Von 3 Uhr an marschierten wir dann noch 4—5 Stunden. Die Mittagsstunden benutzten wir regelmäßig und gewissenhaft dazu, uns durch Schlafen zu stärken. Die Märsche selbst wuchsen durch diese Einrichtung ganz bedeutend, aber es wurde uns viel leichter, sie zu leisten, als wenn es in einem Stücke fortging ohne reichliche Rast und Erholung. Nicht nur den Beinen, sondern vor allem den Schultern und der Brust tat diese Ruhe äußerst wohl und belebte sie mit neuer Kraft. Andrerseits kamen wir auf diese Weise ungemein rasch vom Fleck und ließen alle andern Nachschübe hinter uns zurück.
Freilich die Schönheit der Quartiere ging damit flöten; es war allemal schon am Dunkeln, wenn wir in das letzte Dorf einmarschierten, in dem wir bleiben wollten, und da wurden denn nach der Größe und dem Ansehen der Häuser hierhin 6, dorthin 4 Mann gewiesen; niemals wurde einer allein einquartiert, zwei zum mindesten waren stets beisammen. Durch diese späte Störung wurden die Franzosen, die sicherlich schon Gott gedankt hatten, dass der Tag vorüber war, ohne ihnen Einquartierung gebracht zu haben, sehr unangenehm berührt und manche waren auch sehr unfreundlichen, trotzigen Wesens. Viel Quartier mussten wir überhaupt nicht in Anspruch nehmen, denn durch diese gewaltigen Märsche war es möglich, die schon in der Luftlinie 110 Kilom. betragende Entfernung von Bar le Dur nach Sedan in 4 ½ Tagen zurückzulegen. Fasst man aber ins Auge, das der Weg durch den Höhenzug der Argonnen ging und wie in jedem Gebirgszug so auch hier sich vielfach um die Berge herum und über dieselben hinweg windet, so wird man gestehen müssen, dass dies eine höchst respektable Leistung von einer so jungen Truppe war. Ich muss freilich offen sein und gestehen, dass ich diese sämtlichen Kilometer nicht selbst unter die Füße genommen habe: die Fußschmerzen hatten sich noch nicht gegeben, die feste Haut sich noch nicht gebildet, ab und zu musste ich noch den Wagen gebrauchen, aber es geschah in geringem Maße und ich fühlte es, mein Notstand würde demnächst sein Ende erreichen: der Nachmittag des vorletzten August sah mich zum letzten Mal den Wagen besteigen; dann war‘s überstanden.
Und wie die Schönheit der Quartiere flöten ging, so ist mir und wohl den meisten meiner Kameraden noch etwas entgangen, das sind die Namen der Orte, in denen wir Mittagsruhe hielten oder nächtigten. Ich bin nicht imstande, außer Clermont, Varennes, Grand Pré und Raucourt auch nur einen Namen zu nennen. Man war zu erschöpft, wenn man ins Quartier gekommen war, um noch nach Namen sich umzutun oder zu fragen; wegen der paar Stunden Mittagsruhe es zu tun, hielt man erst recht nicht der Mühe wert; man war’s zufrieden, wenn man etwas genossen hatte und begab sich dann schleunigst zur Ruhe. Zudem waren es außer den genannten Städtchen meist ganz unbedeutende Orte, in denen wir lagen. Aber wenn auch die Namen fehlen, die Sache lebt noch ebenso frisch in meinem Gedächtnisse, wie das bisher Erzählte; ja es hat sich mancher Vorgang, mancher Ort auf diesem Wege ganz besonders fest mir eingeprägt und ist mir jetzt eine Lieblingserinnerung.
Aber bevor wir uns auf den Weg begeben, habe ich noch zu bringen, was in der freundlichen Stadt Bar le Dur,
auf welche von einer Anhöhe herab ein ausgedehntes älteres Schloss sieht, wahrscheinlich das des Duc, sich zutrug. Ich kam mit meinem Kameraden Str., der sehr gewandt französisch sprach, durch einige Straßen hindurch zu zwei alten Fräulein ins Quartier. Sie waren sehr freundlich, aber das Gewehr und die Erklärung, es sei geladen, flößte ihnen einiges Grauen ein. Als kurz darauf eine junge Frau mit mehreren Kindern eintrat, waren wir so aufmerksam, unter lautloser Stille ihrerseits die Gewehre zu entladen, nach welcher Prozedur alles sichtlich erleichtert aufatmete. Seit den schlimmen Erfahrungen in Nanzig pflegte ich die auf dem Quartierzettel enthaltene Bemerkung avec nourriture laut vorzulesen oder doch sonst wie darauf hinzudeuten. Auch hier tat ich‘s in meinem elegantesten Französisch, und binnen einer halben Stunde stand ein gutes reichliches Essen auf dem Tisch, das wir uns trefflich schmecken ließen inmitten unserer guten Fräulein. Gleich nach dem Essen erschien ein junger Mann, offenbar der Eheherr der inzwischen weggegangenen Frau. Str. erklärte ihn für einen Lehrer; wenn er auch ohne Frage zu den sog. Gebildeten gehörte, so scheint mir dies in Hinsicht aus seine haarsträubenden Geographiekenntnisse doch fast unmöglich, oder ich müsste seine Schüler von Herzen bedauern. Wir hatten‘s diesem Mann schon beim Eintreten am Gesicht angesehen, dass er mit uns anzubinden wünsche und hatten uns auch kaum erhoben, als der Fall eintrat, indem der Herr uns nach dem Woher fragte. Es schien indessen gnädig ablaufen zu wollen, denn die Frage nach dem Wohin blieb gegen alles Herkommen völlig aus und schon wollten wir uns aus das vorhin bestellte Zimmer zur Ruhe begeben, als der Franzose herausbrach und uns zurief:
Wir und alle Deutschen würden in der kürzesten Zeit den Heimweg antreten. Das war denn doch eine sehr überraschende Nachricht für uns und zu verlockend, von einem heißblütigen Franzosen die Gründe zu dieser ungeheuerlichen Behauptung entwickeln zu hören und so blieben wir und opponierten, um ihn recht herauszulocken. Ich weiß nun die Gründe, die der gute Mann dafür vorbrachte, nicht mehr alle, aber das ist mir unvergesslich: das Hauptverdienst an unserer Umkehr und schließlichen Besiegung schrieb er der französischen Flotte zu; sie sei schon vor Hamburg und bombardiere demnächst Berlin. Also die Flotte bombardiert Berlin! Darauf blieb er stehen und ließ es sich um keinen Preis der Welt ausreden, weder durch Beweise aus der Geographie noch durch Spott, den wir ihm boten, noch durch den Hohn, den er aus unserm Lachen herausfühlen musste. Wir ließen ihn endlich an den Wassern zu Berlin stehen und begaben uns hinauf in die Mansarde, wo ein Doppelbett zur Ruhe einlud. „Will der Kerl auch noch Berlin zur Seestadt machen“ meinte Str. im Hinaufgehen; „Wir haben doch an Leipzig schon eine famose.“
Untertags schlafen ist sonst nicht meine Sache gewesen, ist‘s auch bis zum heutigen Tage nicht geworden. Damals war’s anders: der ermattete Leib nahm mit Dank die gebotene Ruhe an; wie nur die Glieder ausgestreckt waren und sich nicht genug tun konnten zu ruhen, nahm einen auch bald Freund Morpheus in die sanften Arme. Zwar heute hatte uns die Begegnung mit unserm Franzosen teils etwas aufgeregt teils erheitert, so dass das Einschlafen ein bisschen verzog; aber es kam doch und bald waren zwei Stunden prächtig verschlafen. —
Pünktlich zur befohlenen Stunde geweckt, begaben wir uns sogleich nach freundlichem Abschied von den lieben Damen auf den zur Aufstellung bestimmten Hauptplatz und hatten noch eine Viertelstunde Zeit zu bummeln, einen lieben Freund und Studiengenossen, Reservelieutenant eines Münchener Landwehrbataillons, zu begrüßen und das kleine Wunder von einem Cafè flüchtig zu besichtigen, von welchem ich oben sprach. Später erzählte mir Str. in Erlangen, dass er auf dem Heimmarsche die Damen besucht habe, wobei ihr erstes war, nach seinem Kameraden zu fragen, ob der etwa gefallen sei.
Wie die ganze III. Armee von Bar le Dur ab den berühmten Marsch nach Norden angetreten hatte, so begannen auch wir von hier aus diese Richtung einzuschlagen, indem wir an jenem Tage noch 3—4 Stunden nördlich über Bar le Dur hinaus marschierten.
Wenn ich nun zuerst von den Quartieren rede, die ich auf diesem Marsche hatte, so waren sie recht verschieden, darin aber waren sie sich gleich, dass uns sehr wenig zu essen geboten wurde und wohl auch geboten werden konnte; woher hätte es auch kommen sollen, nachdem vorher Hunderttausende von Menschen wie ein Heuschreckenzug über die Gegend hinweggezogen waren? Wassersuppe und einige Kartoffeln konnten doch zumeist verabreicht werden, aber sonst war nicht viel zu wollen, manchmal gab’s das nicht. Einmal wollte uns, mich und einen Bamberger nämlich, ein Franzose nicht hineinlassen, als wir spät abends an seine Haustüre pochten. Er hatte sich mit den Seinigen offenbar versteckt und es sollte scheinen, als ob das Haus leer sei. Damit war uns in der Tat viel zugemutet, denn wir sahen deutlich in der Stube Feuer brennen. So standen wir denn nicht ab zu rufen und zu pochen; endlich auf einen gewaltigen Stoß mit dem Kolben kam der Bauer, ein ruppiger, struppiger, unheimlich aussehender Kerl. Seine Frage nach dem Billet beantworteten wir mit der Aufforderung, uns zu essen zu geben, aber er wollte nicht hören, versicherte hoch und teuer nichts zu haben und dabei blieb er, trotzdem mein Bamberger Kamerad ihn fast tätlich bedrohte. Er wies uns zuletzt ein neben dem Wohnraum befindliches völlig leeres Stübchen zum Schlafen an, ließ ein Licht da und verschwand. Auch mein Bamberger konnte sich dem Eindruck nicht entziehen, dass dies eine unheimliche Geschichte sei, ein Eindruck, der dadurch nur verstärkt wurde, dass keine Seele, weder Weib noch Kind, sonst sich sehen ließ und dass wir in unsrem Stübchen den Eingang zum Keller entdeckten; derselbe war so mit Gerümpel vollgestopft, dass wir nicht zur Türe gelangen konnten, sondern uns darauf beschränken mussten, mit Säbel und Bajonett dasselbe zu durchstechen. Andererseits zeigte sich, dass man ohne lautes Geräusch durch die Kellertüre nicht zu uns heraufdringen konnte. So legten wir uns denn nach einer Prüfung der Fensterstöcke und des Türschlosses auf unser Stroh, die geladenen Gewehre und die blanken Säbel neben uns. Die Nacht verging indessen ruhig und ungestört. Am andern Morgen machten wir uns daran, die Kellertüre bloßzulegen, konnten aber nicht weit damit gelangen, da frühzeitig abmarschiert wurde; doch fiel uns eine ziemlich große Büchse gebrannten Kaffees in die Hände. in welche wir uns redlich teilten. Konsequenterweise wurde uns auch vor dem Abmarsch nichts zum Essen geboten und wir mussten aus dem Brotsack leben, der nicht eben vollgestopft war. Dass wir zum Schluss am liebsten unserm Bauern eins heruntergehauen hätten, wird jedes gerne glauben.
Es gab aber auch hier noch gute willige Menschen unter den Franzosen: Ich sehe heute noch eine Mutter vor mir stehen, aus deren ganzem Blick das Bedauern mit meiner Jugend, mit meinen wundgelaufenen Füßen sprach, und nicht wenige waren es, die ein teilnehmend fragendes oder gutmütig konstatierendes mal aux pieds? an mich richteten, wenn sie mich die Füße reiben und pflegen oder beim ersten Auftreten nach längerem Sitzen zusammenzucken sahen. Ihre verdächtigen Holzpantoffeln, welche ich mir zuweilen entlehnte, waren auch keine Wohltat für die Füße. In einem Quartier erschien aus einem Nachbarhause, wenn auch nur auf kurze Zeit, ein junger französischer Soldat, der es offenbar beim Durchmarsch durch die heimatlichen Gefilde vorgezogen und Gott weiß, mit welchen Mitteln durchgesetzt hatte, statt nach Sedan zu marschieren an den väterlichen Herd zurückzukehren. Nun wir hatten auch kein Interesse, ihn darin zu stören, Gefahr drohte von diesem Manne mit dem offenen, freundlichen Gesichte wohl niemand.
In einem andern Quartier war ich mit noch 8 Mann, darunter auch dem Secondjäger, einquartiert. Während dieser mit zwei Kameraden ein requiriertes Huhn verzehrte, wandte ich mich mit der Bitte um Brot an ein französisches Mütterchen. Sie winkte mir freundlich, ich folgte ihr durch mehrere Gelasse bis vor einen Schrank hin, aus welchem sie mir ein schönes Stück Brot reichte mit der Bitte, es niemandem zu sagen; mit der Erfüllung dieser Bitte beantwortete ich ihre Gutherzigkeit.
Einmal endlich trafen wir, als wir zu viert spät abends ein Bauernhaus betraten, eine ganze Gesellschaft von Männern und Frauen in lebhafter Unterhaltung. Sie waren nicht eben unfreundlich und teilten uns von dem, was sie gerade verzehrten, mit, Brot und Obst. Wir verdufteten dann bald in der uns zum Schlafen angewiesenen Scheuer, während sich Kamerad Str. noch ein wenig mit ihnen unterhielt.
Was sich uns nach unserem Abmarsch von Bar le Duc bald aufdrängte, war die Wahrnehmung, dass viel seltener als bisher deutsche Truppen, deutsche Soldaten zu sehen waren; vereinzelt zeigte sich gar niemals mehr ein solcher. Es war ersichtlich, dass eine große Aktion sich vorbereitete, dass „alles nach Einem Ziele hinstrebte“. Ob wir noch dazu eintreffen werden? fragten wir uns oft. Wie die Stille vor dem Gewitter mutete es einen an, „wir wussten ja, recht sehr weit konnten wir von unserem Bataillon, von der III. Armee nicht mehr sein. Dieses fast völlige Verschwinden zweier gewaltiger Armeen war wirklich großartig.
Wir marschierten, wie oben gesagt, so ausgiebig, dass wir alle mit uns auf französischem Boden angekommenen Nachschübe hinter uns zurückließen, nur am ersten Tage nach Bar le Dur, als wir zum Abmarsch bereit dastanden, hörten wir in der Stille des Morgens das „Pack dein Bündele, pack dein Sack“ schlagen, bis es in der Ferne erstarb. Und einmal, am vorletzten Tage vor Sedan, begrüßten wir in einem Dorfe, in welchem wir Rast hielten, eine Abteilung des 5. Jäger-Bataillons, geführt von dem uns aus der Universitätsstadt bekannten Landwehrlieutenant W. Er ist am 13. Oktober beim Ausfall von Bagneux gefallen. Selbiges Dorf war, ich weiß nicht aus welchem Grunde, von seinen Bewohnern nahezu verlassen und trug Spuren wie von Plünderung, weshalb wir auch ungestört in einige Gärten eindrangen und Beeren und anderes Obst nach Kräften aßen.
Unserm Führer lag natürlich alles daran, uns hinlänglich Speise zu verschaffen, um uns bei Kräften zu erhalten; aber es wollte nicht immer gelingen, einen Etappenkommandanten zur Abgabe aus seinen oft spärlichen Vorräten zu bewegen. Endlich in Clermont wurde uns kurz vor dem Abmarsch ein Viertel Rind ausgefolgt, bei dessen Anblick uns das Wasser im Mund zusammenlief. Es hieß indessen noch Geduld haben und die Mahlzeit erst verdienen, denn das Fleisch wurde auf einen requirierten Wagen gelegt und nach Varennes gefahren, um dort bei einem Metzger ausgehauen und geteilt zu werden. Um doch in allen Stücken sicher zu gehen und nicht etwa um den kostbaren Bissen zu kommen, wurde unser Lieutenant mit vier Mann kommandiert, den Wagen zu begleiten, welcher vorauszufahren hatte, damit die Mannschaft bei ihrer Ankunft in Varennes sofort ihre Rationen in Empfang nehmen könne. Ich bedurfte der Schonung noch und wurde deshalb mit zur Bedeckung kommandiert. So bestiegen wir denn sofort alle den Wagen und fuhren in den freundlichen Morgen hinaus. Es war einer jener zweirädrigen Wagen, welche ich immer für eine gelinde Tierquälerei ansah. Das Pferd geht in einer Doppeldeichsel und wenn der Wagen nicht ganz gleich geladen ist, so hat es viel zu leiden von den Schwankungen, welche es bald niederdrücken, bald emporzerren. Freilich sind die Arbeitspferde, zumal die in der Deichsel gehenden, von ungemein kräftigem Schlag, Normänner; ich habe nie in meinem Leben so schwere Pferde gesehen wie in Frankreich. Die weiße Farbe schlägt vor. Sehr häufig trägt das Pferd einen leichten, aus einer kleinen, blauwollenen Decke bestehenden Sattel, welchen die Führer gerne benützen. Es gibt solche zweirädrige Wagen von ganz bedeutender Länge, die reinsten Brücken; da sind dann 2, 3, 4 Pferde vorgespannt, aber nicht wie bei uns nebeneinander, sondern einzeln voreinander, da hat es das Deichselpferd erst recht schlecht: ziehen die Vorspannpferde a tempo an, so wird es fast in die Höhe gerissen; geht‘s zu Tal, so liegt fast die ganze Ladung auf ihm. Auch für die auf dem Wagen Sitzenden sind die Unebenheiten der Straße sehr fühlbar, teils stürzt alles aufeinander und schiebt sich nach vornen, teils drängt alles nach hinten und verliert das Gleichgewicht, wenn nicht schon bei Zeiten Vorkehrungen dagegen getroffen werden. Item die deutschen vierrädrigen Wagen sind für Mensch und Tier praktischer und wohltätiger als die französischen Zweiräderwagen.
Ungefähr um 10 Uhr langten wir in Varennes an, bei dessen ersten Häusern wir abstiegen und alsbald nach einem Metzger fragten. Bald befanden wir uns auf dem hübschen Marktplatz, der voll Wagen stand mit meist französischen Verwundeten. Sie kamen aus den Gefechten um Beaumont. Man darf mir‘s zutrauen, dass ich dieses französische Städtchen, welches in der Geschichte des unglücklichen Ludwig XVI. eine traurige Rolle spielte, mit besonderem Interesse ansah. Es war jetzt freilich weder Zeit noch Gelegenheit zu historischen Quellenstudien, allein wie ich so über den Marktplatz marschierte und nachher beim Metzger einen Augenblick unbeschäftigt war, hing ich mit meinen Gedanken dieser Affäre doch recht nach, indem ich jedes Haus darum ansah, und verdiente mir damit einen — Rüssel. Das ging so zu. Am untern Ende des Marktes vor einem nicht unbedeutenden Metzgersladen wurde Halt gemacht und das Stück Fleisch zum Zerteilen hineingetragen. Der Lieutenant sagte sein Begehr und ging dann sofort auf die Mairie, um dort Billets zu verlangen, uns das weitere überlassend. Während nun meine Kameraden im Laden blieben, um teils Aufsichts- teils Handlangerdienste zu tun, trat ich heraus auf die Hausstaffel, zündete eine Zigarre an und hing meinen geschichtlichen Gedanken nach, so dass ich völlig übersah, wohin der Bauer mit dem Fuhrwerk, womit doch nachher das geteilte Fleisch auf den Marktplatz geschafft werden sollte, behufs Einstellens und Fütterns sich begab. Nach einem Stündchen kam der Lieutenant wieder, das geteilte Fleisch sollte ohne weiteres vor die Mairie geschafft werden, weil unsere Kameraden demnächst einrücken mussten. Aber wo war der Wagen hingekommen? Niemand wusste es zu sagen. Auf des Lieutenants heftiges Schelten salvierten sich meine Kameraden mit ihrer Anwesenheit im Metzgersladen und schoben alle Schuld auf mich, und über mich ging denn trotz der Landsmannschaft ein ganz nettes Gewitter nieder wegen meiner Unaufmerksamkeit und Gedankenlosigkeit, welches in dem gemessenen Befehl sich austobte: der Wagen müsse unter allen Umständen her. Jetzt überließen wir dem Lieutenant die Aufsicht über das Fleisch und stürzten nach allen Richtungen auseinander, den Bauern zu suchen. Der hatte sich glücklicherweise nur um einige Ecken in einem Wirtshaus niedergelassen, war bald aufgespürt und samt Ross und Wagen im Triumph hergebracht. In aller Eile wurde aufgeladen und eben hatte unser Zug vor der Mairie Halt gemacht, als wir mit dem Wagen in der Mitte antrabten. So war wenigstens nichts versäumt durch meine Geschichtsschwärmerei; im anderen Fall wäre das Gewitter wohl verstärkt wiedergekehrt nach der Regel: Früh Gewitter kommen abends wieder.
Nachdem unsere Kameraden aus der Hand des Lieutenants den Quartierzettel, aus unserer ihre kräftige Fleischration mit vergnügtem Gesicht empfangen hatten, ging‘s auseinander, wir mit dem letzten Quartierzettel. Er führte uns über den das Städtchen in zwei Hälften teilenden Fluss Aire in das Haus eines jungen Schreinerehepaars. Sofort wurden die Anstalten zum Kochen getroffen, und da während des Fleischteilens im Metzgersladen etliche saftige Fleischstücke sich in die Brotsäcke meiner Kochgesellschaft verirrt hatten, so gab‘s eine Kraftbrühe ohne Gleichen und Fleisch in Hülle und Fülle, wovon wir auch unseren verlangend herblickenden Franzosen mitteilten. Etwas blieb noch übrig, was zusammen mit dem im Städtchen gekauften Brot längere Zeit vor dem Hunger schützen sollte; aber ich konnte nur leider nichts lange im Brotsack leiden und fiel bei der ersten Regung neuen Hungers unbarmherzig darüber her. Ich sah mit einiger Schadenfreude, dass viele meiner Kameraden dieselbe hungrige Leidenschaft betrieben, während andere sehr haushälterisch mit ihren Vorräten umzugehen verstanden, dafür aber auch nach Art der Jagdhunde nur in halb sattem oder halb hungrigem Zustand sich befinden konnten. Manchmal erhob sich darüber ein Disput, was von beiden besser sei: Essen bis zur völligen Sättigung und dann Hunger leiden bis zum Rippenkrachen, oder aber stets etwas zu essen haben, aber nie satt, stets nur halb gesättigt sein. Jeder erklärte natürlich seine Art oder Unart für die richtigere, natürlichere, schönere und brachte alle möglichen Gründe dafür auf; aber ich überlasse es dem Leser, sich in beide Lagert hineinzuversetzen und dann zu entscheiden.
Nachmittags um 3 Uhr wurde wieder abmarschiert und mit einmaliger Rast in einem von Pappeln umgebenen Gründchen bis in die sinkende Nacht der Marsch fortgesetzt. Kurz vorher wollte ich mir in einer Apotheke Heftpflaster kaufen auf den Rat des Lieutenants; der Apotheker wollte aber keins haben, wahrscheinlich fürchtete er, es nicht bezahlt zu bekommen; während der Rast gab mir dann jener ein Stückchen, das auf die wunden Stellen des Fußes gelegt von wohltätigster Folge war.
Ich könnte nun noch erzählen, wie wir des öftern an den Lagerplätzen großer Truppenkörper vorüberkamen; wie sich uns einmal eine starke Abteilung norddeutscher Felddiakonen anschloss, am zweiten Tage es aber genug hatte, mit uns Schritt zu halten; wie Verwundeten- und Gefangenentransporte uns begegneten und Patrouillen der gefürchteten Ulanen unsern Weg streiften; wie wir am vorletzten Marschtage spät abends durch ein Dorf marschierend Erlanger Diakonen begrüßten — ich will aber eilen, den letzten Marschtag vor Sedan zu schildern, der meinem Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt ist, um der erlittenen Strapazen ebenso wie um der erhaltenen Eindrücke willen. —