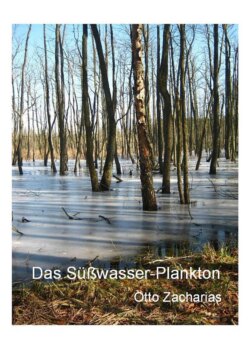Читать книгу Das Süßwasserplankton - Otto Zacharias - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Die planktonischen Krustazeen.
ОглавлениеEs wurde schon eingangs dieser Schrift hervorgehoben, daß kleine Krebstiere einen Hauptbestandteil des Süßwasserplanktons bilden, und es hat sogar- wie wir gesehen haben- die Entdeckung dieser schwebenden Krusterfauna den ersten Anstoß dazu gegeben, daß sich namhafte Naturforscher in größerer Anzahl dem Studium der lakustrischen Tierwelt zuwandten. Nichts ist daher motivierter, als daß wir uns jetzt auch zuvörderst mit diesen niedlichen Gliedertieren beschäftigen und deren nähere Bekanntschaft zu machen suchen. Eine Anzahl von Abbildungen wird uns dabei gute Dienste leisten; denn es ist nicht möglich, dem Laien durch das Medium einer bloßen Beschreibung eine Vorstellung von der körperlichen Beschaffenheit und dem Aussehen dieser kleinen Geschöpfe, die der Volksmund schlankweg als "Wasserflöhe" bezeichnet, zu geben. Diese Benennung rührt offenbar daher, weil man wahrnahm, daß die kleinen Tierchen sich meist mit kurzen Sprüngen im Wasser fortbewegen und somit etwas Flohartiges in ihrer äußeren Erscheinung besitzen. Aber ihren wirklichen Verwandtschaftsverhältnissen nach gehören sie zur Krebsklasse und machen die niedrigste Abteilung derselben aus. Im lebenden Zustande (und mit der Lupe betrachtet) stellen sie äußerst zierliche, fast vollkommen wasserhelle, zarthäutige Geschöpfe dar.
In den nachfolgenden Abbildungen soll dem Leser eine Vorstellung von den eigenartig gestalteten Tierchen gegeben werden, welche in erster Linie an der Zusammensetzung des Planktons teilnehmen und die relativ größten Komponenten desselben ausmachen.
Fig. 3: Hyalodaphnia kahlbergensis.
Da sehen wir nun in Fig. 3 eine ''Hyalodaphnia'' veranschaulicht, welche in Wirklichkeit ein recht winziges Wesen von der Länge eines Millimeters ist. Dabei ist dasselbe vollkommen wasserhell, und als das einzig Gefärbte an ihm erweist sich der grünlich oder gelblich durch seinen Leib hindurchschimmernde Darm (d). Bei A sehen wir das wie mit Perlen umsäumte Auge, bei R die sogenannten Riechfühler, und bei a treten die Konturen des Gehirnganglions hervor. In b sehen wir zwei kleine Ausstülpungen des Darmkanals, die als "Magenanhänge" bezeichnet werden. c ist das Herz, e der Eierstock, f die Schalendrüse (ein Ausscheidungsorgan), und bei g bemerken wir zwei krallenartige Fortsätze, die am Hinterleibsende sitzen und, wenn dieses bewegt wird, zwischen den beiden Schalenklappen, die den eigentlichen Körper des Tieres umschließen, sichtbar werden. v ist das Ende des schwertförmig zugespitzten Kopfes, der das Wasser wie ein Bootskiel durchschneidet, wenn die schmalleibige ''Hyalodaphnia'' sich innerhalb ihres Wohnelementes fortbewegt. Letzteres geschieht mit Hilfe der zweiästigen, langen Vordergliedmaßen (Ruder-Antennen), welche, wie unsere Figur zeigt, zu beiden Seiten des hinteren Kopfteils ihren Ansatzpunkt haben. Nach hinten zu endigt die Schale in einen langen, mit Dörnchen besetzten Stachel.
Fig. 4: Daphnella brachyura.
In Fig. 4 sehen wir den kurzschwänzigen Wasserfloh (''Daphnella brachyura''), der gleichfalls von glasartiger Durchsichtigkeit ist, so daß man auch bei ihm ohne weitere Präparation die ganze innere Organisation des Tierchens wahrzunehmen vermag. Wir erblicken das Auge (Au), das Gehirn (G), das Herz (H), den Eierstock (Ov) und den Darmkanal (D). Letzterer erstreckt sich nach vorn zu bis in die Nähe des Gehirns, wo die gebogene Speiseröhre in ihn einmündet. Die Mundöffnung ist auf unserer Abbildung nicht sichtbar; sie liegt auf der Bauchseite, dicht hinter den beiden gewaltigen und zierlich gefiederten Ruderarmen.
Mit Hilfe dieser starken, muskelkräftigen Gliedmaßen bewegt sich dieser Planktonkrebs in großen Scharen durch das freie Wasser unserer Seebecken, und er wird mit jedem Netzzuge zu Hunderten gefangen, wenn wir die mittleren Wasserschichten in der oben geschilderten Weise (S. 9) befischen.
Fig. 5: Bosmina longispina.
Ein anderer Seenbewohner ist der Rüsselkrebs, der in zahlreichen Arten vorkommt. Die hier veranschaulichte Spezies (Fig. 5), Bosmina longispina, ist leicht erkenntlich an den beiden lang hinausspießenden Schalenstacheln. Im allgemeinen stimmt er in seinem Bau mit der vorher beschriebenen Form (''Daphnella'') überein. Nur trägt er (und auch die ihm verwandten Spezies) steife, rüsselförmige Fühlhörner vorn am Kopfe, die dem kleinen Wesen, wenn es von der Seite wie in unserer Abbildung, gesehen wird, das Aussehen eines Elefanten en miniature verleihen. Die Bedeutung der Buchstaben ist wegen der nahen Verwandtschaft beider Gattungen ganz dieselbe wie in Fig. 4. Zu erwähnen ist aber noch, daß alle diese niederen Krebse im Rückenteile einen Hohlraum (Br) besitzen, welcher zur Aufnahme der Eier (E) dient und worin die ausgeschlüpften Embryonen so lange verweilen, bis sie sich vollständig entwickelt haben.
Fig. 6: Bosmina gibbera.
Der in Fig. 6 dargestellte Rüsselkrebs (''Bosmina gibbera'') ist dadurch merkwürdig, daß bei ihm die steifen Vorderfühler außerordentlich lang sind und daß die Schale am Rücken höckerartig aufgetrieben ist, wodurch eine auffällige und groteske Körperform entsteht. Der großen Schalenhöhle entsprechend, ist auch der Brutraum bei dieser Art sehr geräumig und geeignet, eine beträchtliche Anzahl von Eiern aufzunehmen. Ich fand den Buckelkrebs recht zahlreich im Plankton westpreußischer Seen vor, wogegen er in den größeren Gewässern Holsteins, die in ihrer sonstigen Fauna mit jenen übereinstimmen, selten vorzukommen scheint. In Schweden, Norwegen und Finnland soll die nämliche Art von besonderer Häufigkeit sein.
Fig. 7: Bosmina coregoni.
In Fig. 7 ist ein anderer (ziemlich häufiger) Rüsselkrebs auf mikrophotographischem Wege veranschaulicht und sehr naturgetreu dargestellt. Es ist die in norddeutschen Seen überall vorkommende ''Bosmina corregoni''.
Fig. 8: Leptodora hyalina.
Fig. 8 veranschaulicht uns das größte der planktonischen Krebstiere, welches ein Riese unter seinesgleichen ist und in unseren deutschen Gewässern eine Länge von 10 bis 12 mm erreicht. Sein zoologischer Name ist ''Leptodora hyalina'', was ins deutsche übersetzt "durchsichtiges Dünnfell" heißen würde. 1844 wurde dieses prächtige Geschöpf von den Bremer Naturforschern Kindt und Focke in dem seichten Stadtgraben der alten Hansestadt entdeckt. Später stellte es sich heraus, daß ''Leptodora'' eine hauptsächliche Bewohnerin aller größeren Landseen ist, und daß sie auch in der Neuen Welt (Nordamerika) in stattlichen Exemplaren von 18 bis 21 mm Länge vorkommt.
Fig. 9: Auge und Gehirnknoten von Leptodora hyalina.
Schon bei Lupenvergrößerung gewährt dieses glashelle, dünnhäutige Tier einen höchst anziehenden Anblick. In dem langen schnabelförmigen Kopfe liegt vorn das Auge (Au), welches aus einer schwarzen, dem Gehirn aufsitzenden Kugel besteht, die auf ihrer ganzen Oberfläche mit lichbrechenden Kristallkegeln besetzt ist. Wir dürfen hieraus schließen, daß dieser Krebs nach allen Seiten hin gleichzeitig zu sehen vermag. Dicht hinter dem Auge liegt das "Gehirn" in Form eines ansehnlichen Ganglienknotens, und bei H befindet sich das lebhaft pulsierende Herz. Blutgefäße sind bei allen diesen niederen Krebsgattungen nicht vorhanden, sondern die farblose Flüssigkeit erfüllt die ganze Leibeshöhle und umspült alle inneren Teile unmittelbar. Sie wird aber, wie bei den höheren Tieren, durch ein besonderes Pumpwerk (Herz) in Bewegung gesetzt. Bei Oe sehen wir die Speiseröhre, welche nach links hin zum Mund führt, während sie in der Mitte des Hinterleibes mit dem sogenannten Magendarm in Verbindung tritt. Die blasenförmige Auftreibung am Rücken (dicht hinter dem Herzen H) ist der Brutraum, worin- wie bei den verwandten kleineren Formen- die entwicklungsreifen Eier ihren Platz finden. Den gesamten Bau dieses interessanten Planktonwesens kann man sich ohne jede Präparation zur Anschauung bringen, weil dasselbe vollkommen durchsichtig ist. Die meist zentimeterlangen Tierchen sind so glashell und farblos, daß man deren Anwesenheit in ihrem Wohnelement nur an den tiefschwarzen Augen zu erkennen vermag, welche sich ruckweise hin und her bewegen. Die Umrisse des zarten Körpers bleiben gänzlich unsichtbar, und dessen Dasein verrät sich lediglich dadurch, daß die mächtigen Ruderarme allerlei kleine Partikelchen, die das Wasser verunreinigen, zur Seite stoßen. In der beigegebenen Figur sind diese Lokomotionsorgane nach oben und vorn gerichtet, so daß wir deren elegante Befiederung deutlich zu Gesicht bekommen. ''Leptodora'' ist übrigens ein sehr gefräßiges und räuberisches Geschöpf, welches unablässig Jagd auf kleinere Kruster macht. Die von den scharfen Kauzangen zermalmten Opfer gelangen dann durch den langen engen Schlund (Oe) in den gestreckten röhrenförmigen Magen (Mg), dessen Inhalt meist gelblich gefärbt ist.
An ''Leptodora'' ist in meiner Station zu Plön von W. Gerschler neuerdings (1910) die interessante Beobachtung gemacht worden, daß im ersten Beinpaare dieses Krebses noch ein besonderes Organ zur Förderung der Blutzirkulation vorhanden ist. Es besteht aus einem Muskelband, welches von der Innenseite der Extremität aus frei deren Hohlraum durchsetzt und an ein feines Häutchen von kreisförmiger Gestalt herantritt. Diese eigenartige Organ, welches ununterbrochen rasche Pulsationen ausführt, ist bei beiden Geschlechtern von ''Leptodora'' zu konstatieren. Seiner Funktion nach ist es gleichsam ein zweites Herz, dem die Aufgabe zugefallen ist, das in den langen dünnen Beinen leicht ins Stocken geratende (farblose) Blut in seiner fließenden Bewegung zu unterstützen. Da das an der Rückenseite gelegene eigentliche Herz von ''Leptodora'' (Fig. 7, H) im Verhältnis zur Körpergröße dieses Krebses ziemlich klein ist, so erscheint es als eine sehr zweckmäßige Veranstaltung der Natur, daß in diesem Falle noch eine kleine (supplementäre) Pumpstation innerhalb des ersten Beinpaares existiert.
Fig. 10: Bythotrephes longimanus.
Ein nicht minder eigenartig aussehender Bewohner unserer tiefgründigen Binnenseen ist der in Fig. 10 abgebildete ''Bythotrephes longimanus'', der bereits 1857 von dem bekannten Biologen Fr. v. Leydig im Bodensee entdeckt, aber erst viel später als ein typisches Mitglied der Seenfauna erkannt wurde.
Eine deutsche Bezeichnung für diesen Krebs ausfindig zu machen, ist schwer. Am zutreffendsten nennen wir ihn wohl den langarmigen Tiefschwimmer, weil er mit Vorliebe in den von der Oberfläche weit entfernten und daher nur schwach vom Tageslicht getroffenen Wasserschichten sich aufzuhalten pflegt. Ohne den enormen Schwanzstachel hat dieses Tier bloß eine Länge von 12 bis 14 mm. Unsere Abbildung dieses abenteuerlich sich ausnehmenden Krebses wird jedem Leser sofort verständlich sein. Wie bei ''Leptodora'', so sehen wir den Kopf auch hier fast ganz ausgefüllt von dem schönen, mit Kristallstäbchen besetzten Auge, und dicht hinter diesem befindet sich der Gehirnknoten. Auf der Grenze von Hinterkopf und Brustteil stehen die großen, zweiästigen Ruderfühler, welche in ihrer kräftigen Entwicklung und Befiederung gleichfalls an ''Leptodora hyalina''erinnern. Eigentümlich aber präsentiert sich das erste Paar der Schwimmfüße, welches eine auffällige Länge besitzt. Daher auch die treffende Artbezeichnung "longimanus". Der Brutsack auf dem Rücken des Tieres ist bei dem in unserer Figur dargestellten Exemplar noch klein und enthält nur ein einziges Ei. Bei völlig erwachsenen Weibchen sind aber meist 4 bis 5 Eier vorzufinden; ich habe übrigens auch schon Muttertiere aus dem großen Plöner See gefischt, welche 6 bis 8 Eier bei sich trugen.
Gegen den Spätsommer hin zeigt sich bei diesen Spezies ganz allgemein eine in Tüpfeln angeordnete ultramarinblaue Färbung, die namentlich in der Nähe des Mundes und an den Füßen auftritt. Der lange Hinterleibsstachel scheint dem Tiere als Balancierstange beim Schwimmen zu dienen, damit es nicht nach vorn überkippt. Es wäre aber auch möglich, daß jenes Anhängsel nur den Zweck hätte, die Körperoberfläche zu vergrößern, um so den Formwiderstand zu erhöhen, was gleichbedeutend mit einer Steigerung der Schwebfähigkeit ist, worauf die Natur bei allen planktonischen Tier- und Pflanzenformen, soweit wir das beurteilen können, hinzuwirken scheint.
Es ist von besonderem Interesse, hier noch in Erwähnung zu bringen, daß ''Bythotrephes'' ganz zufällig dadurch entdeckt wurde, daß Prof. v. Leydig auf den Gedanken kam, zu untersuchen, was wohl die Nahrung der Blaufelchen im Bodensee bilde. Es war im Septembermonat 1857, als der genannte Forscher eine große Menge von diesen geschätzten Fischen hinsichtlich ihres Mageninhalts prüfte und dabei wahrnahm, das letzterer fast ganz ausschließlich aus einer ihm bis dahin unbekannt gewesenen Krebssorte bestehe, die durch einen langen Hinterleibsstiel, kräftige Ruderarme und ein erstes Paar langer Schwimmbeine charakterisiert ist. Die Menge dieser Tierchen erwies sich als staunenswert groß, und offenbar mußten dieselben massenhaft im Bodensee vorhanden sein. Weil nun jene Fische ihren Aufenthaltsort hauptsächlich in der Tiefe haben und nur sehr selten in den oberflächlichen Wasserschichten zu finden sind, so schloß Prof. v. Leydig aus diesem Umstande mit Recht, daß auch der betreffende abenteuerlich aussehende Krebs vorzugsweise bloß in den unteren Regionen des Sees vorfindlich sein werde, und demgemäß nannte er ihn "Tiefseenahrung", was im Hinblick auf die hervorragende Rolle, die derselbe bei der Ernährung der Felchen zu spielen schien, eine sehr passende Bezeichnung war.
Außer den bisher aufgezählten und geschilderten Krustazeen, die mit noch vielen anderen verwandten Spezies zusammen die Familie der ''Cladocera'' bilden, kommen in unseren Seen und Teichen auch noch die sogenannten "Hüpferlinge" oder Kopepoden vor. Diese besitzen langgestreckte Körper, ein breites Kopfbruststück (Cephalothorax), welches aus mehreren Segmenten besteht, und einen schlanken gleichfalls aus Ringen gebildeten Hinterleib mit gabelförmigen Endstück (Furca). Als Ruderwerkzeuge sind zwei lange Fühler vorhanden, welche mit zahlreichen kleinen Borsten besetzt sind. Zu diesen kommen noch fünf Beinpaare, wovon das hintersteverkümmert oder (wie bei den Männchen der Calaniden) rechtsseitig zu einem Greiforgan umgewandelt ist.
Wir unterscheiden bei den Kopepoden drei Familien: die Cyclopiden, die Calaniden und die Harpacticiden. Für das Plankton kommen aber nur die beiden ersteren in Betracht. Ausnahmslos sind die Süßwasser-Kopepoden mit einem einzigen Auge ausgestattet, und dieser Umstand hat der artenreichen Gattung ''Cyclops''zu ihrem Namen verholfen. Der einäugige Schmiedeknecht Vulkans ist in dieser Bezeichnung auch von seiten der Wissenschaft verewigt worden. In der Familie der Calaniden unterscheiden sich diejenigender Cyclopiden hauptsächlich durch zwei augenfällige Merkmale: durch den kleinen, gedrungenen Körperbau und durch die kürzeren Ruder-Antennen. Während die letzteren bei den Vertretern der Gattung ''Cyclops'' 8 bis 17 Glieder besitzen, erreichen sie bei den Calaniden die Anzahl von 25. Auch tragen die Cyclopsweibchen ihre Eier in zwei divergent vom Hinterleib abstehenden Säckchen, wogegen die weiblichen Calaniden nur ein einziges solches besitzen, welches an der Unterseite des Hinterleibes zur Befestigung gelangt.
Fig. 11: Diaptomus graciloides.
Ihre bedeutungsvollste Vertretung hat die Calanidengruppe in der Gattung ''Diaptomus'' (Fig. 11), wovon es mehr als 60 Arten gibt. Die Genera ''Heterocope'' und ''Eurytemora'' bleiben dagegen sehr zurück. Der umstehend abgebildete ''D. graciloides'' Sars. ist ein Hauptbestandteil des Planktons in den norddeutschen Seebecken. Wie alle übrigen Repräsentanten seiner Sippe, so ist auch er ein virtuoser Schwimmer. Die blitzartig schnelle Fortbewegung im Wasser geschieht ausschließlich durch die muskelkräftigen Ruderfühler, während das weit seltener zu beobachtende langsamere Fortgleiten des Tierchens durch das vibrierende Spiel der Mundwerkzeuge bewirkt wird, dessen Zweck gleichzeitig die Herbeiführung von Nahrungskörperchen ist. Zu letzteren gehören namentlich die zahlreichen planktonischen Kieselalgen (Diatomeen), und von diesen sind es wieder die kleinen rundlichen Formen (Cyclotellen), welche eine Lieblingsspeise der Diaptomiden und Cyclopiden bilden. Es ist mir schon vor Jahren gelungen, an stark aufgehellten Präparaten von Diaptomus- und Cyclops-Exemplaren die zierlichen Schalen solcher Algen (und deren Fragmente) durch direkte mikroskopische Beobachtung im Darmkanal jener Tierchen nachzuweisen. Im Gegensatz zu den Kopepoden leben die Daphniden und Bosminiden des Planktons vorwiegend von frischen und absterbenden Grünalgen, oder wenn sie diese nicht haben können, von den in Verwesung übergegangenen Resten der niederen und höheren Wasserflora, die sich als sogenannter "Mulm" am Grunde von größeren Seebecken ablagern. Der oft tiefschwarz gefärbte Darminhalt der Bosminiden zeigt unwidersprechlich an, daß diese winzigen Krebse zuweilen auch in der Tiefe auf Nahrungserwerb ausgehen und dort noch alles für den Aufbau ihres Körpers Verwertbare sich einverleiben.
Wenn man die kleinen, eiförmigen Kotballen der Cyclopidenund Calaniden vorsichtig auf dem Objektträger durch seitliche Verschiebung des Deckglases (und unter Anwendung eines leichten Druckes) in einer Ebene ausbreitet, so entdeckt man bei der mikroskopischen Untersuchung derselben zwischen den verfilzten Resten der Fadenalgen eine außerordentlich große Menge von Diatomeenpanzern. Nach einer Analyse des Kieler Zoologen E. Brandt [Vgl. G. Karsten: Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen in der Kieler Bucht. 1899.] besteht der Protoplasmakörper der Diatomeen zu 28,7 % aus Eiweiß, zu 63,2 % aus Kohlehydraten und zu 8 % aus Fetten. Es erklärt sich aus diesem chemischen Befunde ihre große Geeignetheit für die Ernährung niederer Tierwesen. Meine Erfahrungen darüber, daß sich die Kopepoden mit Vorliebe von Diatomeen ernähren, habe ich nicht bloß am Plöner See und dessen Nachbarbecken gemacht, sondern auch an Krustazeenmaterial, welches den mecklenburgischen, pommerschen und westpreußischen Seen entstammt. Überall zeigte sich das gleiche Verhalten. Zerdrückt man in vorsichtiger Weise einen lebenden Cyclops oder Diaptomus und sieht sich den Darminhalt desselben bei stärkerer Vergrößerung näher an, so scheint es, als ob die darin vorfindlichen Kieselalgen meistenteils solche seien, die in schon abgestorbenen Zustande aufgenommen wurden. Man kann dies mit großer Wahrscheinlichkeit aus deren stark verfärbten und nicht mehr goldigfrisch aussehenden Chromatophoren (Farbstoffplatten) schließen. Danach würde man sich die Ansicht bilden können, daß die genannten Krebse im Naturhaushalte unserer Binnenseen das Amt übertragen erhalten hätten, die sonst für die Ernährung der Fauna völlig verloren gehenden, absterbenden Diatomeen wieder in den Kreislauf der Stoffwanderung zu bringen, der sie sonst durch ihr allmählich stattfindendes Niedersinken auf den Grund endgültig entzogen werden würden. Die winzigen Larven der Kopepoden (die Nauplien) nehmen jedoch, nach meiner Beobachtung, niemals Kieselalgen als Nahrung auf, wohl aber die kleinsten grünen Pflanzenwesen des Planktons im frischen Zustande. Sind in irgendeinem See solche Algenspezies einigermaßen häufig vorhanden, so wird man stets im Innern des Magendarms der Kopepodenlarven vegetabilische Zellindividuen verschiedenster Art konstatieren können.
Hinsichtlich der planktonischen Cladoceren (Hyalodaphnia, Daphnella, Bosmina) wurde bereits erwähnt, daß für sie die kleinen grünen Schwebalgen ebenfalls eine ergiebige Nahrungsquelle bilden. Genaue Darminhaltsanalysen haben auch bezüglich dieser Krustazeengattungen die Tatsache ergeben, daß sie hauptsächlich nur vegetabilische Objekte zu sich nehmen. Es verrät sich diese Ernährungsweise schon gleich durch die hellgrüne Färbung des gesamten Darmkontentums, welche immer dann am auffälligsten bei allen Individuen der obengenannten Krebstiergruppe ist, wenn gerade solche Algen in großer Menge den betreffenden See bevölkern. Doch kommen gelegentlich auch Diatomeensplitter in den ausgestoßenen Fäkalien von Cladoceren vor, machen aber durch den geringen Prozentsatz ihrer Anwesenheit nicht den Eindruck, als ob sie besonders gern aufgenommene Nahrungsgegenstände seien. Sehr wahrscheinlich sind sie mehr zufällig mit eingeschluckte Beimischungen, auf deren Erbeutung bei der Nahrungsaufnahme es gar nicht ausdrücklich abgesehen war. Was das Richtige ist, läßt sich schwer entscheiden; zunächst können wir aber den Befund, wie er uns vor Augen liegt, nicht anders deuten.
Des kohlschwarzen Darminhalts, der zu manchen Zeiten bei Bosminen zu beobachten ist, wurde bereits gedacht. Einen ähnlich dunklen Futterbrei finden wir häufig auch bei dem gewöhnlichen Wasserfloh der größeren Pfützen und Viehtränken (''Daphnia pulex'') und bei anderen schlecht schwimmenden Cladoceren, welche nur die kleineren Wasseransammlungen (aber dann massenhaft) bewohnen. Hier ist der Tatbestand so zu erklären, daß diese Krebse in ihren Heimatstätten meist nur wenige flottierende Grünalgen und fast gar keine Diatomeen antreffen, so daß sie genötigt sind, ihren Hunger mittels der auf dem Grunde sich absetzenden, halb vermoderten organischen Reste zu stillen, die fast stets von tiefbrauner oder schwärzlicher Färbung- infolge ihrer langsamen Verkohlung unter Wasser- sind.
Im Anschluß hieran wäre wohl auch noch ein Wort in betreff der in der Fischereiwirtschaft üblichen Teichdüngung zu sagen, welche erfahrungsgemäß dazu beiträgt, daß sich die kleinen Krebstiere, welche bekanntermaßen das Naturfutter der heranwachsenden jungen Fische bilden, in den zu Zwecken der Fischzucht aufgestauten Gewässern lebhaft vermehren. Dies ist eine Tatsache, welche von niemand mehr bestritten wird, und sie findet ihre natürliche Erklärung durch den Umstand, daß die von den höheren Organismen ausgeschiedenen Fäkalmassen (also der Dung von Schweinen, Rindern, Pferden und Menschen) noch eine Fülle von Nahrungsstoffen in halbverdauter und der weiteren Zersetzung im Wasser leicht zugänglicher Form enthalten, welche von der niederen Fauna, insbesondere von den Krustern des Teichplanktons leicht aufgenommen und assimiliert werden können. In ähnlicher Weise wirkt auch die Gründüngung der Teichböden, indem man letztere während der Sömmerung (d.h. Trockenlage) mit einer schnell wachsenden Vegetation sich bedecken läßt, welche dann vor der neuen Bespannung direkt untergepflügt wird. Nicht minder ist es angängig, durch eingestreutes Blut- oder Kadavermehl der Produktion zahlreicher planktonischer Krustazeen Vorschub zu leisten. Hierauf beruhen die in der neuzeitlichen Teichwirtschaft vielfach vorgenommenen Meliorationen, welche in rationellster Weise zuerst von dem berühmten Reformator der böhmischen Karpfenzucht Domänendirektor Josef Susta zu Wittingau in die Praxis eingeführt und zum Teil auch schon damals wissenschaftlich begründet wurden.
Bei manchen großen Seebecken dürften auch die zahlreich daselbst vorkommenden Möwen mit zu den Nahrungsquellen der mikroskopischen Wassertiere zu rechnen sein, insofern diese Vögel ihren Kot während des Umherfliegens doch meist ins Wasser fallen lassen. Wenn man nun bedenkt, daß auf den Inseln mancher Landseen 10000 bis 20000 Stück von Möwen (''Larus ridibundus'') nisten, so ist die Fäkalienproduktion derselben während des Jahreslaufs gewiß nicht gering anzuschlagen. Der Cunitzer See bei Liegnitz in Schlesien ist äußerst reich an Möwen, und man schätzt dieselben dort auf 12000 bis 15000 Individuen. Es ist darum nicht zu bezweifeln, daß der Plankton- und Fischreichtum dieses weit und breit geschätzten Gewässers mit auf Rechnung der so zahlreich dort vorfindlichen Wasservögel zu setzen ist.
In neuerer Zeit (1909) ist von einem angesehenen Forscher (A. Pütter) der Beweis zu führen versucht worden, daß die Wassertiere sich nur zum kleinsten Teile von festen Stoffen ernähren und daß das Hauptquantum ihrer Nahrung in den gelösten chemischen Verbindungen bestehe, welche in jedem Gewässer anzutreffen sind. Spezielle Untersuchungen haben ergeben, daß etwa 10 bis 20 Milligramm solcher Verbindungen pro Liter in unseren Teichen und Seebecken vorhanden sind. Hieraus würde sich dann erklären, daß- wie Knörrich schon 1901 gezeigt hat- Daphnien bei Ausschluß aller geformten Nahrung am Leben erhalten werden und sich fortpflanzen können. Nicht minder ist von Krätschmar (1908) festgestellt worden, daß gewisse Rädertiere (''Anuraea aculeata'') bei völlig mangelnder Speisung mit Algen doch am Leben blieben und sogar Eier produzierten. Solche Befunde bleiben vollkommen rätselhaft, wenn man nicht annimmt, daß derartige Wesen sich von im Wasser gelösten Substanzen ernähren. Hiernach können wir also sagen, daß eine sehr große Wahrscheinlichkeit für die Püttersche Theorie vorliegt; immerhin muß aber noch der einwandfreie Beweis geführt werden, daß die Tatsachen, auf welche der Göttinger Forscher sich stützt, unanfechtbar richtig sind. Pütter faßt in seiner Aufsehen erregende Publikation [A. Pütter: Die Ernährung der Wassertiere und der Stoffhaushalt der Gewässer. 1909. S. 147] das, worum es sich bei seinen Forschungen handelt, in folgendem Satze zusammen: „Die Ernährung eines großen Teils der Formen aller Stämme (von Wassertieren) vollzieht sich nicht in der Weise, wie man es bisher in grober Analogie mit den Säugetieren und Vögeln annahm: d.h. daß geformte Nahrung aufgenommen, durch die Verdauung gelöst und gespalten und in diesem Zustande resorbiert wird, sondern eine große Anzahl von Tieren speziell die absolut kleinen Formen aller Stämme nehmen, soweit sie im Wasser leben, ihre Nahrung direkt in gelöster Form auf.“
Für die hydrobiologische Wissenschaft ist es selbstredend vom aktuellsten Interesse, auf dem Wege des Experiments dahinter zu kommen, ob eine Ernährung dieser Art bei der Mehrzahl der im Wasser lebenden Tiere wirklich stattfindet, und welche Arten von Meeres- oder Süßwasserbewohnern es sind, die in ihrem Verhalten weitere Strützpunkte für die neue Lehre darbieten.