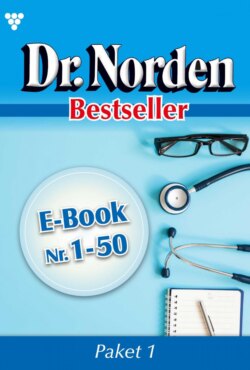Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 1 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDr. Daniel Norden legte nach einem kurzen Gespräch den Telefonhörer auf und wandte sich seinem Patienten zu.
»Ich bin zu einem dringenden Fall gerufen worden, Herr Ackermann. Sind Sie einverstanden, dass wir die Blutsenkung übermorgen machen?«
»Aber sicher, Herr Doktor. Ich habe ja Zeit.«
Der alte Herr zwinkerte freundlich. Er war immer freundlich, trotz seines schmerzhaften Leidens. Daniel Norden mochte ihn sehr.
Er sagte schnell seiner Frau Fee Bescheid, die im Labor Röntgenaufnahmen auswertete.
»Ich muss zu Detloff, Fee. Er hat wieder einen schweren Herzanfall. Kannst du die Stellung allein halten? Das hier hat Zeit.«
»Ich werde mir Mühe geben, den Herrn Doktor zu ersetzen«, erwiderte Fee mit einem bezaubernden Lächeln, bekam einen zärtlichen Kuss und begab sich ins Sprechzimmer.
Helga Moll, die Sprechstundenhilfe, war heute auch nicht da. Sie hatte eine so schwere Erkältung, dass sie von ihrem Chef ein paar Tage Bettruhe verordnet bekommen hatte.
Es war Grippezeit, und so kamen weniger Patienten in die Sprechstunde. Dafür aber mussten mehr Hausbesuche gemacht werden.
Wenn es jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm war wie am Anfang, als Fee als junge Ehefrau mit in die Praxis ihres Mannes eingestiegen war, gab es doch immer noch Patienten, vor allem Patientinnen, die nur von Dr. Norden behandelt werden wollten.
Dr. Daniel Norden war inzwischen eilends zu dem Haus des Bankiers Gottfried Detloff gefahren, der einer seiner schwierigsten und ungeduldigsten Patienten war und in keiner Weise seinem Vornamen Ehre machte.
Friedlich war er nie, und gottergeben würde er nie werden. Fluchen konnte er wie ein Stallknecht, aber heute war ihm das vergangen. Er lag still und blass in seinem Bett, und als Dr. Norden sich über ihn beugte, fürchtete er das Schlimmste.
Margit Detloff, die einzige und maßlos verwöhnte Tochter des Bankiers, hatte Dr. Norden selbst eingelassen.
Der kritischen Situation ungeachtet, die diesen Arztbesuch nötig machte, verschwendete sie lockende Blicke an den blendend aussehenden Arzt, aber es war eine wirkliche Verschwendung, denn Daniel Norden sah darüber hinweg.
Allen Grobheiten zum Trotz, die er von Gottfried Detloff schon hatte einstecken müssen, konnte er diesem Mann nicht böse sein. Er war die Aufrichtigkeit in Person und genoss in seinen Kreisen einen ausgezeichneten Ruf. Seit sechs Monaten war er bei Dr. Norden in Behandlung, und Daniel war der Überzeugung gewesen, dass sich sein Herzleiden im Rahmen halten ließe, wenn er sich mehr schonen würde. An solche Ratschläge hatte sich der Bankier auch gehalten, und dieser Anfall kam Dr. Norden völlig überraschend.
Er gab dem Patienten eine Spritze, fühlte den Puls und beobachtete ihn. Margit Detloff stand hinter ihm, und sie beobachtete den Arzt.
»Es wäre besser, wenn wir Ihren Vater in die Klinik brächten«, sagte Dr. Norden.
»Sobald es ihm wieder bessergeht, wird er uns ins Gesicht springen, wenn wir das täten«, sagte Margit.
Ihre Stimme klang merkwürdig gleichmütig.
»Ist dieser Anfall durch eine Aufregung ausgelöst worden?«, fragte Daniel.
»Was weiß ich«, meinte Margit mit leichtem Kopfschütteln. »Er kam überraschend früh heim, blubberte vor sich hin, führte ein Telefongespräch, bei dem er ziemlich brüllte, aber das sind wir ja gewohnt, und dann wankte er in sein Zimmer. Ich hinterher, und als ich merkte, dass er wieder einen Anfall bekam, gab ich ihm seine Tropfen.«
»Die richtige Dosis?«, fragte Daniel.
Margit kniff die Augen zusammen. »Natürlich. Wollen Sie mir eine Schuld zuschieben?«
»Keinesfalls, nur können ein paar Tropfen zuviel bei Aufregung schädlich sein.«
»Ich habe ihm in der Aufregung eher zu wenig gegeben und Sie dann gleich angerufen«, sagte Margit ironisch.
Wie eine liebevoll besorgte Tochter redete sie nicht gerade, und dabei sprach man doch davon, dass sie ihres Vaters Augapfel sei.
Margit Detloff war unzweifelhaft ein attraktives Mädchen, aber sie hatte nicht die geringste Ausstrahlung von Wärme. Vielleicht mochte sie auf manche Männer sexy wirken, doch darüber machte Dr. Norden sich keine Gedanken, und ihm fehlte dafür auch das Verständnis.
Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Patienten zu, der jetzt leise stöhnte. Ganz dicht beugte er sich zu ihm herab.
»Können Sie mich verstehen, Herr Detloff?«, fragte er. »Ich bin es, Dr. Norden. Ihr Zustand macht die Einweisung in eine Klinik erforderlich. Sind Sie einverstanden?«
Er hatte das schnell gesagt, da er merkte, dass seine Stimme das Bewusstsein des Mannes erreichte, wenn er auch die Augen fest geschlossen hielt.
»Ja«, erwiderte Gottfried Detloff kaum vernehmbar, »Klinik.«
Dr. Norden war überrascht, aber Margit auch.
»Hast du auch richtig verstanden, Papa?«, fragte sie schrill. »Du sollst in die Klinik.«
Ein Zucken lief über das breite Gesicht des Kranken.
»Ja«, sagte er nochmals.
»Bitte, regen Sie Ihren Vater jetzt nicht auf«, wies Dr. Norden die junge Dame ziemlich scharf zurecht. »Rufen Sie bitte diese Nummer an, und bestellen Sie einen Krankenwagen.«
Ein flammender Blick traf ihn, aus dem er eine Regung von Hass hätte lesen können, wenn er sich Gedanken darüber gemacht hätte. Aber seine Gedanken waren bei dem Kranken, von dem er in jeder Situation Protest gewohnt war.
Margit Detloff verließ das Zimmer, wenig später erschien der Butler, ein älterer ruhiger Mann. Dr. Norden kannte ihn. Er hieß Jonathan und machte jetzt einen sehr verstörten Eindruck.
»Ich möchte mit der Behnisch-Klinik telefonieren, Jonathan«, sagte Dr. Norden.
Der Mann nickte. Seine Lippen zitterten so stark, dass er kein Wort hervorbrachte.
Margit hielt den Hörer noch in der Hand, als Dr. Norden aus dem Zimmer trat.
»Ich habe Ihren Befehl ausgeführt«, sagte sie mit klirrender Stimme. »Sie sind sich anscheinend nicht bewusst, was Sie meinem Vater antun.«
»Ich habe seine Zustimmung, und es ist zu seinem Besten«, erwiderte Dr. Norden ruhig.
Dann rief er die Klinik an und ließ sich mit seinem Freund Dr. Behnisch verbinden. Er wusste, dass er von Dieter Behnisch in diesem dringenden Fall keine Absage bekommen würde.
Kaum hatte er das Gespräch beendet, kam auch schon der Krankenwagen. Ohne Widerspruch ließ Gottfried Detloff sich abtransportieren.
*
Dr. Felicitas Norden hatte inzwischen alle Patienten versorgt, doch da schlug der Gong nochmals an.
Sie meinte, dass ihr Mann zurückkommen würde, aber es trat ein anderer ein.
»Schönste aller Ärztinnen, wie
hübsch, von Ihnen persönlich empfangen zu werden«, begrüßte er Fee.
Sie kannte ihn recht gut, diesen Harald Johanson. Ein richtiger Playboy, aber mit so viel Charme, dass man ihm einfach nicht böse sein konnte.
Er war ein Sportsmann und das erste Mal in die Praxis gekommen, als er vom Pferd gestürzt war. Außer ein paar Hautabschürfungen hatte er damals keine Verletzungen davongetragen, aber seither kam er immer, wenn ihm etwas fehlte. Mal war es eine Zerrung, dann auch mal ein blaues Auge, eine verstauchte Hand, oder er brauchte eine Nachimpfung, weil er zu irgendeiner Safari reisen wollte.
Er konnte es sich leisten. Er war der Alleinerbe eines mächtigen Konzerns.
Nach Fees Meinung ein Luftikus, aber einer, den man dennoch gut leiden konnte. Sie erinnerte sich plötzlich, dass er auf Empfehlung des Bankiers Detloff zu ihnen gekommen war, und dass man von einer Heirat mit dessen Tochter Margit munkelte.
»Wo fehlt es denn heute?«, fragte sie lässig.
»Ich habe meinen Impfpass verkramt«, erwiderte er. »Und da ich
am Wochenende nach Afrika starten will …« Er grinste jungenhaft.
»Obgleich Herr Detloff einen schweren Herzanfall hat?«, fragte Fee.
Sein Gesicht wurde ernst. »Wieso? Gestern war er doch in bester Form. Was ist los, ma belle?«
»Lassen Sie das meinen Mann nicht hören, sonst kündigt er Ihnen die Freundschaft«, sagte Fee. »Daniel wurde dringend zu Herrn Detloff gerufen und ist noch bei ihm.«
Harald Johanson sah sie nachdenklich an. Er wirkte seltsam ernst, und Fee verstand jetzt, dass Daniel tatsächlich etwas für ihn übrig hatte.
»Ich wusste nicht, dass er wirklich leidend ist«, sagte er. »Choleriker haben ja manchmal schlechte Tage.«
»Ich werde Ihnen einen neuen Impfpass ausstellen«, sagte Fee in das Schweigen hinein, das seinen Worten folgte.
Er schien es nicht zu hören. Sein Blick schweifte zum Fenster hinaus. Auf seiner Stirn stand eine steile Falte. Er sah plötzlich sehr männlich aus, fast hart.
Überrascht betrachtete ihn Fee. »Vielleicht möchten Sie jetzt zu Fräulein Detloff fahren«, sagte sie leise.
»Nein, das möchte ich nicht!«, stieß er hervor, sich das Haar aus der Stirn streichend. »Wenn Sie gestatten, würde ich gern auf Ihren Mann warten.«
Eigentlich hatte Fee die Praxis zumachen wollen, um hinauf in die Wohnung zu fahren, aber sie brachte es nicht fertig, ihn fortzuschicken. Sollte er warten, sie konnte in der Zeit die Röntgenaufnahmen auswerten.
Sie hatte den Impfpass ausgestellt, als Daniel schon kam. Er war sichtlich erstaunt, Harald Johanson hier vorzufinden, und ganz frei von Eifersucht war der Blick nicht, den er auf seine Frau richtete.
Schnell erklärte ihm Fee, mit welchem Anliegen Harald gekommen war, und der warf ein: »Dann hörte ich von Ihrer Frau, dass Herr Detloff einen Herzanfall hatte, und wollte mich gern vergewissern, wie es ihm geht.«
»Nicht gut«, erwiderte Daniel. »Er wird jetzt ständig beobachtet.«
»Er hat nicht protestiert, dass er in die Klinik gebracht wurde?«
»Nein, ich konnte ihn selbstverständlich nicht gegen seinen Willen einweisen«, erklärte Daniel.
»Wie hat es Margit aufgenommen?«, fragte Harald.
»Recht gelassen«, erwiderte Dr. Norden ironisch.
Mit einem eigentümlichen Blick sah Harald ihn an. »Besteht Lebensgefahr?«, fragte er heiser.
»Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Die nächsten Stunden werden es entscheiden. Gefahr besteht immer, wenn man ein krankes Herz hat.«
»Dann kann ich nur hoffen, dass ich nicht unabsichtlich der Anlass war«, sagte Harald dumpf.
»Wieso Sie? Hatten Sie eine Auseinandersetzung mit ihm am heutigen Vormittag?«, fragte Daniel.
»Nein, das nicht, aber eigentlich sollte meine Verlobung mit Margit verkündet und am Wochenende gefeiert werden, und ich habe Platzangst bekommen. Ich konnte einfach nicht anders. Ich liebe meine Freiheit zu sehr. Herr Detloff hat es allerdings sehr gelassen aufgenommen, als ich es ihm gestern Abend mitteilte.«
»Ich will nicht indiskret sein, aber hat Fräulein Detloff Ihre Entscheidung auch gelassen aufgenommen?«, fragte Daniel, während Fee Harald aufmerksam betrachtete.
Er runzelte die Stirn. »Es gibt jedenfalls gute Gründe, die ihr eine gewisse Zurückhaltung auferlegen«, erwiderte er ausweichend. »Ich glaube nicht, dass ich mir einen Vorwurf machen muss, oder sie mir einen machen könnte.«
Das war eine Erklärung, die so ziemlich alles offenließ, und über die man nachdenken konnte.
Harald erkundigte sich dann noch, in welche Klinik Gottfried Detloff gebracht worden war und verabschiedete sich als vollkommener Gentleman.
»Merkwürdig«, sagte Fee, »er war mir direkt sympathisch.«
»Aber nicht zu sehr, mein Schatz«, sagte Daniel sogleich. »Lenchen wird warten«, fügte er dann schnell hinzu.
Sie fuhren nach oben. Ihre Wohnung befand sich in einem Penthouse auf dem Dach desselben Hauses. Das leider ziemlich schwerhörige Lenchen wartete bereits und brummelte vor sich hin, dass man doch einmal pünktlich essen könne.
»Mit der Heirat scheint es also nichts zu werden«, bemerkte Fee beiläufig. »Ich möchte gern wissen, was der tiefere Grund ist.«
»Vielleicht ihre eiskalten Augen«, sagte Daniel leichthin. »Da erstarren alle Gefühle.«
»Ich kenne sie nicht«, sagte Fee.
»Sei froh«, erwiderte Daniel lakonisch. »Du hast nichts versäumt. Aber es kann durchaus sein, dass sie ihrem Vater Theater gemacht hat, weil die Verlobung platzt. Immerhin ist Johanson eine blendende Partie.«
»Sie haben doch selbst Geld genug«, stellte Fee fest.
»Aber einen Mann, der so gut aussieht und dazu noch gespickt ist, findet man nicht so rasch. Uns kann das egal sein, Fee. Ich möchte nur, dass Detloff wieder auf die Beine kommt. Er muss sich furchtbar aufgeregt haben, dass es zu diesem Zusammenbruch kommen konnte, aber in dieser Zeit wird es wohl auch bei ihm geschäftliche Sorgen geben.«
*
Harald Johanson war zur Behnisch-Klinik gefahren. Er hatte mit Dr. Jenny Lenz sprechen können, aber sie hatte ihm auch nur sehr vorsichtig Auskünfte gegeben. Was ihn jedoch bestürzte, war die Tatsache, dass Margit nicht in der Klinik weilte, auch wenn sie am Krankenbett ihres Vaters unerwünscht war, wie die Ärztin ihm zu verstehen gab.
Harald fuhr zu seiner Wohnung. Er hatte Wohnungen in verschiedenen Städten, von den komfortablen Besitzungen abgesehen, die ihm auch gehörten. Diese Wohnung war ihm jedoch die liebste. Er hatte sie ganz nach seinem Geschmack eingerichtet, und jeder, der sie kennenlernte, musste zugeben, dass Harald Johanson einen fantastischen Geschmack besaß.
Wer Harald genauer kannte, musste manche Eigenheiten an ihm feststellen, doch niemand hätte ihm zugetraut, dass Gottlieb Detloffs Erkrankung ihm so nahegehen könnte.
Grübelnd blickte er lange Zeit zum Fenster hinaus. Das Telefon läutete ein paar Mal, doch er meldete sich nicht.
Gestern hatte er ein langes und aufschlussreiches Gespräch mit Gottfried Detloff gehabt, das ihm manche Überraschung beschert und ihn sehr zum Nachdenken angeregt hatte.
Heute musste er über einige Bemerkungen noch intensiver nachdenken, und er versuchte, sich diese ganz genau in Erinnerung zu rufen.
Als er Detloff um die Unterredung gebeten hatte und vorschlug, dass sie sich in seinem Stammlokal treffen könnten, war der Ältere sofort einverstanden gewesen. Er hatte nicht einmal gefragt, warum Harald denn nicht zu ihnen kommen wolle.
Ja, diese Bereitwilligkeit hatte ihn in Erstaunen versetzt und es ihm auch erleichtert, ganz offen zu sprechen.
Harald Johanson rekonstruierte den Verlauf des Abends, indem er sich nun Notizen machte. Er schrieb in Stichworten auf, was ihm in der Erinnerung haften geblieben war, ohne sich selbst Rechenschaft darüber ablegen zu können, warum er das tat.
Über eine Stunde saß er so, und dann las er nochmals, was er sich notiert hatte.
20 Uhr Treffen in der Klause. Kamen fast gleichzeitig. D. bestellte sein Leibgericht: Rehschäuferl, hausgemachte Spätzle, Pfifferlinge und Preiselbeeren.
Harald schüttelte den Kopf. Als ob das wichtig wäre. Komisch, dass er es sich überhaupt gemerkt hatte, da die Unterredung doch so wichtig für ihn gewesen war und er sich durchaus nicht behaglich gefühlt hatte, bis er seine Gedanken dann ausgesprochen hatte. Dazu war es aber erst nach dem Essen gekommen.
»Nun, was haben Sie auf dem Herzen, Harald?«, hatte Detloff gefragt.
Mit sehr schlechtem Gewissen hatte er es ausgesprochen. »Es tut mir leid, aber ich möchte jetzt noch keine offizielle Verlobung.«
»Jetzt nicht oder überhaupt nicht?«, hatte Detloff ruhig gefragt.
»Ich fürchte, dass ich nicht zum Ehemann tauge«, hatte er erwidert.
»Das finde ich auch«, sagte Gottfried Detloff. »Margit muss nicht alles durchsetzen, was sie will. Es wird künftig sowieso einige Veränderungen bei uns geben.«
Harald stützte jetzt seine Hand auf und legte sein Kinn hinein. Er starrte auf den Bogen. Hatte es Detloff wirklich so gesagt, und welche Bedeutung konnte diese Erklärung haben?
Nein, gestern Abend hatte er darüber nicht nachgedacht. Er war nur froh gewesen, dass dieser cholerische Mann nicht aufbrauste, sondern verblüffend ruhig blieb.
Es wird einige Veränderungen geben! Hatte er finanzielle Verluste gehabt? Nein, das hätte sich doch schon herumgesprochen.
»Spielt da ein anderer Mann mit?«, hatte Detloff gefragt, so ganz beiläufig, als ginge es ihn gar nichts an.
Mehreres spielte mit, worüber sich Harald auslassen wollte, auch ein Mann und sogar noch ein zweiter. Aber das war es ja nicht gewesen, was ihn zu seinem Entschluss gebracht hatte. Er war sich plötzlich klargeworden, dass Margit in keiner Beziehung die Frau war, die er sich an seiner Seite vorstellen konnte. Daran war keine andere Frau schuld, sondern ein paar Bemerkungen von Margit anlässlich einer Party, die sie gemeinsam besucht hatten – und auch ihr Benehmen auf dieser Party.
Man konnte weiß Gott nicht sagen, dass Harald strenge moralische Grundsätze hatte, aber bei ihm gab es gewisse Grenzen, die er nicht überschritt und von anderen nicht überschritten sehen wollte, vor allem nicht von einer Frau, die einmal seinen Namen tragen sollte.
Mit ruhigem Gewissen hatte er so Detloffs Frage beantworten können, dass es keine andere Frau in seinem Leben gäbe, die in absehbarer Zeit Frau Johanson werden sollte.
»Ich werde für eine Zeitlang von der Bildfläche verschwinden«, hatte er gesagt, »und Margit wird sich inzwischen hoffentlich zu trösten wissen. Bewerber hat sie ja genug.«
Mit einem ganz eigentümlichen Blick hatte ihn Detloff angesehen. »Ihr vermeintliches Erbe ist natürlich verlockend für so manchen«, hatte er gesagt.
Hatte er wirklich »vermeintlich« gesagt? Harald dachte wieder nach. Aber wenn dieser Mann Sorgen gehabt hätte, wenn ihm das Wasser gar bis zum Halse stehen würde, hätte er doch alles versucht, um gerade ihn bei der Stange zu halten. In der Not griff sogar ein so ehrbarer Geschäftsmann nach dem rettenden Strohhalm, noch dazu, wenn dieser so nahe war.
»Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht«, hatte Gottfried Detloff zu ihm gesagt. »Ich bin recht froh, dass Sie so vernünftig sind, Harald. Ja, ich bin sehr froh und hege jetzt auch die Hoffnung, dass Sie sich eines Tages des Erbes würdig erweisen, das Ihnen hinterlassen wurde.«
Ganz väterlich wohlwollend hatte er das gesagt, und sie schieden als die besten Freunde mit dem Versprechen, immer freundschaftlich verbunden bleiben zu wollen.
Und heute sollte dieser so erstaunlich friedfertige Gottfried Detloff ein schwerkranker Mann sein?
Harald hatte nicht die leiseste Ahnung gehabt, dass er unter Herzbeschwerden litt. Margit hatte das nie erwähnt. Als Detloff ihm damals Dr. Norden als Arzt empfohlen hatte, hatte er nur beiläufig bemerkt, dass Norden Routineuntersuchungen bei ihm vornehmen würde.
Ein Arzt, zu dem man Vertrauen haben könne, hatte er erklärt.
Dieser Ansicht war Harald auch. Er mochte Daniel, weil er jung und modern war, weil er das Leben liebte und seinen Kranken vorbildlich half, und auch, weil er eine so entzückende Frau hatte, die Harald verehrte.
Es gehörte zu seinen Prinzipien, sich niemals ernsthaft um eine verheiratete Frau zu bemühen, und er hatte auch sofort gewusst, dass dies bei Fee Norden völlig sinnlos gewesen wäre. Aber ebenso klar war ihm, dass er für eine solche Frau sofort und ohne Bedenken seine Freiheit aufgegeben hätte.
Aber wann traf man eine solche Frau schon einmal? Ein Riesenglück hatte Dr. Norden gehabt. Beneidenswert war er.
Diese Gedanken schob Harald schnell beiseite. Er trat wieder ans Fenster und blickte hinaus. Widersprüchliche Empfindungen spiegelten sich auf seinem interessanten Gesicht.
Er gab sich einen Ruck und ging zum Telefon. Er rief seinen Anwalt an, der zwar in einer Konferenz war, aber von ihm ließ er sich doch kurz sprechen. Sie vereinbarten ein Treffen am Abend. Bis dahin waren noch ein paar Stunden Zeit. Harald Johanson begab sich in die Sauna. Immer wenn er unruhig war, tat ihm das gut.
*
Dr. Behnisch und Dr. Jenny Lenz hatten sich sehr um den prominenten Patienten bemüht. Sie hätten es aber auch getan, wenn es nicht der bekannte Bankier Detloff gewesen wäre, denn wenn Dr. Norden ihnen einen solch dringenden und ernsten Fall anvertraute, wussten sie genau, dass wirklich Not am Mann war.
Gottfried Detloff war kurz bei Bewusstsein gewesen.
»Wo ist Vanessa?«, hatte er gefragt.
Darauf hatte nun niemand eine Antwort gewusst. Verständlich wäre es Dieter Behnisch und Jenny Lenz erschienen, wenn er nach seiner Tochter gefragt hätte, aber allem Anschein nach gab es in seinem Leben eine andere Frau, die ihm wichtiger war.
Es war auch bei den wenigen Worten geblieben, dann war er wieder eingeschlafen. Sein Puls ging ruhiger, die größte Gefahr schien gebannt.
Am Nachmittag kam Dr. Norden, um sich nach seinem Patienten zu erkundigen. Die beiden Ärzte begrüßten sich freundschaftlich. Dieter erkundigte sich nach Fees Befinden, denn Fee erwartete ein Baby. Er hörte gern, dass es ihr blendend ginge.
»Und wie geht es Detloff?«, fragte Daniel.
»Etwas besser. Er schläft. Er war kurz bei Bewusstsein und hat nach einer Vanessa gefragt.«
Erstaunt sah ihn Daniel an. »Hast du dich nicht verhört?«, fragte er.
»Bestimmt nicht. Er hat es ganz deutlich gesagt.«
»Komisch. Er ist nicht der Mann, der eine Freundin haben kann, ohne dass es bekannt wird. Seine Tochter heißt Margit.«
»Ich weiß. Sie macht ja Schlagzeilen. Eine bekannte Amazone. Vielleicht ist Vanessa ein Pferd. Er hat doch einen Reitstall, soviel mir bekannt ist.«
»Er ist seit zehn Jahren verwitwet, und es hat nie Affären um ihn gegeben. Er ist mit seinem Beruf verheiratet und hat nur die eine Tochter. Ich kenne ihn mittlerweile schon ziemlich gut, aber wenn das seine erste und einzige Frage war, muss jene Vanessa eine große Bedeutung für ihn haben.«
»Vielleicht doch eine späte Liebe. Seine Tochter scheint jedenfalls ein ziemlich dickes Fell zu haben. Sie hat sich noch nicht einmal nach dem Befinden ihres Vaters erkundigt.«
Daniel runzelte die Stirn. Ob es zwischen Vater und Tochter Meinungsverschiedenheiten gegeben hatte, für die Harald Johanson der Grund war?
Er ging zu dem Kranken, fühlte automatisch seinen Puls, betrachtete nachdenklich das eingefallene Gesicht.
Da schlug Gottfried Detloff die Augen auf. Sein Blick schien aus einer fernen Welt zu kommen, die Augen waren verschleiert, die Pupillen weit. Das kam von dem Herzbelebungsmittel, das ihm verabreicht worden war.
»Dr. Norden«, flüsterte der Kranke.
»Ja, ich bin es, Herr Detloff. Wie geht es Ihnen?«
Die breiten Lippen des Mannes waren trocken und rissig. Sein Atem ging flach.
»Vanessa darf nichts geschehen«, flüsterte der Kranke. »Mein Anwalt soll kommen.«
»Wer ist Vanessa? Wo könnte ich sie erreichen?«, fragte Daniel mechanisch.
»Hunter Cottage, Lumberton«, flüsterte Detloff. Dann war seine Kraft schon wieder verbraucht. Als Arzt wusste Dr. Norden, dass er keine weiteren Fragen stellen durfte.
Er hatte diese wenigen Worte registriert.
Als er wieder auf dem Gang stand, schrieb er sie in sein Notizbuch.
Er überlegte, was er nun tun könnte, doch jetzt musste er erst noch einige Krankenbesuche machen. Wer war eigentlich Detloffs Anwalt? Das war ihm nicht bekannt. Er konnte Margit danach fragen, aber war das klug?
Was konnte es bedeuten, dass er nicht nach seiner Tochter fragte, dass Margit sich nicht um ihren Vater kümmerte?
*
Margit Detloff war augenblicklich mit einem anderen Mann beschäftigt. Man konnte nicht sagen, dass sie in guter Stimmung war, aber einen betrübten Eindruck machte sie auch nicht.
Der Mann hieß Simon Terence, wurde Terry genannt, war mittelgroß und hatte die feurigen Augen des Südländers. Er war das, was man einen schönen Mann nannte und eben der, der Haralds Missfallen auf jener Party erregt hatte, oder besser gesagt, mit dem Margit so intensiv geflirtet hatte, dass es nicht nur sein Missfallen erregen musste.
»Papa hat mir Vorhaltungen gemacht, dass wir so oft zusammen gesehen werden, Terry«, sagte sie, »aber aufgeregt hat er sich nicht. Es hat mich sogar überrascht, wie er es hingenommen hat. Ich müsse wissen, was ich tue, hat er gesagt, und er hoffe, dass dich an mir nicht nur mein reicher Vater interessiere.«
Sie sah ihn lauernd an. Margit war viel zu berechnend, um sich einem Mann ganz auszuliefern. Terry gefiel ihr, das stand außer Zweifel. Er war ein Mann, dem alle Frauen nachschauten, begehrlich und herausfordernd, und die ihr zugleich neidische Blicke zuwarfen.
Terry gab ihr aber auch das Gefühl, dass nur sie für ihn existiere, was bei Harald nie der Fall gewesen war. Dessen ungeachtet, war Margit aber nicht bereit, sich diesem Mann zu unterwerfen. Nein, er sollte nur zu ihren Füßen liegen, nicht sie ihm.
Terry schwieg. Er beschäftigte sich mit der Getränkekarte.
»Du brauchst dich doch nicht aufzuregen«, sagte er beiläufig. »Wahrscheinlich hat dein alter Herr geschäftlichen Ärger gehabt. Wenn man ein schwaches Herz hat, haut einen das schnell um. Im übrigen habe ich es nicht nötig, mich für das Geld zu interessieren, das er dir möglicherweise mal hinterlässt.«
»Wem sollte er es sonst hinterlassen?«, sagte Margit. »Ich bin mündig. Ich kann wirklich tun und lassen, was ich will.«
»Ich finde aber, dass du dich um deinen Vater kümmern solltest«, sagte der Mann. »Es wirft ein schlechtes Licht auf dich, wenn du dich in der Klinik nicht blicken lässt.«
»Das ist doch wohl meine Angelegenheit«, sagte sie arrogant.
Sie sah außerordentlich attraktiv aus. Unter dem kessen Hut quollen die rötlichen Locken hervor, die grünen Augen glitzerten, der volle Mund lächelte, perfekt geschminkt, verführerisch.
Sie war schon eine Frau, mit der man sich sehen lassen konnte. Simon Terence hätte sich sonst auch nicht öffentlich mit ihr gezeigt, obgleich es mancherlei Aspekte gab, sich ihre Zuneigung zu sichern.
»Meinetwegen braucht sich dein Papa nicht aufzuregen, Baby«, sagte er leichthin.
»Deinetwegen hat er sich auch nicht aufgeregt, aber ich möchte wissen, warum er den Herzanfall bekommen hat. Da muss eine Frau im Spiel sein. Er hat etwas von einer Vanessa gefaselt.«
»Vielleicht hat er eine Freundin, die er dir verschwiegen hat«, sagte Terry frivol. »Er ist doch ein Mann in den besten Jahren, noch keine fünfzig.«
»Einundfünfzig«, berichtigte ihn Margit. »Er hat Übergewicht und war nie sehr auf seine Gesundheit bedacht. Ich eigne mich nicht zur Krankenpflege«, fügte sie seufzend hinzu.
»Er ist doch in der Klinik gut aufgehoben, Baby«, sagte Terry. »An deiner Stelle würde ich nur ein bisschen aufpassen, dass dich nicht eine andere verdrängt. Nicht so eine besitzgierige Frau, die die Situation auszunutzen versteht. In deinem Interesse, meine ich. Mich geht es ja nichts an, aber ein Kranker ist oft leicht zu beschwatzen, und ich sehe nicht ein, dass du vielleicht von einer raffinierten Mätresse ausgebootet wirst.«
Margit war pikiert. »Davon müsste ich doch etwas wissen. Papa ist viel zu spießig und auf seinen Ruf bedacht, als dass er so etwas tun würde.«
»Aber er ist doch sicher manchmal allein ausgegangen!«, sagte Terry hintergründig.
»Mit Geschäftsfreunden.« Sie machte eine Pause. »Gestern war er allerdings ziemlich lange aus. Er hat nicht darüber gesprochen. Heute Morgen haben wir uns nicht gesehen, und als er vormittags heimkam, hatte er gleich den Anfall … Wie ist es eigentlich mit uns, Terry? Harald hat mir mitgeteilt, dass er auf eine Safari geht.«
»Und die Verlobungsparty fällt ins Wasser?«, fragte Terry.
»Ich hätte das schon abgebogen«, sagte sie von oben herab. »Papa hat alles forciert. Natürlich deshalb, weil Harald so irrsinnig reich ist. Geld zu Geld, ist Papas Devise.«
»Und deine?«, fragte Terry spöttisch.
Sie lachte leicht auf. »Adäquat muss ein Mann natürlich schon sein«, sagte sie. Es störte ihn fürchterlich, dass sie dauernd »natürlich« sagte, aber das ließ er sich nicht anmerken.
»Ich könnte es mir auch gar nicht leisten, mich mit so einem Dahergelaufenen abzugeben«, fuhr Margit fort, »aber darüber brauchen wir zwei uns natürlich gar nicht zu unterhalten. Wir wollen heute Abend auf den Empfang zu Konsul Jeffrey gehen. Was meinst du?«
»Obwohl dein Vater in der Klinik liegt?« Seine dichten Augenbrauen hoben sich leicht.
»Er ist doch gut versorgt. Papa war nie sentimental. Ich habe die Interessen unseres Hauses oft vertreten, wenn er sich nicht wohl fühlte. Hast du Hemmungen, Terry?«
»Nie«, erwiderte er mit einem hintergründigen Lächeln. »Aber an deiner Stelle würde ich vorher doch mal in die Klinik fahren.«
»Das hatte ich auch vor. Du holst mich dann gegen acht Uhr ab. Okay?«
»Okay, Baby«, erwiderte er. Ein fast satanischer Ausdruck lag auf seinem Gesicht, aber Margit sah ihn verliebt an. »So mag ich dich«, sagte sie. »Du reizt mich wahnsinnig, Terry.«
»Wie charmant du bist, Darling«, sagte er. »Da dein strenger Papa nicht daheim ist, könnte es eine reizvolle Nacht werden.«
Margit war hingerissen. Terry faszinierte sie. Wenn er sie mit seinen glutvollen Augen anblickte, konnte sie nicht mehr denken. Ihr kühler Verstand war dann tatsächlich ausgeschaltet. Es fiel ihr schwer, sich jetzt von ihm zu trennen. Ein Wort von ihm hätte genügt, und sie hätte alles vergessen, ihren Vater und auch den Empfang bei Konsul Jeffrey. Aber Simon Terence sagte dieses Wort nicht.
»Ich hole dich ab«, fuhr er fort. Es klang recht ernüchternd, doch Margit war zu sehr in seinem Bann, um sich ernüchtert zu fühlen.
*
»Fräulein Detloff ist gekommen«, sagte Dr. Jenny Lenz zu Dr. Behnisch.
»Was du nicht sagst. Sie erübrigt sich also doch ein paar Minuten.«
»Sei nicht so sarkastisch, Dieter«, sagte Jenny. Sie duzten sich nur, wenn niemand es sonst hören konnte, aber es gab keinen Zweifel, dass es ein herzliches Du war. »Vielleicht hat sie einen Schock bekommen und musste sich davon erst erholen.«
»Du hast ein viel zu gutes Herz, Jenny«, lächelte Dr. Dieter Behnisch.
»Und du bist viel zu misstrauisch«, konterte sie.
»Sprich du doch mit ihr. Du kannst das besser. Halte tröstend Händchen.«
Sie drehte sich mit einem Ruck herum und ließ ihn stehen. Er lächelte hinter ihr her und wartete. Er wusste, dass sie bald wiederkommen würde, denn so gut kannte er sie nun schon, und glücklicherweise hatte er jetzt Zeit, um auf sie zu warten.
Und sie kam nach zehn Minuten. Sie hatte ihre störrische Miene aufgesetzt, wie er dieses verschlossene Gesicht bezeichnete.
»Sie ist eiskalt«, stieß Jenny hervor.
»Was du nicht sagst. Ist es nicht nur der Schock?«, spottete er.
»Sie sieht aus, als käme sie von einer Party«, sagte Jenny grimmig.
»Vielleicht will sie erst zu einer gehen«, erwiderte Dieter.
»Außerdem will sie dich sprechen. Sie hält anscheinend mehr von Männern.«
»Ich werde kaum ihr Typ sein«, grinste Dieter. »Falls du aber Angst um mein Seelenheil haben solltest, Jenny, ruf mich nach ein paar Minuten zu einem dringenden Fall.«
Nun, er war gewiss nicht Margits Typ, dazu wirkte er viel zu seriös, aber da sie sich sein Wohlwollen sichern wollte, denn schließlich konnte man nicht wissen, was noch kommen würde, zeigte sie sich von ihrer liebenswürdigsten Seite.
Sie war genauso, wie er sie eingeschätzt hatte. Sie sagte, dass sie den Schock noch immer nicht überwunden hätte, aber er glaubte ihr kein Wort.
Sie beteuerte, wie sehr sie ihren Vater liebe, aber Dieter fragte sich, ob sie überhaupt der Liebe zu einem anderen Menschen fähig wäre. Sie war kalt wie Eis, Jenny hatte recht, und glatt wie eine Schlange, das war seine Meinung.
Sie wollte ihren Vater sehen, das konnte er ihr nicht verbieten. Seiner Mahnung, dass sie nur kurz bei ihm bleiben dürfe, hätte er keinen Nachdruck zu verleihen brauchen. Als sie sah, dass ihr Vater schlief, hatte sie es sehr eilig, das Krankenzimmer wieder zu verlassen.
Ob er Wünsche geäußert hätte, fragte sie noch. Dr. Behnisch verneinte es. Das war alles. Sie verabschiedete sich.
»Nun?«, fragte Jenny, als er ins Ärztezimmer zurückkam.
»Wieder mal ein Beweis, dass man Kinder nicht zu sehr verwöhnen soll. Sie setzen jedes Gefühl ins Materielle um. Vielleicht rechnet sie sich jetzt schon aus, wie groß ihr Erbe sein wird, wenn ihr Vater stirbt.«
»Er wird nicht sterben«, sagte Jenny sehr bestimmt.
»Dann müssen wir aber jede Aufregung von ihm fernhalten, und wenn mich nicht alles täuscht, können auch von seiner Tochter Aufregungen kommen.«
»Wenn wir nur wüssten, wer diese Vanessa ist, und wo wir sie finden können«, sagte Jenny gedankenvoll.
»Vielleicht erfahren wir es morgen von ihm«, überlegte Dieter Behnisch.
*
Über diese geheimnisvolle Vanessa dachte auch Dr. Norden nach. Hunter Cottage, Lumberton. Das klang nach England oder Schottland. Aber es war ein großes Land, und wenn man nicht einmal den Nachnamen wusste … Seine Gedankengänge kamen ins Stocken – vielleicht war Hunter ihr Nachname?
Jetzt musste er in Erfahrung bringen, wer Detloffs Anwalt war, aber Margit wollte er danach nicht fragen. Eine innere Stimme warnte ihn.
Ob Harald Johanson es wusste? Er stand doch in enger geschäftlicher Beziehung zu Detloff. Möglicherweise hatten sie sogar den gleichen Anwalt.
Fee war sehr erstaunt, dass sich ihr Mann nicht viel Zeit für die Begrüßung nahm und ihr nur einen flüchtigen Kuss gab, um dann gleich zu fragen: »Haben wir die Telefonnummer von Johanson?«
Fee brauchte nicht lange zu überlegen. Molly war sehr gewissenhaft, und die Telefonnummer war auf der Karteikarte vermerkt.
Daniel wählte sie schon, und Harald Johanson meldete sich auch sofort, als hätte er neben dem Telefon auf einen Anruf gewartet.
Ja, er kannte den Anwalt von Detloff. Dr. Endres war auch der seine. Harald erwähnte auch, dass er an diesem Abend eine Besprechung mit ihm hätte. Darauf fragte Daniel, ob es möglich zu machen wäre, dass er den Anwalt auch einmal kurz sprechen könne.
Dem stünde nichts im Wege, erklärte Harald. Wenn es ihm recht wäre, würde er ihn gegen halb acht Uhr abholen.
Sie ahnten beide nicht, unter welch dramatischen Umständen diese Verabredung dann zustandekommen sollte.
Harald mixte sich einen Drink, als es läutete. Er fragte durch die Sprechanlage, wer da sei, aber es kam keine Antwort.
Doch es läutete wieder. Harald schaute aus der Wohnungstür. Es war niemand da. Dann hörte er plötzlich die aufgeregte Stimme des Hausmeisters, die seinen Namen rief.
»Kommen Sie, Herr Johanson – schnell!«
Harald fuhr mit dem Lift abwärts, sah den Hausmeister, der aufgeregt mit den Armen herumfuchtelte, und dann sah er ein Mädchen am Boden liegen.
»Sie hat bei Ihnen geläutet und Ihren Namen gemurmelt, und dann war sie weg«, sagte der Hausmeister.
Das Mädchen war ohnmächtig. Harald hatte es nie zuvor in seinem Leben gesehen, aber er sah, dass es schlimm um sie bestellt sein musste. Es blieb keine Zeit für Überlegungen. Wenige Sekunden später hatte er wieder Dr. Norden an der Strippe.
»Johanson hat ein ohnmächtiges Mädchen gefunden!«, rief er ihr zu, dann war er aus der Tür.
Fee aber eilte ihm nach.
»Liebling, was soll denn das?«, fragte Daniel vorwurfsvoll.
»Wenn es sich um ein Mädchen handelt, komme ich besser mit.«
Daniel seufzte schwer, doch Fee schmiegte sich an seine Seite.
»Was soll ich denn allein?«, fragte sie sanft.
»Dich ausruhen, mein Schatz. Ich werde ja nicht den ganzen Abend fortbleiben.«
»Ihr wolltet doch eigentlich zu dem Anwalt«, sagte Fee.
Daran war aber gar nicht zu denken. Aufregende Minuten folgten, als sie das Haus erreicht hatten, in dem Harald Johanson wohnte. Das Mädchen hatten sie in die Hausmeisterwohnung gebracht, und der Hausmeister, der im Krieg mal Sanitäter gewesen war, hatte bereits einen Ambulanzwagen herbeigerufen, der kurz nach Dr. Nordens Ankunft eintraf.
Der Hausmeister hatte sich nicht getäuscht, als er eine Vergiftung bei dem Mädchen vermutete. Dr. Norden sagte ihm anerkennende Worte für seine Umsicht und Entschlossenheit, und Dr. Behnisch kam an diesem Abend noch zu einer Patientin, da es ohnehin die nächstliegende Klinik war und dem Mädchen schleunigst der Magen ausgepumpt werden musste. Daniel war gleich mit dem Ambulanzwagen mitgefahren. Fee blieb bei Harald Johanson zurück, der sich von seiner Bestürzung noch nicht erholt hatte.
»Ja, es hatte bei mir geläutet«, bestätigte er dem Hausmeister geistesabwesend, »aber ich habe diese junge Dame nie zuvor gesehen.«
Der Hausmeister schien gelinde Zweifel zu hegen. So viel hatte er doch feststellen können, dass es ein sehr hübsches und gutgekleidetes Mädchen war, und mit solchen konnte man Harald Johanson eigentlich überall sehen, auf den Sportplätzen und in Bars.
»Ich kenne sie wirklich nicht«, sagte er zu Fee. »Es kann peinlich für mich werden, wenn man mir nicht glaubt. Wahrscheinlich wollte sie auch gar nicht zu mir. Es ist ihr einfach schlecht geworden, und sie hat auf die erstbeste Glocke gedrückt.«
»Aber sie hat Ihren Namen gesagt«, betonte der Hausmeister. »Und hier ist ihre Tasche.«
Es war eine sehr geschmackvolle Tasche aus bestem Leder. Bestimmt war sie ziemlich teuer gewesen.
Harald starrte sie an und wandte sich dann Fee zu.
»In einem solchen Fall muss man ja wohl die Polizei verständigen«, sagte er dumpf.
»Bloß keine Polizei«, warf der Hausmeister ein. »Unsere Mieter sind alle prominente Leute, denen das gar nicht passen würde.«
Um sich selbst Unannehmlichkeiten zu ersparen, war er sogar bereit, Harald Zugeständnisse zu machen.
»Es wird sich schon herausstellen, zu wem sie wollte«, sagte er. »Sie wird ja wieder zu sich kommen.«
»Dann können wir ihr die Tasche ja in die Klinik bringen«, meinte Fee entschlossen, obgleich sie nicht der Meinung war, dass dieses Mädchen schon bald wieder zu sich kommen würde, wenn sie überhaupt noch zu retten wäre. Fee war schließlich Ärztin, und so viel hatte sie feststellen können, dass es sich um eine schwere Vergiftung handelte. Eine Selbstmörderin? Vielleicht doch enttäuscht von Harald Johanson?
Fee sah ihn forschend an. Seine Miene war nachdenklich, aber nicht schuldbewusst.
»Fahren wir zur Klinik«, sagte er.
Der Hausmeister schien durchaus einverstanden, dass weiteres Unheil von diesem Hause abgewendet wurde. Er schien auch nicht viel Sympathie für die Polizei zu empfinden.
Sie fuhren mit Haralds Wagen, einem schnittigen Lamborghini, der sehr niedrig war, und Fee war froh, dass es bis zur Behnisch-Klinik nicht weit war, denn sonst wäre ihr doch übel geworden. Schließlich war sie bereits im sechsten Monat, wenn man es auch noch nicht gar so deutlich sehen konnte.
»Hand aufs Herz, Herr Johanson«, sagte Fee, »kennen Sie das Mädchen wirklich nicht? Es käme doch heraus.«
»Ich schwöre es, dass ich ihr nie begegnet bin«, erwiderte er ernst. »Ich habe viele Fehler, aber ich bin kein Lügner.«
»Dann werden wir herausfinden müssen, wer das Mädchen ist, und vielleicht verrät es uns der Inhalt dieser Tasche«, sagte Fee.
»Vielleicht hat sich der Hausmeister in der Aufregung verhört«, fuhr sie fort. »Er hat gesehen, dass sie auf Ihre Klingel drückte …, aber was sollen wir uns darüber den Kopf zerbrechen. Schauen wir doch mal in die Tasche.«
Darin fanden sie erstaunlicherweise nicht viel, nicht einmal eine Geldbörse.
Ein Notizblock, der leer war, ein zusammengeknülltes Taschentuch, das ziemlich schmutzig war, ein feines Goldkettchen, das zerrissen war, aber kein Portemonee, keine Ausweispapiere, nichts, was Aufschluss gegeben hätte über die Persönlichkeit und Herkunft der Fremden. Sie warteten auf Daniel und zerbrachen sich die Köpfe, ohne eine logische Erklärung zu finden. Den Anwalt hatten sie beide völlig vergessen.
Dann sagte ihnen Daniel, dass der Zustand des Mädchens äußerst ernst sei und sie gerade noch vor einem ganz schnellen Tod gerettet werden konnte. Ob ihre zarte Konstitution noch genügend Abwehrkräfte aufbringen würde, konnte jetzt niemand sagen.
Harald beteuerte auch ihm, dass er das Mädchen niemals vorher gesehen hätte, und schließlich fiel ihm ein, dass er Dr. Endres eine Nachricht zukommen lassen müsse, warum er sich verspätet hätte.
»Hier können wir nichts tun«, sagte Daniel. »Jetzt möchte ich aber doch wissen, ob nicht wenigstens Herrn Detloff zu helfen ist.«
Fee konnte mit seinem Wagen heimfahren. Daniel fuhr mit Harald zu dem Anwalt, der Fee versprach, ihren Mann dann heimzubringen.
Fee fuhr noch einmal in die Behnisch-Klinik, um nach dem Mädchen und Herrn Detloff zu sehen. Dr. Jenny Lenz blieb bei der Patientin. Dr. Behnisch erstattete Fee etwas ausführlicher Bericht.
»Du solltest jetzt eigentlich mehr an dich und dein Baby denken«, sagte er vorher jedoch besorgt.
»Uns beiden geht es sehr gut«, erwiderte sie munter. »Was ist das für ein Mädchen, Dieter?«
»Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr als ihr.«
»Du hast sie aber genau betrachtet. Wie stufst du sie ein? Playgirl oder so was?«
»Ganz im Gegenteil. Eher eine junge Lady, möchte ich sagen. Eine jungfräuliche Lady, darüber haben wir uns natürlich auch vergewissern müssen. Schätzungsweise zwanzig Jahre alt, sehr gepflegt, zierlich, feinknochig, höchstens neunzig Pfund Lebendgewicht. Augen braun, vollkommene, sehr schöne Zähne. Keine besonderen Merkmale, abgesehen von einer winzigen Narbe unter dem Kinn. Muss als Kind mal gefallen sein.«
»Und die Art der Vergiftung?«
»Ein starkes Betäubungsmittel in flüssiger Form, wahrscheinlich mit Orangensaft getrunken. Man könnte sagen, eine beinahe tödliche Dosis, wenn die Hilfe nicht so schnell gekommen wäre.«
»Wird sie überleben?«
»Das will ich doch sehr hoffen. Unsere Jenny ist auf diesem Gebiet eine Kapazität. Aber vernehmungsfähig wird sie nicht so schnell sein.«
»Muss die Polizei eingeschaltet werden?«
»Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Wahrscheinlich wird sie irgendwo vermisst und wird gesucht werden, und dann bekomme ich Ärger, wenn ich den Fall nicht melde. Wahrscheinlich hatte die Kleine Liebeskummer. Da macht man solche Dummheiten.«
Fee dachte wieder an Harald. In seinem Leben gab es viele Mädchen, aber dennoch hatte sie den Eindruck gewonnen, dass er genauso herumrätselte wie sie.
*
Das tat er allerdings.
»Wenn ich doch nur wüsste, was das Mädchen von mir wollte, wenn sie mich wirklich gesucht hat«, sagte er zu Daniel. »Vorerst würde es mir schon genügen, ihren Namen zu wissen, damit ich überlegen könnte, mit wem sie in Zusammenhang zu bringen wäre.«
Nun waren sie vor Dr. Endres Haus angelangt, einer Villa aus der Gründerzeit, mit Erkerchen und verschnörkeltem Stuckwerk.
Dr. Endres war auch nicht mehr der Jüngste, mittelgroß und hager, mit schütterem Haar und wachsamen Augen hinter einer goldgeränderten Brille.
Harald erklärte ihm schnell den Grund der Verspätung und die Anwesenheit von Dr. Norden.
»Detloff ist in der Klinik?«, fragte er überrascht. »Warum haben Sie mir das nicht schon am Telefon gesagt, Herr Johanson?«
»Weil Sie so beschäftigt waren. Ich dachte, dass es Ihnen einen Schreck versetzen würde.«
»Allerdings, aber noch befremdlicher finde ich es, dass Margit mich nicht benachrichtigt hat.«
Er wollte nun erst genau erfahren, was geschehen war. Daniel erzählte es und sagte ihm, dass Gottfried Detloff ihn sprechen wolle.
»Das denke ich mir. Er weiß ja nicht, was nun mit Vanessa ist, aber ich kann es ihm auch nicht sagen. Ich habe keine Nachricht.«
»Vanessa?«, fragte Harald verblüfft. »Wer ist das?«
Daniel Norden hatte den Namen wenigstens schon gehört und war nun voller Spannung, ob er etwas über diese mysteriöse Vanessa erfahren würde. Aber Dr. Endres war plötzlich sehr reserviert.
»Ich muss erst mit Herrn Detloff sprechen. Ich glaube nicht, dass ich zu Auskünften berechtigt bin. Entschuldigen Sie, dass es mir so herausgerutscht ist.«
»Herr Detloff hat diesen Namen erwähnt. Diesen einen Namen. Den seiner Tochter nicht«, sagte Daniel gedankenvoll.
»Und ich wollte Sie fragen, ob er sich wegen finanzieller Schwierigkeiten aufgeregt haben könnte«, warf Harald ein.
»Im Leben eines Gottfried Detloff gibt es keine finanziellen Schwierigkeiten«, sagte Dr. Endres steif. »Wenn er sich aufgeregt hat, muss es mit Vanessa zusammenhängen, so viel kann ich Ihnen sagen.«
»Und nicht mehr?«, fragte Daniel. »Nichts, was uns weiterhelfen könnte?«
»Ich werde Herrn Detloff gleich morgen aufsuchen. Hoffentlich kann ich mit ihm sprechen, und wenn er es gestattet, werde ich Sie informieren. Aber vielleicht können Sie von Margit mehr erfahren, Herr Johanson. Sie ist doch Ihre zukünftige Frau.«
»Nein, das hat sich zerschlagen«, entgegnete Harald.
Dr. Endres runzelte die Stirn. »Und darüber könnte sich Herr Detloff nicht erregt haben?«
»Nein, darüber nicht. Wir haben uns ausgesprochen, und er schien sogar damit einverstanden.«
Ob das stimmt, ging es Daniel durch den Sinn, und auch Dr. Endres schien skeptisch zu sein, aber Harald blieb ganz gelassen.
»Sie glauben mir nicht? Nun, ich war auch überrascht, dass er es lächelnd aufnahm.«
»Lächelnd?«, fragte Dr. Endres verblüfft.
»Wenn nicht alles täuscht, war er der Ansicht wie ich auch, dass ich zur Ehe nicht tauge. Unser gutes Einvernehmen sollte darunter nicht leiden. Ich hoffe sehr, dass Herr Detloff Ihnen das bald bestätigen wird.«
Er wirkte so ruhig und selbstsicher, dass man an seinen Worten nicht zu zweifeln wagte.
Dann kam Harald nochmals auf das dramatische Ereignis dieses Abends zu sprechen.
»Ein ereignisreicher Tag für Sie«, stellte Dr. Endres fest. »Jedenfalls wäre es besser, wenn Sie Ihre Reise verschieben würden, um nicht in den Verdacht zu geraten, dass Sie sich aus dem Staube machen wollten.«
»Ich hatte mich ohnehin mit dem Gedanken getragen, die Reise aufzuschieben«, erklärte Harald. »Mich interessiert viel zu sehr, wer dieses Mädchen ist, und warum sie bei mir geläutet hat.«
Diese Bemerkung enthob zumindest Daniel aller Zweifel. Dieser Harald Johanson erschien ihm weit verantwortungsbewusster, als man ihm zutraute. Für ihn war er bisher nur ein lebenslustiger, doch sympathischer junger Mann gewesen, der seinen Reichtum erst einmal genießen wollte, und das hatte Daniel sogar verstanden, denn Haralds Vater war als Geizhals verschrien gewesen, der seinen Sohn derart streng erzog, dass man den Jungen bedauert hatte. Von Haralds Mutter sagte man, dass sie an dem Starrsinn ihres Mannes zerbrochen wäre.
Fee war daheim, als er kam. Sie hatte sich auf der Couch ausgestreckt und las die Zeitung. Diesmal bekam sie einen ganz zärtlichen Kuss. Dann ging es ans Erzählen.
Was sie von Dieter noch erfahren hatte, ließ Daniel aufhorchen.
»Man muss doch feststellen, woher ihre Kleidung stammt«, sagte er. »Jede Kleinigkeit wäre wichtig.«
»Es kann sein, dass sie morgen schon selbst alles erklären kann«, sagte Fee.
*
Am nächsten Morgen erschien Helga Moll, genannt Molly, wieder in der Praxis. Ihre Nase war noch gerötet, aber sie behauptete, völlig gesund zu sein.
»Ein paar Tage hätten wir es schon noch durchgestanden, Molly«, sagte Fee.
»Und dann hätten Sie auf der Nase gelegen. Ich weiß doch, wie es zugeht, wenn das Wochenende naht.«
Sie sollte recht behalten. Das Telefon klingelte fast ununterbrochen. Das Wartezimmer war voll. Molly ahnte noch gar nicht, was gestern geschehen war, denn Fee hatte keine Zeit, es ihr zu erzählen.
Sie kamen auch nicht dazu, in der Behnisch-Klinik anzurufen.
Dort war man auch überaus beansprucht. Zwei Operationen hatte Dr. Behnisch bis zehn Uhr schon hinter sich gebracht.
Kaum waren sie damit fertig, kam Schwester Fränzi, eine Neueinstellung, mit der sie sehr zufrieden waren, und sagte, dass ein Dr. Endres Herrn Detloff besuchen wolle.
»Das ist der Anwalt«, erinnerte sich Dr. Behnisch. »Erst mal sehen, was unser Patient macht.«
Gottfried Detloff war bei Bewusstsein. Er hatte eine verhältnismäßig gute Nacht verbracht, wenn man die Umstände bedachte.
Für Dr. Endres war es die größte Überraschung, dass er nicht aufbegehrte, sondern sich hier sogar recht wohlzufühlen schien.
»Nett, dass Sie kommen«, sagte er zu Dr. Endres.
»Dr. Norden richtete mir aus, dass Sie mich zu sprechen wünschen.«
»Ein anständiger Mensch und ein ausgezeichneter Arzt«, sagte Gottfried Detloff anerkennend. »Hier lasse ich mich gesundpflegen. Es gefällt mir. Zu Hause komme ich ja doch nicht dazu.«
Dr. Enders war fassungslos. Er musste sich von dieser Überraschung erst erholen, und gleich kam die nächste.
»Margit hat Sie nicht angerufen?«, fragte Detloff. Der Anwalt schüttelte verneinend den Kopf.
»Dachte ich es mir doch«, sagte Detloff. »Sie wartet auf mein Ende.«
Dr. Endres blieb die Luft weg. So sprach Gottfried Detloff von seiner geliebten und verwöhnten Tochter.
»Ich habe wirklich alles für dieses kleine Biest getan«, fuhr der Bankier fort, »Schuldbewusstsein war allerdings auch dabei, aber dass sie so kaltschnäuzig ist, hätte ich doch nicht gedacht.«
»Wie soll ich das verstehen?«, fragte Dr. Endres mit belegter Stimme.
»Einmal werden Sie es schon verstehen. Ich will jetzt mein Testament ändern, um allen Eventualitäten vorzubeugen.«
»Sie sind krank«, sagte der Anwalt.
»Aber bei klarem Verstand.«
»Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass man das anders auslegen könnte, wenn jemand es darauf ankommen lassen will«, erklärte Dr. Endres.
Gottfried Detloff sah ihn finster an. »Stecken Sie mit Margit unter einer Decke?«, fragte er wütend. »Dann nehme ich mir einen anderen Anwalt.«
»Was denken Sie? Ich bin Ihr Anwalt und doch fast so etwas wie ein Freund. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass man nach einem solchen Herzanfall Ihre völlige Zurechnungsfähigkeit anzweifeln könnte.«
»Ich werde es euch schon zeigen«, polterte Gottfried Detloff los. »Also, mein lieber Endres. Sie müssen Vanessa finden. Sie müsste schon längst hier sein. Sie ist bereits vor zehn Tagen von Aberdeen abgereist. Ich mache mir Sorgen um das Mädchen. Ich habe gestern Morgen einen Anruf bekommen, dass ihr etwas zustoßen würde, wenn ich sie als meine Tochter anerkenne.«
Dr. Endres atmete schwer. »Als Ihre Tochter?«, stotterte er.
»Sie ist meine Tochter«, erwiderte Gottfried Detloff. »Ich habe es selbst erst vor vierzehn Tagen erfahren. Später einmal werden Sie alles erfahren. Einiges wissen Sie schon. Setzen Sie sich umgehend mit Hunter Cottage in Verbindung. Schicken Sie jemanden hin. Wenn Sie niemanden haben, sagen Sie es Harald. Er wird mir diese Gefälligkeit erweisen.«
»Harald Johanson?«
»Wer denn sonst? Er ist ein cleverer Junge.«
»Er ließ die Verlobung platzen«, murmelte Dr. Endres.
»Er hat recht daran getan. Er lässt sich keine Hörner aufsetzen«, erwiderte Gottfried Detloff barsch. »Weihen Sie ihn ein. Ich gebe Ihnen den ausdrücklichen Befehl. Ich weiß, was ich von meinen Mitmenschen zu halten habe. Aber gnade Ihnen Gott, wenn Margit ein Sterbenswörtchen davon erfährt.«
Völlig verdattert verließ Dr. Endres die Klinik und fuhr sogleich in seine Kanzlei zurück. Er musste erst Ordnung in seine Gedanken bringen, aber dann rief er doch Harald Johanson an. Er wusste sich keinen anderen Rat.
*
Harald hatte wenig geschlafen, erst gegen Morgen war die Unruhe in ihm verklungen. Es war neun Uhr, als er wieder erwachte. Er wankte ins Bad, duschte kalt, trank dann einen superstarken Mokka und aß zwei hartgekochte Eier.
Er versorgte sich allein. Er war im Internat spartanisch erzogen worden. Es machte ihm nichts aus, auch seine Wohnung in Ordnung zu halten, wenn er das auch niemandem preisgab. Mochten sie doch nur einen Playboy in ihm sehen. Ihm war das egal.
Er hatte sich angekleidet, als es läutete. Die Erinnerung an den gestrigen Abend war hellwach in ihm, aber diesmal erwartete ihn kein Schrecken. Margit stand vor der Tür. Er starrte sie schweigend an.
»Na, darf ich mal dein Heiligtum betreten?«, fragte sie spitz. »Ich habe dir Wichtiges zu erzählen. Ich war gestern Abend schon mal hier, aber da hattest du Theater mit einem Mädchen, wie ich vom Hausmeister hörte. Hast du wieder mal ein Herz gebrochen?«
»Red nicht solchen Unsinn! Ich kenne das Mädchen nicht.«
»Das kannst du leicht behaupten, ob man es glaubt, ist eine andere Frage. Was ist denn mit ihr?«
Ihr Tonfall irritierte ihn, ihre glitzernden Augen noch mehr.
»Sie ist in einer Klinik«, erwiderte er heiser. »In der Behnisch-Klinik, aber lass jetzt die Fragerei.«
Hätte er sie jetzt beobachtet, wäre er doch erstaunt gewesen, denn ihr Gesicht hatte sich zu einer Grimasse verzerrt
»Papa ist auch in der Behnisch-Klinik«, sagte sie. »Du hast ihm wohl etwas zu drastisch erklärt, dass du dich vor der Verlobung drücken willst. Er hatte einen Herzanfall.«
»Unser Gespräch war bestimmt nicht der Grund. Wir verständigten uns sehr freundlich«, sagte Harald.
»Du kannst alles abschütteln. Du erklärst es so, wie es am günstigsten für dich ist. Für Papa gab es keinen anderen Grund, sich so aufzuregen.«
»Vielleicht doch. Könnte er dich nicht mit dem feurigen Typen gesehen haben?«
»Du machst mir Spass. Bist du etwa eifersüchtig? Harald, ich habe diesen Mann erst vor einer Woche kennengelernt. Er macht mir den Hof, aber du solltest mich eigentlich kennen …«
»Ja, ich kenne dich«, fiel er ihr ins Wort. »Ich kenne dich weit besser, als du annimmst. Mir ist dieser Terry auch völlig egal, genauso wie die anderen. Ich habe dir auch schon gesagt, dass eine solche Frau für mich indiskutabel ist.«
»Und was machst du?«, fragte sie empört. »Wie viele Mädchen scharwenzeln um dich herum? Können wir uns nicht einmal in aller Ruhe darüber unterhalten?«
Das Telefon läutete. Schnell ging Harald hinaus, froh über diese Unterbrechung. Es war Dr. Endres. Schon kurze Zeit später kehrte Harald zu Margit zurück.
»Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss zu einer wichtigen Besprechung«, sagte er. »Und was wird mit deiner Safari?«, fragte sie spöttisch. »Verzichtest du?«
»Nein«, erwiderte er, nur um eine weitere Debatte zu unterbinden.
In ihren Augen leuchtete es triumphierend auf, aber er konnte sich diesen Ausdruck nicht erklären. Er war erleichtert, als er sich von ihr verabschieden konnte.
Es ärgerte sie, dass sie aus Harald nicht klug wurde, niemals klug aus ihm geworden war. Es ärgerte sie aber noch mehr, dass ihr Vater Geheimnisse vor ihr hatte.
Nun durfte sie zu ihm. Er war auch bei Bewusstsein, aber er gab sich leidend, obgleich er eigentlich nur müde war. Die Unterredung mit Dr. Endres hatte ihn doch ein bisschen angestrengt, und mit Margit wollte er lieber gar nicht sprechen. Dafür hatte er gute Gründe.
»Es geht schon wieder aufwärts, Papa«, sagte Margit. »Hoffentlich kommst du bald wieder heim, dann pflege ich dich gesund.«
»Das verstehen sie hier besser«, brummte er. »Ich bleibe hier!« Und damit brachte er auch seine Tochter aus der Fassung.
*
Ziemlich aus der Fassung gebracht war auch Harald, als Dr. Endres ihm eröffnete, was er mit Gottfried Detloff besprochen hatte.
»Nun sagen Sie mir doch erst einmal, wer diese Vanessa ist«, forderte er.
Damit musste Dr. Endres noch vorsichtig sein. Er hatte sich schon eine plausible Erklärung zurechtgelegt.
»Vanessa Hunter war eine gute Bekannte von Herrn Detloff«, erklärte er.
»War?«, fragte Harald erregt dazwischen.
»Sie ist vor drei Monaten gestorben und hat eine Tochter hinterlassen, die auch Vanessa heißt. Herr Detloff fühlte sich verpflichtet, sich dieses Mädchens anzunehmen, und eigentlich sollte sie hier schon eingetroffen sein.«
»Margit hat davon nie etwas gesagt.«
»Sie weiß nichts davon. Herr Detloff wollte die jungen Damen bekanntmachen, wenn Vanessa hier eingetroffen ist. Er macht sich Sorgen um das Kind. Er meint, dass Sie ihm den Gefallen tun würden, nach Schottland zu fliegen.«
»Junge Dame? Kind? Was ist sie nun eigentlich?«, fragte Harald.
»Ich weiß es auch nicht so genau«, erwiderte Dr. Endres ausweichend. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir erklären würden, ob Sie bereit sind, Herrn Detloff diesen Freundschaftsdienst zu erweisen.«
Unter halb geschlossenen Lidern sah Harald ihn an.
»Gut, ich werde fliegen. Ich möchte, dass Herr Detloff gesund wird, damit seine Tochter mir nicht anhängen kann, dass ich an seinem Zusammenbruch schuld bin. Aber lange kann ich mich nicht aufhalten, sonst könnte man mir hier etwas anderes anhängen – in Bezug auf das junge Mädchen.«
»Ich stehe selbstverständlich hinter Ihnen, Herr Johanson«, sagte Dr. Endres.
»Na, verteidigen kann ich mich vorerst noch ganz gut allein«, sagte Harald ironisch. »Sagen Sie Herrn Detloff Bescheid, dass er sich auf mich verlassen kann, so wie ich mich immer auf ihn verlassen konnte. Sie haben buchen lassen?«
»Ja, das habe ich.«
»Sie kennen mich auch sehr gut«, murmelte Harald.
»Alles Rätselhafte zieht Sie an, Herr Johanson«, stellte Dr. Endres fest.
»Wie recht Sie haben.« Es klang sehr spöttisch.
*
Der stürmische Vormittag in der Sprechstunde war vorüber. Daniel schickte sich an, dringende Krankenbesuche zu machen. Er fand seine Frau mit dem Telefonhörer am Ohr.
»Wen rufst du an?«, fragte er.
»Ich versuche, Herrn Johanson zu erreichen. Er hat gestern seinen Impfpass vergessen. Er wollte doch zu einer Safari.«
»Das wird er doch nicht«, sagte Daniel. »Es könnte ihm Unannehmlichkeiten einbringen.«
»Jedenfalls ist er nicht daheim.«
»Er hockt bestimmt nicht den ganzen Tag in der Wohnung herum. Er wird auf irgendeinem Sportplatz sein, beim Reiten oder Golf. Ruf lieber mal Dieter an und erkundige dich, wie es Detloff und dem Mädchen heute geht. Und vergiss das Essen nicht, Liebes.«
»Vergiss du es auch nicht, Schatz«, lächelte sie, »und steck dich nicht an.«
»Ich bin gegen alle Viren immun. Sie mögen mich nicht«, erwiderte er lächelnd.
Das konnte ihr nur recht sein. Einen kranken Daniel konnte sie sich gar nicht vorstellen.
Sie rief also in der Behnisch-Klinik an, vernahm, dass Gottfried Detloff auf dem Wege der Besserung sei und das fremde Mädchen außer Lebensgefahr. Aber bei Bewusstsein wäre die Fremde noch nicht, sagte Jenny Lenz.
Harald Johanson war zu dieser Zeit schon auf dem Wege zum Flugplatz. Er hatte schnell seine Reisetasche gepackt, und da er fürchtete, dass Margit nochmals aufkreuzen könne, wollte er seine Wohnung lieber schnell verlassen.
Merkwürdig war es schon, dass Margit von all dem nichts wissen sollte. Gottfried Detloff hatte kein Vertrauen zu seiner Tochter, das schien sicher! Oder fürchtete er, dass sie ihm wegen dieser Vanessa Schwierigkeiten bereiten könnte?
Ja, alles Rätselhafte zog ihn an. Er war jetzt von einer fieberhaften Spannung erfüllt.
Als seine Maschine aufgerufen wurde, machte er sich gemächlich auf den Weg. Wie von ungefähr fiel sein Blick da auf einen Mann, der ihm sehr bekannt vorkam. Er blieb stehen und schaute ihn sich genau an. Es gab keinen Zweifel, es war Simon Terence. Er redete hastig auf ein sehr attraktives Mädchen ein, das eine sehr abweisende Miene aufgesetzt hatte und ihn heftig zurückstieß, als er ihre Schultern umfasste.
Hoffentlich treffe ich ihn nicht im Flugzeug, dachte Harald. Die Privatangelegenheiten dieses Mannes waren ihm herzlich gleichgültig, und an einem Gespräch mit ihm war ihm nicht gelegen.
Harald ging schnell durch eine Sperre, wurde von dem Zollbeamten wie ein alter Freund begrüßt und als First-Class-Passagier bevorzugt abgefertigt und mit ein paar anderen sofort zu der wartenden Maschine gefahren.
Von seinem Fensterplatz aus konnte er beobachten, wie die anderen Passagiere über die Gangway die Maschine bestiegen. Simon Terence war nicht darunter, aber jene junge Dame, mit der er gesprochen hatte. Wie Kupfer glänzte ihr Haar unter den Sonnenstrahlen.
Sie stolperte leicht. Ein Herr im Sportanzug stützte sie. Sie dankte ihm mit einem Lächeln, das bezaubernd war und nichts von dem Unwillen zeigte, den Harald vorhin auf ihrem aparten Gesicht gesehen hatte, als sie mit Simon sprach. Er bedauerte es jetzt, nicht neben ihr sitzen zu können.
Zu seiner Freude traf er aber eine andere hübsche junge Dame wieder, die Stewardess Judy.
»Oh, Mr. Johanson«, begrüßte sie ihn mit einem strahlenden Lächeln. »Sie fliegen nach Schottland?«
»Immer mal was anderes, Judy«, erwiderte er lächelnd. »Wie geht’s? Nicht mehr auf der Africa-Line?«
»Immer mal was anderes«, konterte sie schlagfertig. »Was kann ich für Sie tun?«
»Nichts, oder doch. Eine Auskunft hätte ich gern von Ihnen«, sagte er flüsternd. »Können Sie mir sagen, wie die junge Dame im grünen Kostüm heißt?«
»Im grünen Kostüm?«, fragte Judy.
»Mit kupferroten Haaren.«
Judy zwinkerte ihm schelmisch zu. »Mal sehen, was sich machen lässt. Weil Sie es sind«, gab sie leise zurück.
»Ein Platz ist hinten wohl nicht mehr frei?«, fragte er.
Ihr Lächeln vertiefte sich. »Wir sind ausgebucht. Tut mir leid, Mr. Johanson.«
»Sie brauchen nicht zu vermuten, dass ich mein Herz verloren habe«, sagte Harald lässig.
»Nur so ein kleiner Flirt zum Zeitvertreib. Ich kenne Sie doch. Ich bin sehr gespannt, an wen Sie mal Ihr Herz wirklich verlieren. Hoffentlich erfahre ich es.«
»Wenn es soweit ist, werde ich für meine Hochzeitsreise Plätze für die Maschine buchen, die Sie betreuen«, erwiderte Harald.
»Da müssen Sie sich aber sehr beeilen. In drei Wochen scheide ich aus. Da gehe ich nämlich auf Hochzeitsreise.«
»Dann alles Gute, Judy. Ist er nett? Taugt er etwas?«
»Sonst würde ich ihn nicht heiraten, Mr. Johanson.« Ihr feines Näschen reckte sich höher.
Geflirtet hatte Harald auch mit ihr, aber Judy hatte schon immer ihre Prinzipien gehabt. Sie war ein Mädchen, vor dem er Respekt hatte.
Zwanzig Minuten später erfuhr er, dass die junge Dame mit dem kupferroten Haaren eine Miss Hunter wäre.
Er stutzte und riss die Augen auf. »Und der Vorname?«, fragte er atemlos.
»Tut mir leid, das weiß ich nicht. Miss V. Hunter steht auf der Liste.«
V. für Vanessa?, fragte sich Harald. Seine Gedanken überstürzten sich. Miss Hunter und Simon Terence. Und Gottfried sorgte sich um eine Vanessa Hunter und schickte ihn aus, um Nachforschungen nach ihr anzustellen.
Gewiss war der Name Hunter weitverbreitet, aber war es nicht merkwürdig, dass Simon Terence, der einen heißen Flirt mit Margit Detloff hatte, auch sehr gut bekannt mit einer Miss Hunter war?
Mit brennender Ungeduld wartete er jetzt auf die Landung, aber dann erlebte er eine große Enttäuschung. Bei der Zollabfertigung wartete er vergeblich auf die junge Dame mit den kupferroten Haaren. Sie und ihr Begleiter schienen wie vom Erdboden verschluckt worden zu sein.
Er traf am Ausgang Judy, und sie zeigte sich nicht abgeneigt, noch einen Drink mit ihm zu nehmen.
»Sagen Sie mir bitte, Judy, wo die besagte junge Dame geblieben ist.«
Judy lächelte verlegen. »Ich bin zur Diskretion verpflichtet«, erwiderte sie stockend.
»Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Ich werde auch sehr diskret sein. Sie kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben.«
»Sie war in Begleitung von Lord Dalton«, flüsterte Judy. »Er genießt Sonderrechte. Es tut mir leid, Mr. Johanson, aber auf diesen Flirt müssen Sie wohl verzichten.«
»Mir war nicht nach einem Flirt«, erwiderte er nachdenklich. Über sein Interesse an Miss Hunter bewahrte er allerdings strengstes Stillschweigen.
Als er dann ein Taxi bestieg, fragte er sich, ob er dieses aparte Mädchen auf Hunter Cottage wiedersehen würde, ob es jene Vanessa war, die Gottfried Detloff suchte.
*
Hunter Cottage stand als efeuumranktes Haus inmitten eines großen verwilderten Gartens. Es machte nicht den Eindruck, als gäbe es hier ein einziges Lebewesen. Es wirkte so, als wäre es verzaubert.
Durch eine knarrende Tür betrat Harald den Garten.
Er zog an der Klingel. Es gab einen häßlichen, kreischenden Laut. Aber es kam niemand.
Er drückte auf die Türklinke. Sie gab nach. Die Tür knarrte laut, und noch immer kam niemand.
Jedoch machte das Innere des Hauses einen so reinlichen Eindruck, dass es unmöglich schon lange so verlassen sein konnte.
Es war jetzt sehr still, so still, dass Harald das Klopfen seines Herzens vernehmen konnte. Er ging nach kurzem Zögern auf eine Tür zu, die einen Spalt offenstand, und sah eine große, helle und sehr geräumige Küche vor sich, und vor dem Herd stand eine alte, gebeugte grauhaarige Frau.
»Hallo«, sagte Harald laut. Die Frau drehte sich um und erstarrte. Erschrocken sah sie ihn an.
»Wer sind Sie?«, fragte sie in schottischem Dialekt, den Harald glücklicherweise während seiner Schulzeit verstehen gelernt hatte.
Er stellte sich vor. Er sagte, dass er Miss Vanessa Hunter suche.
Die Frau sah ihn misstrauisch an. Sie schüttelte den Kopf. Er erklärte ihr, dass er im Auftrag von Gottfried Detloff käme.
Ein Ausdruck von Angst legte sich über ihr faltiges Gesicht.
Ob Vanessa denn nicht bei ihm wäre, fragte sie. Sie sei doch schon vor zehn Tagen abgereist.
Ihre Stimme zitterte. Sie wurde zugänglicher, bat ihn dann in den Wohnraum. Und da schien sich alles um ihn zu drehen. Jetzt begann er zu zittern, jeder Nerv in ihm begann zu vibrieren, denn an der Wand hing ein Ölgemälde, aus dem ein Gesicht auf ihn herabblickte, das er erst kürzlich gesehen hatte. Das Gesicht des Mädchens, das er vor seiner Haustür gefunden hatte.
Das Gesicht auf dem Gemälde schien jedoch viel lebendiger. Es war von einer anderen Frisur umrahmt, ein wunderschöner Mund lächelte rätselhaft.
»Wer ist das?«, fragte er heiser, unwillkürlich nach einem Halt suchend.
»Miss Vanessas Mutter«, erwiderte die alte Frau. »Ich bin Laura.« Ihre trüben Augen füllten sich mit Tränen, als sie zu dem Gemälde emporblickte.
»Sie hat uns zu früh verlassen. Sie war zu gut für diese Welt«, sagte sie leise. »Warum ist Vanessa nicht bei ihrem Vater?«
»Ich weiß es nicht, Laura«, erwiderte er, denn er wollte der alten Frau nicht sagen, unter welchen Umständen er die Bekanntschaft von Vanessa gemacht hatte – ohne zu ahnen, wer sie war. Er hatte dieses Mädchen in den Armen gehalten, sie lag in der gleichen Klinik wie ihr Vater, und niemand schien auch nur die geringste Ahnung zu haben. Das Mysteriöse dieses Geschehens wurde ihm erst später wieder bewusst, als er halbwegs seine Fassung wiedererlangt hatte.
Nun wollte er doch so viel wie nur möglich über Vanessa und ihre Mutter erfahren, aber Laura war sehr wortkarg.
Sie bewirtete ihn mit einem lukullischen Imbiss, aber ihre Miene wurde immer trauriger und verschlossener.
Dann, ohne dass Harald vorher ein Geräusch vernommen hätte, tat sich plötzlich die Tür auf, und die junge Dame mit dem grünen Kostüm und den kupferroten Haaren erschien.
Laura stieß einen überraschten Ausruf hervor.
»Miss Violet!«, rief sie aufschluchzend aus.
Die junge Dame umarmte Laura, doch über ihre Schulter hinweg fühlte sich Harald von zwei wunderschönen topasfarbenen Augen eindringlich gemustert.
»Wer sind Sie?«, fragte Violet Hunter kühl.
V für Violet, dachte Harald, nicht für Vanessa.
»Mein Name ist Harald Johanson«, stellte er sich vor.
»Was will er, Laura?«, fragte Violet.
»Er kommt wegen Vanessa. Sie ist nicht bei ihrem Vater eingetroffen. Er meinte, sie hier zu finden.«
Das aparte Gesicht verdüsterte sich. »Wie seltsam«, sagte Violet. »Ich werde mit Mr. Johanson sprechen, Laura. Bitte, lass uns allein.« Ihre Stimme war klanglos, als wäre sie mit ihren Gedanken weit entfernt.
Harald überlegte blitzschnell, wie er sich jetzt verhalten sollte.
War es klug, ihr zu sagen, dass er sie mit Simon Terence auf dem Flugplatz in München gesehen hatte, dass er wusste, dass sie mit der gleichen Maschine gekommen war? Was war von ihr zu halten?
Er beschloss, sehr vorsichtig zu sein, konnte aber feststellen, dass sie es auch war.
»Können Sie sich ausweisen, Mr. Johanson?«, fragte Violet.
»Aber gewiss, Miss Hunter«, erwiderte er spöttisch.
Er reichte ihr seinen Pass. Sie studierte ihn genau, ohne Verlegenheit. Sie sah ihn forschend an, schien das Passbild mit ihm zu vergleichen. Er musste unwillkürlich lachen.
Ihre schönen Augen sprühten Blitze. »Mir ist nicht zum Lachen zumute«, sagte sie scharf.
»Mir eigentlich auch nicht, um so mehr ich mir nicht erklären kann, wie Sie zu der Bekanntschaft von Simon Terence kommen«, entfuhr es ihm nun doch unbedacht.
Maßlose Überraschung malte sich auf ihrem aparten Gesicht.
»Woher wissen Sie das?«, fragte sie. »Laura? Nein, Laura kann es Ihnen nicht erzählt haben.«
Harald verschränkte die Arme über seiner Brust. Er fühlte sich jetzt sicherer und im Vorteil. Er wollte ihre Verwirrung nützen.
»Ich sah Sie mit Simon in München am Flughafen. Wir sind in derselben Maschine geflogen, Miss Hunter, und ich war sehr enttäuscht, als ich Sie nicht am Flughafen abfangen konnte.«
»Warum wollten Sie das?«, fragte sie irritiert.
»Weil ich erfahren hatte, dass Sie V. Hunter heißen, und weil ich Simon Terence kenne.«
Sie überlegte eine Sekunde. »Woher kennen Sie ihn?«, fragte sie dann mit einem gezwungenen Lächeln.
Er musste auf der Hut sein. Sie war überaus intelligent.
»Ich würde Sie zuerst gern fragen, was Sie über den Verbleib von Vanessa Hunter wissen. Sie sind mit ihr verwandt?«
»Zwei Fragen auf einmal«, erwiderte sie zurückhaltend. »Ich bin Vanessas Cousine. Damit ist die eine Frage beantwortet, auf die andere weiß ich keine Antwort. Ich bin in großer Sorge um Vanessa. Deshalb flog ich nach München und traf Simon. Ich hoffte, dass er mir Auskunft geben könnte.«
»Wieso er?«, fragte Harald.
»Er ist mit Vanessa verlobt, und er hat sie nach München begleitet.«
Harald sah sein reizvolles Gegenüber bestürzt an.
»Sagen Sie das noch einmal!«, stieß er hervor.
»Wozu? Sie sehen nicht so aus, als wären Sie schwerhörig«, erwiderte sie schlagfertig. »Also, Mr. Johanson, kommen wir zur Sache. Legen wir beide die Karten auf den Tisch. Was wissen Sie über Simon?«
Sie war nicht nur hübsch und intelligent, sie war auch sehr energisch.
»Ich werde Laura Bescheid sagen, dass sie uns einen Tee zubereitet«, warf sie ein und war dann schnell aus dem Zimmer. Er hegte den Verdacht, dass sie mit Laura sprechen wollte, aber sie blieb nicht lange aus.
Sie schlug die langen schlanken Beine übereinander, wunderschöne Beine, wie Harald feststellte, und lehnte sich in den Sessel zurück, dessen grüner Samtbezug einen dekorativen Rahmen für dieses aparte Gesicht mit den kupferroten Haaren bildete. Sie hatte ihm noch keinen jener Blicke geschenkt, die sonst von Frauen an ihn verschwendet wurden. Ihr Blick richtete sich jetzt auf das Gemälde.
»Tante Vanessa war eine wunderschöne Frau«, sagte sie leise. »Man kann es verstehen, dass ein Mann seinen Kopf ihretwegen verlor. Ich spreche von Mr. Detloff.«
»Ich verstehe, aber ich verstehe nicht alles. Ich weiß im Grunde gar nichts«, sagte Harald, und doch wurde ihm jäh bewusst, dass er die Zusammenhänge im Gespräch mit Laura bereits in etwa erkannt hatte.
»Als ich herkam, wusste ich jedenfalls noch nicht, dass Gottfried Detloff Vanessa Hunters Vater ist«, sagte er gedankenverloren.
»Und warum sind Sie gekommen?«
»Herr Detloff ist schwer erkrankt. Er hat auf die Ankunft von Vanessa gewartet und macht sich große Sorgen um sie.« Vielleicht wiederholte er sich, aber Violet schien das nicht zu stören.
»Wir müssen eine Reihenfolge festlegen«, sagte Violet sinnend. »Wir werden uns gegenseitig ergänzen, Mr. Johanson. Ich weiß auch nicht alles. Ich habe erst vor einem Monat erfahren, wer Vanessas Vater ist. Tante Vanessa war die Schwester meines Vaters, eine schöne und wunderbare Frau. Wir haben sie alle sehr geliebt, und niemand hätte ihr einen Vorwurf gemacht. Sie liebte Gottfried Detloff, obgleich er verheiratet war. Er hätte sich ihretwegen scheiden lassen, aber das kam für Tante Vanessa nicht infrage. Sie verschwand aus seinem Leben, wie sie gekommen war. Er erfuhr nie, dass sie einer Tochter das Leben schenkte. Ich meine, er erfuhr es nicht, solange sie lebte. Sie wollte keine finanziellen Vorteile für ihre Tochter, der sie ein recht beträchtliches Vermögen hinterlassen hat. Sie meinte nur, dass Vanessa das Recht hätte, ihren Vater kennenzulernen. Meine Cousine zeigte sich dem letzten Wunsch ihrer Mutter gegenüber sehr reserviert, doch Simon überredete sie zu einem Besuch mit der Begründung, dass sie sich ihren Vater wenigstens einmal ansehen könne.«
»Was ist er für ein Mensch?«, fragte Harald nach einem inhaltvollen Schweigen.
Violet zuckte die Schultern. »Ehrlich gesagt, nicht mein Fall, aber Vanessa ist sehr unerfahren. Ich möchte sagen, dass sie seinem unbestreitbaren Charme erlag.«
»Und was gäbe es sonst über ihn zu sagen?«
»Nicht viel, was mir bekannt wäre. Er entstammt einer guten, aber verarmten Familie. Hat alles mögliche studiert, auch Jura, aber meiner Ansicht nach hielt er in erster Linie Ausschau nach einer reichen Frau. Ich habe es Vanessa gesagt, aber sie ist so arglos, so naiv. Vielleicht dachte sie auch, ich wäre eifersüchtig.«
»Was aber jeder Grundlage entbehrt?«, fragte Harald.
»Was jeder Grundlage entbehrt«, konterte sie ironisch. »Ich bin eine berufstätige Frau, Mr. Johanson. Eine emanzipierte Frau, wenn Sie das hören wollen. Ich bin mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gegangen und habe als Sekretärin eines Ministers genug Männer kennengelernt, um mir eine Meinung bilden zu können.«
Sie wurden unterbrochen. Laura brachte den Tee. Sie warf Harald einen langen Blick zu. »Hoffentlich ist Miss Vanessa nichts passiert«, murmelte sie.
»Soviel kann ich Ihnen sagen, dass sie am Leben ist und jetzt in guter Hut«, erklärte er.
Darauf rollten Tränen über Lauras faltige Wangen, Violet aber war aufgesprungen.
»Sie wissen es bestimmt? Es ist wahr?«, fragte sie erregt.
»Ja, es ist die reine Wahrheit. Ich werde Ihnen alles erzählen, so rätselhaft es auch noch immer erscheinen mag.«
»Wo ist Vanessa?«, fragte Violet.
»In einer Privatklinik in München«, erwiderte Harald.
»Aber warum sind Sie hergekommen, um Vanessa zu suchen?«, fragte sie mit unverhohlenem Misstrauen.
»Weil ich nicht wusste, dass es sich um Vanessa Hunter handelt«, erwiderte er.
»Sie müssen mir viel erklären, Mr. Johanson«, sagte Violet.
»Das werde ich tun. – Laura, kann ich Miss Violet vertrauen?«, fragte er die alte Frau.
Verwirrt sah sie ihn an. »Aber ja, Sir, sie liebt Vanessa wie eine Schwester«, erwiderte sie tonlos.
»Sie sind ein misstrauischer Mann«, sagte Violet spöttisch.
»Sie sind eine misstrauische Frau«, gab er mit einem entwaffnenden Lächeln zurück.
»Jetzt haben wir uns genug beschnüffelt und sind beide zu der Überzeugung gekommen, dass wir uns trauen können«, sagte sie. »Also zur Sache, Mr. Johanson.«
»Ich heiße Harald. Das vereinfacht das Verständnis.«
»Okay.« Sie trank einen Schluck Tee. »Ich bin wie ausgedörrt«, erklärte sie. »Ich bin nämlich heute schon mal verhört worden.«
»Von Lord Dalton?«, fragte Harald.
Ihre schöngeschwungenen Augenbrauen ruckten empor. »Sie sind aber gut informiert. Sind Sie Detektiv?«
»Nein, ich kenne eine Stewardess sehr gut«, erwiderte er. »Ist Lord Dalton von Scotland Yard?«
»I wo. Eine Zufallsbekanntschaft, aber eine nette. Wir schweifen schon wieder ab. Also noch einmal von vorn. Ich erzähle Ihnen jetzt, wie sich Geoffrey, ich meine Gottfried Detloff, und Tante Vanessa kennenlernten. Sie hat ein Tagebuch hinterlassen, das Vanessa mir zu lesen gab. Das war vor einundzwanzig Jahren in London. Die Hunters waren eine sehr angesehene Familie. – Geoffrey, ich möchte ihn auch so nennen, weil Tante Vanessa es tat, hatte geschäftlich mit ihrem Vater zu tun. Es war zwischen ihnen die große Liebe auf den ersten Blick, aber Geoffrey war leider verheiratet. Tante Vanessa wusste es, aber sie dachte wohl, lieber ein paar Wochen glücklich, als ein ganzes Leben unglücklich. Für sie hat es nie einen anderen Mann gegeben. Ihr Vater, mein und Vanessas Großvater, starb sehr plötzlich an einem Herzschlag. Mein Vater, übrigens ein prächtiger Mann, hielt zu seiner Schwester. Sie zog sich hier von aller Welt ganz zurück, und wenn man ihr überhaupt einen Vorwurf machen kann, dann nur den, dass Vanessa in dieser Abgeschiedenheit aufwuchs, von ihrer Mutter abgöttisch geliebt. Ich war ihre einzige Spielgefährtin, ihre einzige Freundin. Wir waren wie Geschwister. Ich bin fünf Jahre älter als sie«, fügte Violet mit einem flüchtigen Lächeln hinzu. »Aber was ist mit Vanessa?«
»Wir wollen die Reihenfolge einhalten«, sagte Harald. »Sonst verlieren wir das Konzept. Eigentlich müsste jemand Protokoll führen.«
»Ich habe ein gutes Gedächtnis, aber ich kann ja mitstenografieren«, sagte Violet und holte sich sogleich einen Notizblock. Ihr Gesicht war sehr ernst geworden, als sie sich wieder setzte.
»Tante Vanessa starb nach einem langen Leiden, das sie aber vor uns allen verbergen konnte. Sie war eine unerhört tapfere Frau.«
»Gottfried Detloffs Frau ist auch schon lange tot«, sagte Harald leise, »wusste sie es nicht?«
»Doch, aber sie wusste auch, dass er eine Tochter aus dieser Ehe hat. Sie ist drei Jahre älter als Vanessa.«
»Und sehr gut bekannt mit Simon Terence«, warf Harald nun ein.
Violets Augen weiteten sich. »Ist das die Möglichkeit?«, staunte sie. »Davon hat er mir nichts gesagt.«
»Dann wird er seine Gründe haben. Er hat also Vanessa nach München begleitet.«
»Er hat es sich nicht nehmen lassen«, sagte Violet sarkastisch. »Ich war beruflich sehr beansprucht. Vor drei Tagen bekam ich ein Telegramm von Simon. Vanessa sei verschwunden, telegrafierte er. Ich solle Nachricht geben, ob sie wieder daheim wäre.«
Sie ließ ihren Blick zum Fenster hinausschweifen.
»Ich fuhr hierher und stellte fest, dass Vanessa nicht hier war. Ich sagte Laura nichts, um sie nicht aufzuregen, ließ mir Urlaub geben und flog nach München. Ich rief bei Mr. Detloff an, bekam aber den Bescheid, dass er verreist sei.«
»Verreist? Wer hat das gesagt?«, fragte Harald erregt.
»Eine weibliche Stimme. Ich nahm an, es wäre das Hausmädchen. Simon traf ich am Abend, er war selten im Hotel. Er hatte auch nicht viel Zeit für mich. Wir trafen uns heute Vormittag, und er brachte mich zum Flughafen zurück, nachdem er mir eingeredet hatte, dass Vanessa bestimmt wieder nach Hunter Cottage zurückgekehrt sei. Sie hätten Meinungsverschiedenheiten gehabt, weil sie sich plötzlich geweigert hätte, ihren Vater zu treffen, hat er mir gesagt. Er hätte eine Woche in Paris mit ihr verbracht, weil sie es so gewünscht hätte.«
»Das ist eine Lüge. Ich habe ihn vor mehr als einer Woche auf einer Party kennengelernt – in München«, sagte Harald.
»Auf einer Party?«, fragte Violet erstaunt. »Ohne Vanessa?«
»Ohne Vanessa. Margit Detloff brachte ihn mit.«
Violet schnappte nach Luft. »Geoffreys Tochter?«
»Mit der ich so gut wie verlobt war«, sagte Harald.
Violet betrachtete ihn kopfschüttelnd. »Das ist ja eine schöne Geschichte«, murmelte sie.
»Schön? Eine sehr seltsame Geschichte, finde ich. Diesem Burschen misstraue ich sehr.«
»Simon? Dann sind wir wieder einmal einer Meinung, Harald«, sagte Violet. »Und nun erzählen Sie mir bitte, was Vanessa widerfahren ist.«
Das tat er ausführlich.
*
Margit Detloff saß Simon Terence gegenüber. »Wo warst du den ganzen Tag, Terry?«, fragte sie. »Ich habe dauernd versucht, dich zu erreichen.«
»Ich bin eigentlich nicht zum Vergnügen hergekommen, Darling«, erwiderte er. »Verzeih, aber Zeit ist Geld.«
»Ihr Männer seid schrecklich«, sagte sie leichthin. »Werde bloß nicht so wie Papa, sonst hast du keine Chancen bei mir.«
Seine Augen verengten sich. »Ich bin nicht so reich wie dein Vater«, sagte er. »Ich stehe erst am Anfang. Und ich möchte auch nicht von deinem Vater abhängig sein.«
»Wenn er das Zeitliche segnet, wird alles mir gehören«, sagte Margit frivol. »Noch ein paar Aufregungen, und Gottfried Detloff war einmal.«
»Aber ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich dich wegen deines Geldes geheiratet habe«, sagte er.
»Das wird niemand wagen. Ich werde dir den Weg ebnen. Eines Tages wirst du ganz oben sein. Du hast das Zeug dazu, Terry.«
Aber dadurch würde sie immer Macht über ihn haben. Es war anders als bei Harald. Ihn hätte sie nie abhängig von sich machen können, wie sie es wollte, aber bei Simon Terence war es anders. Margit wusste das genau. Mit Terry konnte sie spielen. Dazu war Harald nicht der Mann gewesen, und sie war nicht die Frau, die sich einem Mann unterordnen konnte.
»Wir wollen jetzt erst einmal warten, bis dein Vater wieder gesund ist«, sagte Simon. »Was ist eigentlich mit dieser Vanessa, von der du gesprochen hast?«
»Papa hat von ihr gesprochen«, berichtigte sie ihn. »Was weiß ich, wahrscheinlich will sie sich einen reichen Mann angeln. Aber ich bin schließlich auch noch da.«
»Hat sie sich noch nicht gemeldet?«, fragte Simon lauernd.
»Nein, und das sollte sie nur wagen. Ich würde sie vor die Tür setzen. Papa kann man doch sowieso nur verminderte Zurechnungsfähigkeit zubilligen.«
»Hat das sein Arzt gesagt?«
»Dazu brauche ich keinen Arzt. – Was machen wir heute Abend, Terry?«
»Was du willst«, antwortete er.
»Dann gehen wir ganz schick aus. Bei Geoffrey war es langweilig.«
»Geoffrey«, wiederholte er gedehnt. »Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass Geoffrey übersetzt Gottfried heißt?«
»Nein, wie kommst du darauf?«
»Nur so. Es kam mir in den Sinn.«
»Wie man überhaupt Gottfried heißen kann«, sagte Margit mit einem klirrenden Lachen. »Bei Papa ist dieser Name völlig verfehlt.«
Das hatte früher manch einer gedacht, auch Dr. Norden, der jedoch an diesem Nachmittag, als er Gottfried Detloff besuchte, zu einer anderen Ansicht kommen sollte.
Still lag der Kranke auf seinem Bett. Die Hände hatte er auf der Brust gefaltet.
»Hat Vanessa sich noch immer nicht gemeldet?«, fragte er.
Daniel Norden verneinte. »Wer ist Vanessa, Herr Detloff?«, fragte er vorsichtig.
»Meine Tochter … Ja, sie ist meine Tochter. Sehen Sie mich nicht so zweifelnd an. Ich rede nicht irre. Ich weiß, was ich sage. Warum ist sie nicht gekommen, Dr. Norden?«
»Es tut mir leid. Darauf weiß ich keine Antwort. Haben Sie mit ihrem Kommen gerechnet?«
»Schon seit zehn Tagen, oder sind es inzwischen noch mehr geworden? Ich habe den Zeitbegriff verloren. Den wievielten haben wir heute?«
»Den fünfzehnten Mai«, erwiderte Daniel.
Gottfried Detloff schloss die Augen. »Wenn ihr etwas passiert ist, bin ich schuld«, murmelte er.
»Aber wie können Sie so etwas sagen?«, fragte Daniel bestürzt.
»Es kam mir in den Sinn. Geld ist eine schreckliche Macht. Es kann in bestimmten Menschen die niedersten Instinkte wecken. Ich bete zu Gott, dass Vanessa nichts angetan wurde.«
Daniel Norden nahm die Hand des Kranken. »Wem trauen Sie das zu?«, fragte er.
»Warum ist Dr. Endres nicht gekommen?«, fragte Gottfried Detloff weiter.
Auch das wusste Dr. Norden nicht.
»Wem kann ich denn trauen?«, fragte der Kranke. »Margit nicht, das weiß ich. Ich bin so müde, so entsetzlich müde.«
Guter Gott, es wird doch keinen Rückfall geben, dachte Daniel. Er fühlte den Puls des Kranken.
»Ich sterbe nicht«, sagte Gottfried Detloff tonlos. »Ich darf nicht sterben. Ich muss Vanessa sehen, ich muss mit ihr sprechen. Nein, jetzt darf ich nicht sterben. Und wenn jemand sie in seine Gewalt gebracht hat, soll jede Summe gezahlt werden, die verlangt wird.«
Dann verließ ihn die Kraft. Schwer sank er in die Kissen zurück. Aber er war nur ermattet. Er war eingeschlafen. Mit diesem beruhigenden Gedanken konnte Dr. Norden ihn verlassen.
Aufgeregt empfing ihn Fee. »Daniel, du wirst es nicht glauben«, sprudelte es über ihre Lippen.
»Was ist denn nun schon wieder passiert?«, fragte er gedankenlos.
»Harald Johanson hat angerufen. Aus Schottland. Das Mädchen ist Vanessa Hunter.«
Er kam nicht gleich mit. »Vanessa Hunter«, wiederholte er geistesabwesend. »Vanessa?«, schrie er dann auf.
»Gottfried Detloffs Tochter«, sagte Fee. »Harald hat es herausgefunden, aber wir sollen es für uns behalten, und sehr schonend sollen wir es Detloff beibringen, falls er es verkraften kann, dass sie auch in der Behnisch-Klinik liegt. Er kommt morgen zurück.«
»Wer?«, fragte Daniel.
»Harald Johanson«, erwiderte Fee nachsichtig.
»Wie kommt er denn nach Schottland? Was hat das zu bedeuten, Fee?«
»Er will uns alles erklären. Er war froh, dass er mich erreicht hat. Und ich war froh, dass er anrief. Ich habe tatsächlich gedacht, er hätte sich aus dem Staub gemacht, weil er ein schlechtes Gewissen hätte.«
»Warum denn?«, fragte Daniel, noch immer konsterniert.
»Nun, wegen des Mädchens. Wer kann denn annehmen, dass es Detloffs Tochter ist? Auf keinen Fall dürfe es Margit erfahren, hat er noch gesagt.«
»Seltsam, sehr seltsam«, murmelte Daniel in sich hinein. »Ist das kein Traum, Fee? Kein Roman? Ist das die Wirklichkeit?«
»Soweit ich es beurteilen kann, ist es eine recht geheimnisvolle Wirklichkeit«, erwiderte sie.
»Ich komme eben von Detloff. Ich dachte immer, Margit wäre sein ein und alles. Da rollt wieder mal ein Schicksalsfilm vor unseren Augen ab.«
»Aber mit vielen Unterbrechungen«, sagte Fee.
»Zum Teufel, ich möchte doch wissen, wie Johanson auf die Idee gekommen ist, nach Schottland zu fliegen? Sollte Detloff es ihm aufgetragen haben?«
»Er wird schon seine Gründe haben. Oder will er Johanson hereinlegen?«, fragte Fee plötzlich erschrocken.
»Nein, das ist nicht Detloffs Art. Er legt niemanden aufs Kreuz, dazu ist er viel zu aufrichtig. Aber dass seine Tochter unter solchen Umständen in die Klinik gekommen ist, werden wir ihm lieber verschweigen. Warten wir ab, was Johanson noch zu berichten hat.«
»Aber aufklären kann Vanessa diese Geschichte wohl nur selbst«, meinte Fee nachdenklich. »Wie ist sie zu der Vergiftung gekommen?«
»Wenn wir das nur wüssten! Und woher kannte sie Johanson, oder zumindest seine Adresse?«
*
Darüber machte sich jetzt Violet auch Gedanken. Voller Spannung und mit sichtlicher Erregung hatte sie Haralds Bericht gelauscht.
Es war schon spät geworden. Laura hatte das Abendessen zubereitet, aber vorerst hatten weder Harald noch Violet Appetit. Und dann erschien ein unerwarteter Gast: Lord Robin Dalton!
Dass auch Violet mit seinem Erscheinen gerechnet hatte, konnte man ihr ansehen. Dunkle Glut schoss in ihre Wangen, als er erschien.
Harald musterte ihn genau. Nichts Zwielichtiges konnte er an diesem Gentleman finden. Allerdings schien Lord Dalton befremdet zu sein, männlichen Besuch bei Violet vorzufinden. Er war äußerst reserviert.
»Ich wollte mich nach Ihrem Befinden erkundigen, Violet«, sagte er, »aber ich störe wohl.«
»Nein, Sie stören durchaus nicht, Robin. Ein Gast aus Deutschland. Stellen Sie sich vor, er ist mit der gleichen Maschine gekommen.«
»Tatsächlich?« Überrascht musterte Robin den anderen. »Ich habe Sie nicht bemerkt.«
»Sie hätten ihm in der First-Class Gesellschaft leisten können, wenn Sie sich nicht meinetwegen unter das Volk begeben hätten«, sagte Violet, nun wieder ganz gelassen. »Mr. Johanson ist auch wegen Vanessa hier.«
Und Lord Dalton hatte inzwischen einige Informationen für Violet besorgt.
Er rückte allerdings erst mit der Sprache heraus, nachdem er sich vergewissert hatte, dass Harald Violets Vertrauen genoss und er selbst sich eingehend informiert hatte, mit wem er es zu tun hatte.
Violet bat ihn, zum Essen zu bleiben, und dabei unterhielten sie sich dann.
»Es besteht kein Zweifel, dass Vanessa mit Mr. Terence zum vereinbarten Termin nach München geflogen und auch dort angekommen ist«, erklärte Lord Dalton. »Diesbezüglich hat Terence Sie belogen. Sie flogen nicht nach Paris. Allerdings wohnten sie in München auch nicht in einem Hotel. Sie scheinen sich sofort nach der Ankunft getrennt zu haben. Mr. Terence hat anscheinend dann sehr bald die Bekanntschaft von Miss Detloff gemacht.«
»Ja, das habe ich bereits von Mr. Johanson erfahren«, warf Violet rasch ein. »Übrigens war Mr. Johanson fast mit Miss Detloff verlobt.«
Dann erfuhr Lord Dalton auch alles über den dramatischen Zwischenfall.
Harald fragte sich allerdings, warum Violet diesem Mann, den sie doch nach ihrer eigenen Aussage erst heute kennengelernt hatte, bereits die ganze Geschichte anvertraut hatte. Sie errötete unter seinem fragenden Blick, den sie richtig zu deuten wusste.
»Sie müssen verstehen, dass ich mich sehr hilflos fühlte, Harald«, sagte sie erklärend. »Lord Dalton ist ein einflussreicher Mann. Ich hoffte, dass er mir behilflich sein könnte.«
Robins Miene verdüsterte sich. Es gefiel ihm nicht, dass Violet den anderen mit dem Vornamen ansprach. Ja, man konnte sagen, dass blanke Eifersucht in seinen Augen zu lesen war.
»Wir waren uns auf Anhieb sympathisch«, erklärte Violet nun leicht verlegen. »Darf ich das sagen, Robin?«
»Gewiss, Violet.«
Er wirkte gelöster.
»Wenn man einverstanden ist, werden wir zu dritt das Rätsel um Vanessa lösen. Zumindest wissen wir ja nun, wo sie ist. Aber ist sie in dieser Klinik auch sicher?«
Irritiert sah Harald ihn an. Ein heißer Schrecken durchfuhr ihn. Lord Dalton war der erste, der anscheinend einem Dritten die Schuld an Vanessas Vergiftung gab.
Lord Daltons Kombinationen schienen logisch. »Sie nehmen doch nicht an, dass Ihre Cousine Selbstmord begehen wollte, Violet?«, fragte er.
»Niemals!«, rief Violet aus. »Vanessa ist sehr gläubig. Mein Gott, ich dachte an eine Lebensmittelvergiftung oder dergleichen … So richtig zum Nachdenken bin ich noch gar nicht gekommen«, räumte sie dann jedoch kleinlaut ein.
»Überlegen wir einmal«, sagte Lord Dalton ruhig. »Mr. Johanson beteuert, Vanessa vorher niemals gesehen zu haben, aber es ist doch mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass sie nicht rein zufällig zu seinem Haus gekommen ist und auf seine Klingel drückte. Meine Meinung ist, dass sie zu ihm wollte, um mit ihm zu sprechen, oder dass jemand sie zu ihm geschickt hat, Mr. Johanson. Jemand, der ihr vorher das Gift einflößte.«
Violet war kreidebleich geworden, und auch Haralds Augen weiteten sich schreckensvoll.
»Sie sagten doch, dass sie hätte sterben können, wenn nicht rechtzeitig geholfen worden wäre«, sagte Lord Dalton. »Möglicherweise wäre sie in Ihrer Wohnung gestorben, und Sie hätten dann beweisen müssen, dass Sie nichts mit ihrem Tod zu tun haben.«
»Du lieber Gott, haben Sie mir einen Schrecken eingejagt«, sagte Harald tonlos. »Wer könnte denn auf eine so unglaubliche Idee kommen?«
»Jemand, der Sie in irgendeiner Weise ausschalten, Ihnen schaden oder sich an Ihnen rächen will«, erwiderte Lord Dalton ruhig.
»Ich habe keine Feinde. Ich habe nie einem Menschen etwas zuleide getan«, wehrte Harald ab.
»Sie sagten, dass Sie mit Miss Detloff so gut wie verlobt gewesen wären. Sie ist die eheliche Tochter ihres Vaters, Vanessa eine außereheliche. Aber Mr. Detloff wollte Vanessa bei sich haben, sie möglicherweise in seinem Testament bedenken.«
»Margit? Nein, eines Verbrechens wäre sie nicht fähig, dazu liebt sie das Leben zu sehr«, sagte Harald. »Sie ist zu intelligent, um ein solches Risiko auf sich zu nehmen.«
»Aber sie war mit Simon Trence beisammen, und wie Sie sagten, hatten diese beiden einen heißen Flirt.«
»Und wenn Simon alles ausgeheckt hat?«, warf Violet ein. »Aber lassen wir doch solche Vermutungen. Wichtig ist, dass Vanessa in Sicherheit ist, und hoffen wir, dass sie bald erklären kann, warum sie Harald aufsuchen wollte. Er fliegt morgen zurück, und ich möchte ihn gern begleiten.«
Nun verdüsterte sich Lord Daltons Miene wieder.
»Dürfte ich Sie unter vier Augen sprechen, Violet?«, fragte er heiser.
»Aber gern, Robin«, erwiderte sie mit einem entwaffnenden Lächeln. »Sie sind nicht böse, Harald?«
»Aber nein. Ich würde jetzt gern Dr. Norden anrufen. Es ist zwar ziemlich spät, aber in Anbetracht der Umstände wird man mir die Störung verzeihen.«
Violet und Lord Dalton blieben allein in dem Wohnraum zurück. Robin machte keine langen Umstände.
»Ich sagte Ihnen schon heute Vormittag, dass mir unser Kennenlernen sehr viel bedeutet, Violet«, erklärte er. »Ich wäre sehr deprimiert, wenn Mr. Johanson meine Pläne durchkreuzt. Sie sehen, dass ich sehr offen bin, und möchte Sie bitten, mich zu verstehen und mir eine ebenso offene Antwort zu geben.«
Violet sah in ihrer Verwirrung sehr anziehend aus, aber sie war eine Frau, die das ehrlich aussprach, was sie fühlte.
»Halten Sie mich für eine Frau, die sich gleich zweimal an einem Tag
verliebt?«, fragte sie schelmisch. »Robin …«, aber sie kam nicht weiter, er hatte sie schon stürmisch in die Arme genommen und zögerte nicht einen Augenblick, sie ebenso stürmisch zu küssen. Sie war überrumpelt, aber sie hatte nichts dagegen, so überrumpelt zu werden.
»Ist wieder alles okay?«, flüsterte sie dicht an seinem Ohr.
»Wenn du mir gestattest, dass ich auch mit nach München fliege.«
Sie lachte leise auf. »Diesen Riesenumweg hätten wir uns eigentlich sparen können«, sagte sie.
»Aber wie hätte ich dich kennenlernen sollen, wenn du nicht auf der Gangway gestolpert wärest!«, fragte er.
»Wieso bist du eigentlich nicht mit den First-Class-Passagieren zum Flugzeug gefahren?«
»Weil mich eine gewisse junge Dame namens Violet magisch anzog.«
Spitzbübisch blinzelte sie ihn an.
»Wer weiß, wie alles gekommen wäre, wenn ich heute nicht die Bekanntschaft eines gewissen Robin gemacht hätte.«
*
Daniel Norden legte den Telefonhörer auf.
»Johanson lässt es sich etwas kosten, mit uns in Verbindung zu bleiben. Ihm ist jetzt der Gedanke gekommen, dass jemand Vanessa nach dem Leben trachten könne.«
»Und jetzt meinst du, dass es ein Ablenkungsmanöver sein könnte?«, fragte Fee.
»Ich weiß nicht, was ich denken soll. Jedenfalls traut ihm die Polizei auch nicht, wie ich vorhin von Dieter erfahren habe. Er wird wohl eine unangenehme Überraschung erleben, wenn er zurückkommt.«
»Wenn er wirklich zurückkommt«, sagte Fee skeptisch. »Wenn er etwas zu fürchten hat, wird er nicht zurückkommen.«
»Immerhin wäre in Betracht zu ziehen, dass Vanessa Hunter in ernster Gefahr ist, wenn ihr jemand nach dem Leben getrachtet haben sollte und nun erfährt, dass sie am Leben bleiben wird. Ich werde mal zu Dieter fahren.«
Fee seufzte. »Wenn ich mal meine Memoiren schreibe, wird ein Krimi daraus«, lächelte sie.
Daniel fuhr zur Behnisch-Klinik. Es war halb neun, und abendliche Ruhe herrschte. Aber es gab immer noch ein paar Besucher, die erst jetzt gingen. In einer Privatklinik war das möglich, wenngleich die Schwestern darüber so manches Mal auch Klage führten.
Zu Daniels Erstaunen traf er auch Margit Detloff. Bevor sie ihn bemerkt hatte, konnte er aus ihrem Mienenspiel ablesen, dass sie sehr ungehalten war, aber als sie ihn dann erkannte, wechselte es rasch zu einem Lächeln.
»Ich habe immer Pech, wenn ich Papa besuchen will, ganz gleich, wann immer ich komme. Er schläft. Was machen Sie denn zu so später Stunde noch hier?«
»Ich habe mehrere Patienten hier, nach deren Befinden ich mich erkundigen muss«, erwiderte Daniel ausweichend.
»Auch dieses fremde Mädchen, das vor Haralds Tür gefunden wurde?« Sie sah ihn forschend an.
Woher wusste sie das? Aber er brauchte nicht zu fragen, bereitwillig gab sie ihm eine Erklärung.
»Es macht schon Schlagzeilen. Haben Sie die Abendzeitung noch nicht gelesen? Da hat sich der clevere Harald schön in die Nesseln gesetzt. Ich bin froh, dass ich ihn noch beizeiten durchschaut habe. Für Papa wäre das ein schlimmer Schock. Und Harald hat sich aus dem Staub gemacht. Er jagt Großwild.«
Davon schien sie überzeugt zu sein. Sie wusste also nichts davon, dass er in Schottland war. Gottfried Detloff hatte seiner Tochter gegenüber allem Anschein nach in jeder Beziehung Stillschweigen bewahrt. Merkwürdig war das schon. Möglich war aber auch, dass es ein Täuschungsmanöver von ihr war.
Er sah sie an, aber ihr Blick schweifte zum Ausgang. Sie wurde unruhig.
»Entschuldigen Sie, Dr. Norden, ich werde abgeholt«, sagte sie rasch.
Daniel blickte zur Tür, sah dort einen Mann stehen, der aber schnell aus dem Lichtkreis zurückwich, bevor er ihn hätte erkennen können.
Margit eilte hinaus, und Dr. Norden ging zum Chefzimmer.
Dort fand er Dieter Behnisch und Jenny Lenz vor.
»Was verschafft uns die Ehre deines späten Besuches?«
»Vanessa Hunter ist der Grund«, erwiderte Daniel.
»Vanessa Hunter? Wie soll ich das verstehen? Hast du die Dame gefunden, nach der Detloff verlangt?«
»Sie ist deine Patientin. Jene Fremde, der du den Magen ausgepumpt hast.«
»Mach mich nicht schwach«, seufzte Dr. Behnisch. »Woher beziehst du dieses Wissen?«
»Von Harald Johanson.«
Dieter Behnisch schüttelte den Kopf. »Du sorgst für Abwechslung, Daniel«, brummte er.
»Dafür sorgen andere. Ich bin nur Handlanger.«
Dieter Behnisch griff sich an die Stirn. »Nun mal langsam, Daniel. Was hat diese Vanessa für eine Bedeutung in Detloffs Leben?«
»Sie ist seine Tochter.«
»Herr im Himmel, es wird ja immer verzwickter. Da soll sich noch einer durchfinden.«
»Langweilig wird es jedenfalls nicht, Dieter. Behalt es noch für dich. Und vor allem darf Detloff jetzt nicht erfahren, was mit dem Mädchen geschehen ist. Wir müssen erst herausbringen, ob sie die Absicht hatte, mit ihrem Leben Schluss zu machen.« Er wartete ein paar Sekunden, bis Dieter das verdaut hatte, dann fuhr er fort: »Auszuschließen ist es ja nicht. Junge romantische Mädchen kommen schnell auf solche absurde Idee, wenn sie mal Liebeskummer haben.«
»Bleibt herauszufinden, ob sie welchen hatte.«
»Kann ich mal zu ihr hineinschauen?«, fragte Daniel.
»Na, hör mal, du hast sie ja schließlich hergebracht. War eigentlich die Polizei schon bei dir?«
»Die Polizei?«, staunte Daniel.
»Nun, jemand hat ihnen geflüstert, dass ein Mädchen unter sehr mysteriösen Umständen ohnmächtig vor Harald Johansons Wohnung zusammengebrochen sei. Es steht schon in der Abendzeitung.«
»Die Polizei war hier?«, fragte Daniel rau.
»Gewiss, und ich habe erklärt, dass wir uns um die Patientin bemüht haben, ohne einen Gedanken zu hegen, dass es ein Fall für die Kriminalpolizei sei. Da sich unsere Ordnungshüter über zu wenig Arbeit nicht zu beschweren brauchen, haben sie auch kein allzu großes Interesse gezeigt, sich eifrig hineinzuknien. Die Presse ist natürlich gleich zur Stelle. Sie brauchen ja Sensationen.«
Und eine Sensation war es wohl, wenn eine dicke Schlagzeile verkündete: Was hat der Millionenerbe Harald Johanson zu verbergen?
»Du lieber Gott«, stöhnte Daniel, als Dieter Behnisch ihm diese Zeitungsseite unter die Nase hielt.
»Und da wundert man sich, wenn die Leute einfach vorbeigehen, wenn einer ohnmächtig auf der Straße liegt«, brummte Dieter. »Ganz leicht kann man ins Gerede kommen … Komm jetzt, Dan, deine Frau wird auf dich warten.«
Sehr zart und sehr schön sah das Mädchen aus, das still in den Kissen lag. Das feine Gesicht hatte einen schmerzlichen Ausdruck, die schöngeschwungenen Lippen waren leicht geöffnet.
Wenn sie doch nur sprechen könnte, dachte Daniel. Er trat dicht an das Bett heran und nahm die schmale wohlgeformte Hand, die wachsbleich war.
»Vanessa«, sagte er leise, um es nochmals lauter zu wiederholen.
War es nur Einbildung, oder zuckten die bläulichen Lider wirklich?
Dr. Norden ließ die Kranke nicht aus den Augen.
»Vanessa, hören Sie mich?«, fragte er.
Ein leiser Seufzer kam über ihre Lippen.
»Terry«, hauchte sie, »nein«, und dann lag sie wieder ganz still, nur ihr Atem ging etwas heftiger, erregter.
»Vielleicht kommt sie morgen zu sich«, sagte Dieter und drängte Daniel wieder mit sanfter Gewalt aus dem Krankenzimmer. »Einen Rückfall dürfen wir keinesfalls riskieren.«
»Du lässt niemanden zu ihr?«
»Ich werde mich hüten. Bisher hat auch noch niemand nach ihr gefragt, die Polizei ausgenommen, und die habe ich abgewimmelt.«
Sie gingen hinaus. Vanessa warf ihren Kopf ruckartig herum, aber das sahen sie nicht mehr. Sie hatte Stimmen vernommen, ferne Stimmen. Sie hatte auch ein paar Worte verstanden. Jemand hatte sie mit ihrem Namen angeredet. Ein anderer hatte von der Polizei gesprochen.
Ihr Kopf, ihre Glieder schmerzten.
Jede Bewegung tat weh, aber ihre Gehirnzellen begannen zu arbeiten.
Mühsam öffnete sie die brennenden Augen, sah in fahlem Licht ein fremdes Zimmer, einen Schrank, ein Fenster. Sie begriff noch nichts. In ihrem Kopf war völlige Leere.
Wo mochte sie sein? Sie versuchte, sich zu erinnern, was geschehen war, als ihr so übel wurde. Ja, daran konnte sie sich fast sofort erinnern. Und was war vorher geschehen?
Sie konnte die Augen nicht lange offenhalten. Ihre Lider waren schwer wie Blei, wie auch ihre Arme, die sie heben wollte, und die gleich wieder herabsanken.
»Laura«, flüsterte sie. Ein Nebelschleier zerriss vor ihren Augen, aber Laura war nicht da. Mechanisch hob sie den Arm, tastete mit der seltsam leblosen Hand, die gar nicht ihr zu gehören schien, herum und berührte mit den tauben Fingern unabsichtlich eine Schnur.
Wie durch einen Zauber tat sich wenig später eine Tür auf, die Vanessa eben erst als solche erkannte. Eine weißgekleidete Gestalt trat ein, wie ein Geist.
»Ich bin Dr. Jenny Lenz«, sagte eine warme Stimme, die sehr beruhigend auf Vanessa wirkte. »Ich bin Ärztin.
Sie sind krank, Miss Hunter.«
»Krank?«, wiederholte Vanessa tonlos.
»Sehr krank sogar«, sagte Jenny, »und Sie dürfen nicht lange sprechen.«
»Wo bin ich?«, fragte Vanessa.
»In der Privatklinik Dr. Behnisch.«
»Wo ist die Klinik?«
»In München. Dr. Norden und Herr Johanson haben Sie hergebracht.«
»Johanson«, wiederholte Vanessa schleppend. »Harald Johanson, Birkenweg drei.« Sie leierte es herunter wie unter Hypnose. Dann war es, als würde ein scharfes Messer in ihre Brust gestoßen. Sie stöhnte auf.
»Haben Sie Schmerzen?«, fragte Jenny.
»Ja, mir tut alles weh. Was ist mit mir? Ein Unfall?«
»Was haben Sie gegessen und getrunken, Miss Hunter?«, fragte Jenny.
»Gegessen und getrunken?«, wiederholte Vanessa wieder. »Ich konnte nicht essen, nein, ich konnte nicht.«
»Aber Sie haben etwas getrunken. Sie hatten Kummer. Haben Sie Tropfen eingenommen?«
»Tropfen?« Die nachtdunklen Augen bekamen einen ungläubigen Ausdruck. »Die Orangeade war bitter. Ich hatte Durst.« Eine Pause trat ein. »Ich weiß nichts mehr«, flüsterte Vanessa dann.
»Sie werden jetzt wieder schlafen«, sagte Jenny sanft und mütterlich, »und morgen wird es Ihnen bessergehen.«
Vanessa schlief ein, aber bald wachte sie auf, doch dieses Erwachen war wie ein Traum. Sie fühlte sich als Kind. Ihre Mutter rief nach ihr. Sie lief durch einen großen Garten, auf eine wunderschöne Frau zu, und dann stand sie plötzlich allein auf dürrem Rasen.
Ich bin kein Kind mehr, ich bin erwachsen, dachte Vanessa, und Mummy lebt nicht mehr. Sie wird nie mehr nach mir rufen.
Heiße Tränen lösten sich aus ihren Augenwinkeln und rannen über ihre Wangen, aber diese Tränen brachten sie in die Wirklichkeit zurück. Sie spürte das salzige Nass auf ihren Lippen, so wie an jenem Tag, als Violet so eindringlich auf sie eingeredet hatte. Was hatte Violet doch gesagt?
»Er ist dein Vater, Vanessa. Deine Mutter hat diesen Mann geliebt. Er ruft dich zu sich. Möchtest du deinen Vater denn nicht wenigstens kennenlernen?«
Nein! Sie hatte nein gesagt. Und dann?
Ja, dann hatte sie mit Terry gesprochen!
Unwillkürlich fasste sie nach ihrer Hand, nach ihrem Ringfinger, aber der war leer. Es war kein Ring mehr da.
Vanessa richtete sich auf. Die Nachtlampe im Zimmer brannte. Sie konzentrierte sich, entdeckte die Tischlampe und drückte auf den Knopf, den ihre Finger ertastet hatten. Helles Licht durchflutete den Raum.
Sie setzte sich auf. Plötzlich spürte sie keine Schmerzen mehr. Sie betrachtete ihre Hände, die völlig schmucklos waren.
Sie brauchte Minuten, bis sie das begriff. Und ganz genau konnte sie sich erinnern, dass sie an der linken Hand ihren Verlobungsring getragen hatte und an der rechten den Saphir, den sie von ihrer Mutter zu ihrem achtzehnten Geburtstag geschenkt bekommen hatte.
Wieder ging die Tür auf. Wieder trat eine weißgekleidete Gestalt ein. Es war nicht Jenny Lenz, es war Schwester Hertha.
»Ich sah Licht. Wünschen Sie etwas?«, fragte sie. Sie war die Nachtschwester und wusste nichts von diesem Mädchen, als dass sie eine von dreißig Patientinnen war.
»Ich vermisse meine Ringe«, sagte Vanessa tonlos.
»Da müssen Sie morgen den Chef fragen und Frau Dr. Lenz. Oder soll ich die Frau Doktor gleich rufen?«, fragte Schwester Hertha.
Vanessa nickte.
Schwester Hertha wunderte sich über nichts. Sie hatte schon so mancherlei erlebt während vieler Berufsjahre, auch, dass Patienten mitten in der Nacht dieses oder jenes vermissten. Sie ging wieder hinaus, und nach kurzer Zeit erschien Dr. Jenny Lenz.
»Sie vermissen Schmuck?«, fragte sie bestürzt.
»Zwei Ringe. Ich trug sie«, erwiderte Vanessa.
»Nicht, als Sie hier eingeliefert wurden«, sagte Jenny.
»Nicht?«, fragte Vanessa und sah dabei aus wie ein trauriges Kind.
»Waren es wertvolle Ringe?«, fragte Jenny.
»Ich glaube schon. Der von meiner Mutter war sehr wertvoll, der andere war mein Verlobungsring. Wo könnten sie nur sein?« Sie atmete schwer. »Bin ich überfallen worden?«, fragte sie dann stockend.
Vielleicht war es so, dachte Jenny. Aber wie kam dann das Gift in ihren Magen?
»Können Sie sich nicht erinnern, wo Sie zuletzt und mit wem Sie beisammen waren?«
Vanessa konnte sich plötzlich erinnern, aber sie wollte es nicht sagen, weil sie einfach nicht glauben konnte, dass ihr von diesem Menschen Schlimmes zugefügt worden war. Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann mich jetzt an gar nichts mehr erinnern, nur an meine Ringe«, murmelte sie. »Ich bitte um Verzeihung, das sollen Sie nicht falsch verstehen.«
»Nein, das tue ich nicht. Grübeln Sie jetzt nicht, Miss Hunter. Versuchen Sie zu schlafen.«
Mit den Beruhigungsmitteln wollte man bei ihr sparsam umgehen, aber als Jenny spürte, wie Vanessas Puls jagte, gab sie ihr doch eines.
Vanessa wusste nicht mehr, was es war, aber plötzlich fühlte sie sich ganz leicht, so als würde sie auf Wolken schweben.
Und dann war ihr, als würde sie im Kino sitzen oder vor dem Fernsehapparat, denn wie ein Film rollte vor ihren Augen ab, was sie erlebt hatte, seit sie Hunter Cottage verlassen hatte.
Simon hatte sie am frühen Morgen abgeholt. Laura hatte noch gefragt, ob sie nicht lieber mit Violet fliegen wollte.
In diesem Film, der ihr schon vieles bewusst machte, sah Vanessa auch Violet. Sie vernahm auch ihre Stimme, die sie immer so gern gehört hatte.
»Ich mag Simon nicht«, sagte Violet. »Was gefällt dir eigentlich so an ihm, Vanessa?«
»Du bist ja eifersüchtig«, erwiderte sie.
»Wie kommst du darauf?«, fragte Violet empört.
»Simon hat es selbst gesagt. Sei doch nicht böse, Violet, dass ich diesmal stärker bin. Dir liegen doch alle Männer zu Füßen, wo du auch hinkommst.«
»Du bist ein kleines Schaf, aber ich liebe dich und fühle mich für dich verantwortlich. Warte ab, was dein Vater zu Simon sagt.«
»Ich werde mir nichts von ihm sagen lassen. Was könnte er mir schon bedeuten?«
»Deine Mutter hat ihn geliebt«, erwiderte Violet.
Geliebt, geliebt, geliebt, hallte es in Vanessas Ohren. Tausend Stimmen schienen es zu rufen, und das Echo warf es zurück.
Simon sagte, dass Gottfried Detloff ein sehr reicher Mann sei. »Du kannst Bedingungen stellen, Vanessa. Er hat bisher noch nichts für dich getan.«
»Ich will nichts von ihm. Ich wünschte, ich hätte nie erfahren, wer mein Vater ist«, hatte sie ihm erwidert.
Der Film rollte weiter. Sie sah sich neben Simon im Flugzeug sitzen. Zuerst war sie froh gewesen, dass er bei ihr war, dann plötzlich wünschte sie sich weit weg von ihm. Der Himmel war so dicht über ihr, sie fühlte sich ihrer Mutter nahe.
Ihre geliebte Mummy! Wie wundervoll war die Zeit gewesen, die sie mit ihr verbracht hatte. Nie hatten sie sich getrennt, selbst die Stunden, die sie in der Schule verbringen musste, dünkten sie immer endlos, und bei wem hätte sie denn mehr lernen können, als bei ihrer Mummy?
»Jetzt musst du an dich denken, an deinen Vorteil, Vanessa«, sagte Simon.
»Er hat eine Tochter«, erwiderte sie.
»Was macht das schon? Du bist auch seine Tochter«, sagte Simon.
Der Film riss. Jäh wurde es Vanessa bewusst, dass sie mit offenen Augen im Bett lag und die Morgendämmerung zum Fenster hereinkroch.
Sie hatte sich mit Simon gestritten. Vorher hatte sie es nie für möglich gehalten, dass sie sich so streiten könnten.
Und dann hatte er eingelenkt, als sie sagte, dass sie erst ein paar Tage der Besinnung brauchte.
»Fahr in die Berge«, hatte er ihr geraten. »Schau dir Garmisch an. Schalte ab, und wenn du alles überdacht hast, weißt du, wo du mich finden kannst.«
Sie hatten in einem Lokal in der Nähe des Bahnhofs gesessen, dann war sie in einen Zug gestiegen und nach Garmisch gefahren. Simon hatte die Fahrkarte gekauft, und während der Fahrt war ihr der Gedanke gekommen, dass sie ihm Unrecht getan hätte.
Sie war es doch gewesen, die ihn gebeten hatte, sie nach Deutschland zu begleiten. Sie hatte ihm von ihrer Unsicherheit erzählt und ihn um Rat gefragt.
Sie war in Garmisch in ein Taxi gestiegen und hatte den Chauffeur nach einem guten Hotel gefragt. Er hatte sie zu einem gebracht, und es hatte ihr gefallen.
Und dann hatten eines Abends ein paar Männer an ihrem Nebentisch gespeist, die den Namen Detloff erwähnten.
»Er ist ein sehr reeller Bankier«, hatte der eine gesagt. »Krumme Sachen gibt es bei ihm nicht.«
»Und gut fundiert«, sagte der andere. »Außerdem wird gemunkelt, dass seine Tochter Harald Johanson heiratet. Geld zu Geld, aber Johanson hat mindestens fünfmal soviel hinter sich wie sein zukünftiger Schwiegervater.«
Ganz genau konnte Vanessa sich an diese Worte erinnern, als sie sich nun umdrehte und auf die Uhr blickte, die leise tickte. Der Zeiger rückte auf die Sechs.
Warum war ihr der Name Harald Johanson so im Gedächtnis haften geblieben, dass sie sich auch zwei Tage später genau an ihn erinnern konnte?
Zwei Tage später hatte sie den Entschluss gefasst, nach München zu fahren. Sie fragte in dem Hotel, das Simon ihr genannt hatte, nach ihrem Verlobten. Er wohnte noch dort, war aber nicht im Hause.
Es war ein exklusives Hotel, und Vanessa hatte sich gefragt, warum Simon kein bescheideneres gewählt hatte, da er ihr doch immer wieder vorhielt, dass er rechnen müsse.
Sie war stundenlang herumgelaufen, bis sie eine Pension fand, die abseits vom Straßenlärm lag und ihr gefiel. Sie hatte geschlafen und dann Violet angerufen. Aber bevor sie Violet sagen konnte, wo sie zu erreichen war, wurde das Gespräch unterbrochen, und später konnte keine Verbindung mehr zustande gebracht werden.
Und als Vanessa bei diesem Punkt angelangt war, kam Schwester Hertha herein, die noch Fieber messen musste, bevor sie abgelöst wurde.
*
»Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, nach München zu fliegen, Violet?«, fragte Harald Johanson, als sie auf dem Londoner Flugplatz fröstelnd auf den Abruf der Maschine warteten.
»Durch einen Anruf von Vanessa. Leider wurden wir unterbrochen, aber ich nahm mit Bestimmtheit an, dass sie im gleichen Hotel wohnen würde wie Simon. Er hatte mich ja angerufen und gesagt, wo sie zu erreichen wären.«
Sie unterbrach sich, denn Lord Dalton kam, der deutsche Zeitungen besorgt hatte.
»Zweiter Aufruf«, sagte er.
Harald starrte auf eine Zeitung. »Das ist ein starkes Stück«, murmelte er. »Wer will mich da verschaukeln?«
»Was ist denn?«, fragte Violet.
Er hielt ihr die Zeitung hin. Sie war vom Vortag, und er hatte die gleiche Schlagzeile gelesen, die auch Dr. Norden nachdenklich gestimmt hatte.
»Da will Ihnen jemand etwas in die Schuhe schieben, Harald«, sagte Violet, »sofern nicht ein rühriger Reporter sich etwas aus den Fingern gesogen hat.«
Unwillkürlich blickte Harald auf die Uhr. »Das werden wir bald wissen«, sagte er heiser. »Die Herrschaften werden mich kennenlernen. Ich habe nichts zu verbergen.«
Elf Uhr fünfzehn landeten sie in München. Harald erschien es wie eine Ewigkeit, dass er fern von dieser Stadt gewesen war, obgleich nur vierundzwanzig Stunden vergangen waren.
Fast hätte er vergessen, dass er seinen Wagen hier geparkt hatte.
Sie zwängten sich hinein, denn eigentlich bot er ja nur zwei Personen Platz.
Punkt zwölf Uhr hielten sie vor der Behnisch-Klinik, und das erste, was Violet bemerkte, war ein Funkstreifenwagen.
»Sie warten anscheinend schon auf mich«, sagte Harald sarkastisch, »aber zuerst will ich wissen, wie es Vanessa geht.«
Er drehte sich zu Violet um.
»Sie lassen mir doch den Vortritt?«, fragte er.
»Bitte, diplomatisch sein, Harald«, sagte sie leise.
»Und nicht vergessen, dass Sie Freunde haben«, fügte Robin hinzu.
»Danke«, erwiderte Harald schlicht.
»Das war lieb, Robin«, sagte Violet leise. »Ich glaube, er wird Freunde brauchen.«
»Auf mich kann er sich verlassen. Ich mag ihn«, sagte Robin nachdenklich.
Er legte den Arm um sie und seine Lippen auf ihren weichen Mund. Augenblicklich war die Welt für sie versunken, aber jäh wurden sie in die Wirklichkeit zurückgerissen. Es war jemand da, der Violet doch sofort erkannt hatte, und er stand jetzt dicht neben ihnen und starrte sie an.
»Wieso bist du hier, Violet!«, fragte Simon Terence erregt.
Violet war heftig erschrocken, aber das war schnell vorbei, denn Robins Arm legte sich gleich fester um ihre Schultern.
»Wieso bist du hier?«, fragte sie sarkastisch zurück. Sie spürte seine Unsicherheit und sah ihm fest in die Augen, aber er blickte schnell zu Boden, als könne er diesem Blick nicht standhalten.
»Vanessa liegt in dieser Klinik«, murmelte er. »Hat man dich benachrichtigt?«
»Nimm es an«, sagte sie. »Darf ich bekannt machen: Mr. Terence, Lord Dalton!«
Sie stieß es triumphierend aus, und Robin musste unwillkürlich lächeln.
»Violets zukünftiger Ehemann«, fügte er lässig hinzu.
Simons Augen verengten sich. »Eine ziemliche Überraschung«, sagte er.
»Aber doch wenigstens eine erfreuliche«, sagte Violet leichthin. »Erzähle, was passiert ist. Seit wann ist Vanessa in dieser Klinik?« Sie stellte sich unwissend, und es gelang ihr überzeugend. Robin bewunderte ihre Geistesgegenwärtigkeit, die ihm aber auch verriet, wie sehr sie Simon Terence misstraute.
»Ich weiß auch nicht«, erwiderte Simon. »Hat man dich nicht informiert?« Sein Blick war lauernd. »Die Polizei hat sich eingeschaltet. Sie wird hoffentlich alles aufklären. Leider durfte ich noch nicht zu Vanessa.«
Ob sie Harald zu ihr lassen?, fragte sich Violet. Wenn nicht, dann würde sie es versuchen. Schließlich war sie eine nahe Verwandte.
Sie war nun doch überrascht, als Simon sich sehr plötzlich verabschiedete. Er sei verabredet, sagte er.
»Du weißt ja, in welchem Hotel ich wohne, Violet. Vielleicht können wir uns heute Abend treffen. Lord Dalton, ich würde mich freuen.«
Was ist das für ein arroganter Bursche, dachte Robin. Was bildet er sich ein? Robin kehrte nicht gern den Lord heraus, und es war ihm auch ziemlich gleichgültig, zur Aristokratie zu gehören, aber diesem Terence musste er doch einen Ducker geben.
»Ich glaube nicht, dass wir Zeit haben«, sagte er kühl. »Es scheint hier eine ganze Menge aufzuklären zu geben.«
*
Sehr überrascht war auch Dr. Behnisch, als Harald Johanson plötzlich vor ihm stand. Also schien er kein schlechtes Gewissen zu haben und auch keine Schuldgefühle.
»Ich hoffe, Dr. Norden hat Sie von unserem Telefonat in Kenntnis gesetzt«, kam er gleich zur Sache. »Ich habe eine ganze Menge in Erfahrung gebracht, und wenn es möglich wäre, würde ich gern mit Miss Hunter sprechen.«
Ob das zu verantworten war? Dr. Behnisch überlegte. Vanessa war bei Bewusstsein. Er hatte heute Morgen schon mit ihr gesprochen, aber sie hatte ihm nur ausweichend Auskünfte gegeben. Er war nicht dahintergekommen, ob sie bewusst etwas verschweigen wollte, aber was er bisher erfahren hatte, war recht dürftig. Wenn es jedoch stimmte, dass sie an jenem
Abend Harald Johanson aufsuchen wollte, würde sie ihm vielleicht mehr sagen und vor allem, was sie bei ihm gewollt hatte.
»Warten Sie einen Augenblick. Ich werde nachsehen, wie es Miss Hunter geht«, sagte Dr. Behnisch. »Oder möchten Sie vorher Herrn Detloff einen Besuch machen?«
»Weiß er, dass seine Tochter hier ist?«, fragte Harald.
»Nein, bisher nicht. Wir hielten es für besser, es ihm zu verschweigen. Wir haben ihm nur gesagt, dass sie sich gemeldet hätte und ihn bald besuchen würde. Das hat ihn beruhigt.«
Dr. Behnisch ging in Vanessas Zimmer. Ihr war wieder so mancherlei durch den Sinn gegangen. Auch der helle Tag hatte keine Ruhe in ihre Gedanken gebracht.
»Herr Johanson möchte Sie gern besuchen, Miss Hunter«, sagte Dr. Behnisch vorsichtig, nachdem er sich überzeugt hatte, dass ihr Puls recht gleichmäßig ging.
»Harald Johanson?«, fragte sie.
Dr. Behnisch nickte. »Darf er kommen?«
»Ja«, erwiderte Vanessa nach kurzem Zögern.
Dr. Behnisch konnte es sich nicht versagen, noch ein paar Sekunden an der Tür stehenzubleiben, um Zeuge der Begrüßung zu werden. Er war jetzt sicher, dass diese beiden Menschen sich zum ersten Mal im Leben die Hände reichten.
»Sie sind Harald Johanson?«, fragte Vanessa staunend.
»In Lebensgröße«, erwiderte Harald lächelnd. »Wie geht es Ihnen?«
Wohl oder übel musste Dr. Behnisch nun doch den Rückzug antreten. Harald wurde jetzt verlegen.
»Wie unhöflich von mir, Ihnen nicht ein paar Blumen mitgebracht zu haben«, sagte er entschuldigend, »aber ich hole es nach. Ich komme geradewegs aus Schottland.«
»Von Schottland?«, fragte Vanessa erstaunt. »Wie das? Man sagte mir doch, dass Sie mich in diese Klinik gebracht hätten.«
»Eigentlich war das Dr. Norden«, erklärte Harald, »und als ich Sie vor meinem Hause fand, wusste ich nicht, dass Sie Vanessa Hunter sind. Ich suchte diese junge Dame in Hunter Cottage, stattdessen fand ich aber eine Violet.«
»Violet«, flüsterte Vanessa. »Sie wird sich sorgen.«
»Sie ist auch hier, und Sie werden sie bald sehen, aber ich denke, dass wir einiges miteinander zu besprechen haben, Vanessa. Es war doch kein Zufall, dass wir Sie vor meinem Hause fanden?«
Widersprüchliche Empfindungen verrieten ihr Mienenspiel. »Nein, es war kein Zufall«, erwiderte sie gequält. »Ich wollte Sie aufsuchen.«
»Darf ich den Grund erfahren? Es kann sehr wichtig sein, um diese rätselhafte Geschichte zu klären. Woher wussten Sie meinen Namen und meine Adresse?«
Ihre schlanken Finger verkrampften sich in der Bettdecke. »Ich kann nicht die richtigen Zusammenhänge finden«, flüsterte sie, »und schon gar keine Erklärung.«
»Vielleicht können wir das gemeinsam«, sagte Harald sanft.
Jetzt, da ihr Gesicht wieder etwas Farbe bekam, wurde die Ähnlichkeit mit ihrer Mutter noch deutlicher, und Harald fragte sich, was diese unbeschreibliche Ähnlichkeit für Gottfried Detloff bedeuten konnte.
»Darf ich Ihrem Gedächtnis ein wenig nachhelfen?«, fragte er. »Sie kamen in Begleitung von Simon Terence nach München, um Ihren Vater zu besuchen.«
Ihre Lider senkten sich. »Was wissen Sie von meinem Vater?«, fragte sie leise.
»Ich kenne ihn sehr gut und weiß, dass er sich große Sorgen um Sie macht. Er weiß allerdings noch nicht, was mit Ihnen geschehen ist. Sie wissen, dass Sie eine ganze Portion Gift in Ihrem Magen hatten, Vanessa? Wer hat es Ihnen eingeflößt?«
Ihre Mundwinkel zuckten. »Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern.«
»Ist es nicht so, dass Sie es nur nicht glauben wollen, dass es jemand gewesen sein könnte, den Sie gut kennen?«
Sie schluchzte leise auf. »Aber warum denn? Es gibt doch keinen Grund. Nein, ich finde keine Erklärung.«
Beruhigend nahm er ihre zarten Hände. »Sie dürfen sich nicht aufregen, Vanessa«, sagte er weich. »Es wird sich schon alles aufklären. Vielleicht fällt es Ihnen leichter, mit Violet zu sprechen. Aber vielleicht verraten Sie mir wenigstens, warum Sie mich aufsuchen wollten.«
»Weil meine Papiere verlorengegangen waren«, erklärte sie stockend und brachte ihn damit ziemlich aus der Fassung, bis sie hinzufügte: »Ich konnte Herrn Detloff nicht erreichen, und jemand sagte mir, dass Sie sehr gut mit ihm bekannt wären und auch sehr gute Beziehungen hätten.«
»Welcher jemand?«, entfuhr es ihm, und wieder senkte sie den Blick.
»Es war nicht zufällig Mr. Simon Terence!«, fragte Harald.
Sie machte eine heftige, abwehrende Handbewegung. »Sie kennen ihn?«, fragte sie bebend.
»Bisher nur aus der Entfernung, aber ich werde ihn sehr bald kennenlernen und er mich auch.« Er erhob sich. »Ich werde jetzt Violet zu Ihnen schicken.«
Sie schöpfte tief Luft. »Bitte noch nicht, Mr. Johanson, ich muss Ihnen noch einiges sagen.«
*
Simon machte einen gehetzten Eindruck, als er Margit aufsuchte. Von der Klinik aus war er gleich zu ihr gefahren, denn er sah keinen anderen Ausweg, als offen mit ihr zu sprechen. Was nämlich niemand von allen Beteiligten für möglich hielt, war Tatsache. Margit war völlig ahnungslos über die Zusammenhänge. Sie wusste nichts davon, dass Vanessa die Tochter ihres Vaters war, also ihre Stiefschwester. Sie wusste auch nicht, dass sie mit Simon verlobt war und erst recht nicht, welche zwielichtige Rolle Simon in diesem Geschehen spielte.
Lange konnte ihr dies jedoch nicht mehr verborgen bleiben, und so hatte sich Simon eine plausible Erklärung ausgedacht, die ihn nicht in einem schlechten Licht erscheinen lassen würde. Margits Zuneigung konnte seine Rettung sein. Er musste jetzt diese Chance nutzen.
»Was hast du denn?«, fragte Margit. »Warum bist du so nervös?«
Er raffte sich auf. Der Anfang fiel ihm schwer. »Ich habe Gewissensbisse, weil ich dir etwas verschwiegen habe, Margit«, sagte er.
Ihre Augen wurden schmale Schlitze. »Bist du verheiratet?«, fragte sie.
»Nein, aber ich war verlobt.« Er betonte »war« und wartete auf ihre Reaktion. Sie winkte lässig ab und lächelte. »Na und? Ich war ja auch beinahe verlobt. Ist das alles?«
Sie war in ihrem Selbstbewusstsein nicht zu erschüttern, aber Simon war sich auch durchaus bewusst, dass sie viel zu intelligent war, um sich mit Märchen zufriedenzugeben. Es gab nur eine Möglichkeit, sich ihre Loyalität zu sichern. Sie musste Angst bekommen, dass ihr das väterliche Erbe streitig gemacht würde.
»Bitte, höre mir mal zu«, sagte er schleppend. »Es fällt mir nicht leicht, dir diese Geschichte zu erzählen, die dich sehr treffen wird, aber es muss sein. Sonst müsste ich fürchten, dass man mich bei dir in Misskredit bringen wird.«
»Das klingt ja spannend«, sagte Margit ironisch.
»Ich war mit Vanessa Hunter verlobt«, sagte er.
»Vanessa Hunter?«, fragte Margit gedehnt.
»Dein Vater ist auch ihr Vater«, erklärte er und brachte sie damit erstmals aus der Fassung.
»Du bist verrückt!«, zischte sie.
»Es ist die Wahrheit. Bitte, höre mich an, Margit.«
Sie versuchte, ein blasiertes Lächeln aufzusetzen, aber es misslang ihr.
»Ich weiß es von Vanessa selbst«, sagte Simon betont.
»Und warum erfahre ich es dann erst jetzt?«, fragte Magit, bebend vor Wut.
»Dafür gibt es mehrere Gründe, die ich dir erklären werde. Als Entschuldigung für mich möchte ich dir aber vorerst sagen, dass ich nicht wissen konnte, dass du meine große Liebe werden würdest. Tatsächlich wollte ich deine Bekanntschaft machen, um Vanessa einen Gefallen zu tun.«
»So, das ist aber ein merkwürdiges Argument.«
»Vanessa wollte wissen, wie sie sich mit ihrer Stiefschwester arrangieren könnte, doch ich gelangte dann schnell zu der Überzeugung, dass sie nur ihre eigenen Vorteile im Auge hatte. Und als ich dich kennenlernte, war es sowieso um mich geschehen. Ich stand sofort auf deiner Seite. Und wenn ich dir jetzt sage, dass Harald Johanson anderen Sinnes wurde, weil Vanessa ihn umgarnte, wirst du mir wohl glauben, dass ich bisher schwieg, um dir Demütigungen zu ersparen.«
Dass diese Bemerkung falsch gewesen war, bekam er sofort zu spüren.
»Mich kann niemand demütigen. Ich bin meines Vaters Tochter«, sagte Margit scharf. »Die einzige Tochter, die berechtigt ist, den Namen Detloff zu führen. Aber bitte, erzähle deine merkwürdige Geschichte zu Ende. Ich bin jetzt sehr interessiert, mehr von dieser Vanessa Hunter zu erfahren.«
Simon wusste jetzt vor allem eines: Er musste gewaltig auf der Hut sein. Margit war gefährlich schlau.
»Also, Vanessa erfuhr erst nach dem Tod ihrer Mutter, wer ihr Vater ist. Diese Romanze spielte sich ab, als du schon auf der Welt warst, Margit. Dein Vater verstand es, sie geheimzuhalten. Anscheinend hat er beträchtliche Schweigegelder gezahlt.
Natürlich war Vanessa zuerst schockiert, aber dann sagte sie sich, dass sie sich beträchtliche Vorteile ausrechnen könnte, wenn sie ihren reichen Papa unter Druck setzen würde. Mir gegenüber drückte sie sich allerdings nicht so deutlich aus, aber sie bat mich, sie nach München zu begleiten, was ich auch tat. Unterwegs las sie dann in einer Zeitung von deiner bevorstehenden Verlobung mit Harald Johanson, und das muss sie dann veranlasst haben, ihre Pläne zu ändern. Als wir in München ankamen, erklärte sie mir, dass sie ihre eigenen Pläne habe und wir uns vorerst trennen sollten. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Sie ging ihre eigenen Wege, suchte wohl die Bekanntschaft mit Harald Johanson, und ich erfuhr erst wieder von ihr, als mir bekannt wurde, dass sie das Mädchen war, das vor seiner Wohnung zusammengebrochen und in die Behnisch-Klinik eingeliefert worden war.«
»Sie ist dieses Mädchen?«, fragte Margit, um dann in Nachdenken zu versinken. »Eine sehr interessante Geschichte, Terry«, sagte sie dann, »sie hat nur einen Fehler.«
»Welchen Fehler? Glaubst du mir nicht?«
»Nein, ich glaube dir nicht«, erwiderte Margit eisig. »Ich sagte dir damals, dass Papa von einer Vanessa gesprochen hat, und da hast du überhaupt nicht reagiert. Ich kann mich genau erinnern. Du hast nur gesagt, dass er ja eine Geliebte haben könnte. Meinst du nicht, dass an jenem Tag der Zeitpunkt gewesen wäre, mir diese Geschichte zu erzählen?«
»Ich wollte dich nicht erschrecken, Margit«, sagte Simon erregt.
Sie lachte blechern auf. »Ich traue keinem Mann. Ich traue auch dir nicht. Weißt du, wenn man als reiches Mädchen heranwächst, und wenn man etwas Verstand hat, wittert man hinter jedem Mann, der einem Komplimente macht, einen Mitgiftjäger. In Harald brauchte ich einen solchen nicht zu vermuten. Er hat selbst genug Geld. Aber wie steht es mit deinem Bankkonto? Würdest du mir das einmal klarlegen?«
»Margit, wie kannst du so sprechen?«, rief er empört aus.
»Bei mir gibt es die ganz große Liebe nicht, Terry, oder sagen wir besser Simon. Ich gehöre nicht zu den dämlichen Frauen, die sich ausnehmen lassen. Wenn ich so recht überlege, gefällt mir an deiner Geschichte so manches nicht. Ich würde gern erst einmal Vanessa Hunters Version hören. Aber noch besser erscheint es mir, jetzt die Polizei zu benachrichtigen, um ihr mitzuteilen, um wen es sich bei dem Mädchen handelt, das man vor Haralds Tür gefunden hat, und ich bin auch gespannt, was er dann dazu zu sagen hat.«
Simon war auf sie zugestürzt und griff nach ihren Armen.
»Rühr mich nicht an!«, schrie sie ihn an, und in ihren Augen brannte jetzt heißer wilder Zorn. Sie waren nicht mehr kalt, und fast konnte man auch Verzweiflung auf ihrem Blick lesen, als sie nun seinem drohenden Blick begegnete. Sie wehrte sich verzweifelt, als seine Hände ihre Arme umklammerten und dann zu ihrem Hals glitten, aber er entwickelte eine Kraft, die sie nie in ihm vermutet hätte, und ein fernes Läuten war das letzte, was sie vernahm.
*
Violet musste sich lange gedulden, aber zum Glück war ja Robin bei ihr, der fest und beruhigend ihre Hände umschloss.
Sehr lange hatten Harald und Vanessa miteinander gesprochen, und mit jedem Wort rückten sie einander näher. Es war beiden unbegreiflich, dass sie so schnell miteinander vertraut wurden.
Harald hatte nur den einen Wunsch, diesem zarten, hilflosen kleinen Mädchen schützend zur Seite stehen zu können, damit sie einen Weg aus ihren Gefühlsverwirrungen finden könnte.
Er hatte ihr erklärt, dass Gottfried Detloff ein aufrechter, ehrlicher Mann sei und sich sehnlichst wünsche, sie in seine Arme zu schließen. Vorsichtig hatte er ihr auch gesagt, dass er in der Angst um sie den Herzanfall bekommen hatte.
Lange dachte Vanessa nach.
»Ich hatte niemals Freunde«, sagte sie. »Mummy und ich lebten mit Laura so friedlich. Mit Violet verstand ich mich immer gut. Auf einem Erntefest lernte ich dann Simon kennen, aber Mummy sagte, ich solle mir Zeit lassen mit einer Bindung. Nach ihrem
Tod …«, da schluchzte sie leise auf.
Harald ahnte, wie tief der Verlust der Mutter sie schmerzte.
»In dieser Zeit kam Simon oft, und wir verlobten uns dann.«
Sie blickte auf ihre Hände. »Ich weiß nicht, was ich denken soll. Meine Papiere sind verschwunden und meine Ringe auch. Ich kann mich nicht erinnern, wann das geschah. Ja, ich habe mich mit Simon getroffen. Das ist das letzte, woran ich mich erinnern kann.« Sie war erschöpft. Jedes Wort wurde ihr zur Qual, und nun kam Dr. Behnisch und sagte sehr energisch, dass die Patientin keinesfalls überfordert werden dürfe.
Aus schwimmenden Augen sah Vanessa Harald an. »Vielleicht kommen Sie morgen wieder«, flüsterte sie. »Wenn Sie Zeit haben.«
»Ich werde immer Zeit für Sie haben, Vanessa«, sagte Harald. Dann ging er mit dem Arzt hinaus.
»Hoffentlich haben Sie mir das Mädchen nicht zu sehr aufgeregt, Herr Johanson«, sagte Dr. Behnisch. »Und hoffentlich bekommen Sie keinen Schrecken, wenn ich Ihnen sage, dass ein Kriminalkommissar Sie erwartet.«
»Ich habe nichts zu fürchten«, sagte Harald ruhig. »Es wird Zeit, dass diesem bösen Spiel ein Ende bereitet wird. War Margit heute schon hier?«
»Nein«, erwiderte Dr. Behnisch irritiert.
»Dann wird der Herr Kommissar vielleicht einverstanden sein, wenn wir sie gemeinsam aufsuchen«, sagte Harald. »Sagen Sie bitte Miss Violet Hunter und Lord Dalton nichts davon, dass mich die Polizei in Obhut nimmt.«
*
Dr. Behnisch hatte Violet und Robin zu sich bitten lassen. Währenddessen verließ Harald mit dem Kommissar, den er als einen recht freundlichen Mann kennenlernte, die Klinik.
Zur gleichen Zeit klingelte in Dr. Nordens Praxis wieder einmal das Telefon, nachdem Molly den Hörer kaum aus der Hand gelegt hatte.
Sie nahm ihn wieder ans Ohr. »Dr. Norden, schnell«, tönte eine bebende Stimme an ihr Ohr.
Es war eine schwache ängstliche Stimme. Molly zögerte nicht eine Sekunde, sie stellte durch.
Daniel Norden hatte gerade einen Patienten behandelt. Er seufzte, als er den Hörer aufnahm. Heute war die Hölle los!
Aber sofort war er hellwach. »Margit Detloff hier, helfen Sie mir«, vernahm er, dann brach die Verbindung ab.
Es war ein Hilfeschrei. Dr. Norden überlegte nicht eine Sekunde.
Er stürmte an Molly vorbei. »Sagen Sie meiner Frau Bescheid, ich fahre zu Fräulein Detloff«, rief er ihr zu.
Fee war im Labor. Sie vernahm die Stimme ihres Mannes, aber als sie in die Diele kam, war er schon weg.
»Scheint sehr dringend gewesen zu sein«, sagte Molly. »Die Stimme von Fräulein Detloff klang auch sehr schwach. Und das Wartezimmer ist noch voll«, fügte sie nach einer kleinen Pause hinzu.
»Na, dann fragen Sie mal, wer mit mir vorliebnimmt, Molly«, sagte Fee mit einem flüchtigen Lächeln. Aber ihre Gedanken waren bei ihrem Mann und Margit Detloff. Was konnte mit ihr sein? War sie von der Grippe erwischt worden?
Zeit blieb Fee nicht zum Nachdenken. Die Patienten hatten anscheinend nichts mehr dagegen, von ihr behandelt zu werden.
*
Als Dr. Norden das Haus der Detloffs erreichte, sah er den Butler Jonathan vor der Tür stehen, der gerade die Haustür aufschloss.
Bestürzt sah ihn der Mann an. »Was ist denn, Herr Doktor?«, fragte er. »Herr Detloff ist doch noch in der Klinik.«
»Fräulein Detloff hat mich angerufen. Machen Sie schnell, Mann, es scheint ihr sehr schlecht zu gehen.«
»Heute Morgen ging es ihr aber noch gut«, sagte Jonathan, »und ich sollte vor ein Uhr gar nicht zurück sein.«
Er hatte die Tür aufgeschlossen. Daniel drängte sich an ihm vorbei.
»Fräulein Detloff!«, rief er laut.
»Hier«, tönte eine heisere Stimme an sein Ohr. Jonathan war mit den
Räumlichkeiten besser vertraut. Jetzt öffnete er gleich die richtige Tür, und Daniel sah Margit am Boden liegen. Ihr Gesicht war verschwollen, bläulich angelaufen. Mühsam rang sie noch immer nach Luft, wenn sie etwas sagen wollte, aber ihre Erregung war zu groß, als dass sie ein verständliches Wort über die Lippen bringen konnte.
Dr. Norden gab ihr erst eine kreislaufbelebende Spritze, dann hob er sie empor und bettete sie auf das Sofa.
Mehr im Unterbewusstsein stellte er fest, dass sie aussah wie ein Boxer, der von seinem Gegner zusammengeschlagen worden war. Hübsch sah sie jedenfalls nicht aus, und wenn er auch nie etwas für sie übrig hatte, so empfand er jetzt doch Mitgefühl mit ihr.
»Was ist geschehen?«, fragte er.
»Simon«, flüsterte sie. Dann strömten Tränen über ihre Wangen, unaufhaltsam wie das Schluchzen, das sie schüttelte. In dieses Schluchzen hinein tönte der Gong, aber Daniel hörte ihn nicht. Er blickte erst auf, als Harald an der Seite eines fremden Mannes im Zimmer erschien.
»Was ist, Margit?«, fragte Harald bestürzt.
Verwirrt sah sie ihn an, schüttelte dann aber nur immer den Kopf wie eine aufgezogene Puppe.
»Allem Anschein nach ist Fräulein Detloff überfallen worden«, sagte Daniel. »Sie muss jetzt absolute Ruhe haben.«
»Es war Simon«, stieß Margit hervor. »Ich will alles sagen …«, aber weiter kam sie nicht. Ohnmächtig sackte sie zusammen.
»Simon Terence«, sagte Harald zu dem Kommissar. »Suchen wir ihn?«
»Wo?«, fragte der Kommissar.
»Zuerst im Hotel. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät.«
»Harald«, sagte Daniel Norden, »sind Sie in Schwierigkeiten?«
»Damit werde ich schon fertig«, erwiderte Harald. »Passen Sie bitte auf Margit auf.«
Fünf Minuten später ging Dr. Norden zum Telefon und rief wieder einmal die Behnisch-Klinik an.
Er wurde mit Jenny Lenz verbunden. »Haben Sie auch noch ein Bett für Margit Detloff, Frau Doktor?«, fragte er mit einem Anflug von Galgenhumor.
»Du machst mir Spass, Daniel«, erwiderte Jenny Lenz. »Wir sind überbelegt.«
»Sie wird nicht lange bleiben müssen«, sagte er.
»Was fehlt ihr denn?«, fragte Jenny.
»Beinahe wäre sie erwürgt worden«, erwiderte er.
»Aber sonst geht es dir gut«, sagte Jenny.
»Mir schon«, erwiderte Daniel trocken, »aber ihr nicht so sehr.«
»Na, dann bring sie her.«
*
»Ich habe mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun, Herr Kommissar«, sagte Harald auf der Fahrt zu Simons Hotel.
»Gar nichts?«, fragte der Mann am Steuer freundlich.
»Na, sagen wir mal, dass ich nicht der Bösewicht bin, den Sie suchen.«
»Wenn das so wäre, würden wir nicht ohne Begleitung fahren. Übrigens heiße ich Schmidt. Schlicht und einfach Schmidt.«
Harald warf ihm einen schrägen Blick zu. »Das kann ich mir wenigstens merken, falls ich später mal Ihren Beistand brauche, Herr Kommissar.«
»Schmidt«, sagte der andere schmunzelnd.
»Herr Schmidt«, sagte Harald, »habe ich Ihnen nicht gleich gesagt, dass man den Schlüssel zur Lösung des Rätsels bei Mr. Terence suchen sollte?«
»Wir werden ihn dort suchen. Sie, Herr Johanson, und ich. Aber Sie haben auch Verdacht gegen Fräulein Detloff gehegt.«
»Ich gebe es zu«, erwiderte Harald nachdenklich. »Ich gebe auch zu, dass ich mich anscheinend doch getäuscht habe.«
»Ist das nun eine Liebesgeschichte mit kriminalistischem Einschlag, oder ein Krimi um Liebesaffären?«, fragte Kommissar Schmidt.
»Vielleicht können wir uns eine Definition ersparen, wenn es doch noch ein gutes Ende gibt«, sagte Harald gedankenvoll.
»Wie stellen Sie sich dieses vor?«
»Muss ich das gleich beantworten?«
»Es wäre ganz interessant.«
»Nun, von meinem Standpunkt aus gesehen, wäre es erfreulich, wenn Gottfried Detloff seine Tochter Vanessa bald gesund in die Arme schließen könnte und Margit sich mit dem Gedanken versöhnen würde, eine Schwester zu haben.«
»Und welche Rolle gedenken Sie zu spielen, wenn es so käme?«
»Ich? Gar keine. Ich gehe auf meine geplante Safari, und wenn ich dann zurückkomme, werde ich mich um den Konzern kümmern.«
»Abschied vom Playboy?«, fragte der Kommissar.
»Der fällt mir nicht schwer.«
»Und doch eine Heirat mit Margit Detloff?«
»Nein, niemals. Ich werde es mir reiflich überlegen, ob ich jemals heirate.«
»Dabei kommt es immer auf die Frau an«, sagte Kommissar Schmidt. »Ich war auch ein eingefleischter Junggeselle, bis mir die Richtige über den Weg lief. Jetzt haben wir drei Kinder, und ich bin restlos glücklich.«
Die richtige Frau, dachte Harald, und er konnte es sich nicht erklären, warum er nun plötzlich Vanessa vor sich sah. Aber da waren sie schon bei dem Hotel angelangt, und jetzt dachte er ganz schnell wieder an Simon Terence.
*
Im Hotel erlebten sie eine Enttäuschung. Mr. Terence wäre soeben abgereist. Ja, gerade vor zehn Minuten hatte er das Hotel verlassen.
»Und die Rechnung beglichen?«, fragte der Kommissar.
»Selbstverständlich«, wurde ihm mit einem pikierten Blick erwidert, als wäre es unglaublich, an Mr. Terences Ehrenhaftigkeit zu zweifeln.
»Er scheint sehr beeindruckend zu sein«, meinte der Kommissar spöttisch.
»Er wirkt auf Frauen, und wir haben eben mit einer jungen Dame gesprochen«, sagte Harald. »Was nun?«
Doch die weitere Arbeit konnte er getrost der Polizei überlassen. Von ihm wollte niemand mehr etwas. Kommissar Schmidt erkundigte sich nur, ob Harald in München bleiben würde. Er versprach es mit einem anzüglichen Lächeln.
»Ich bin viel zu neugierig, um mir die Aufklärung dieses Falles entgehen zu lassen«, sagte er.
»Ist es ein Fall?«, fragte der Kommissar. »Handelt es sich da nicht nur um etwas zu heftige interne Auseinandersetzungen? Ein Fall wäre es allerdings, wenn Miss Hunter bestätigte, dass ihr das Gift von einem Dritten eingegeben wurde, und wenn bewiesen wird, dass Terence Fräulein Detloff angegriffen hat.«
»Na, solche Verletzungen kann sie sich doch wohl kaum selbst beibringen«, meinte Harald.
»Was meinen Sie, was Frauen alles fertigbringen, wenn sie sich an einem Mann rächen wollen. Sie ahnen gar nicht, was wir schon alles erlebt haben.«
Harald hatte wieder etwas dazugelernt. Irgendwie waren ihm Frauen ja immer rätselhaft gewesen. Entweder in der Art, wie sie einen Mann umgarnen wollten, auch wenn er ihnen zu verstehen gab, dass er kein Interesse an ihnen hatte, oder auf welche raffinierte Weise sie einem Geld aus der Tasche locken konnten. Dann gab es auch jene übersensiblen, die gleich losheulten, wenn man mal einen Spass machte.
Ja, und schließlich gab es auch noch solche wie Violet oder Vanessa, die ihm ein ganz anderes Bild vom Rätsel Weib vermittelten.
Wie konnte sich ein so zurückhaltendes, zartbesaitetes Mädchen wie Vanessa mit einem solch abgebrühten Halunken abgeben, dem man den Verführer schon auf meterweite Entfernung ansah?
Harald merkte gar nicht, dass er ganz ungerecht wurde in seiner Chrakterisierung, denn anfangs hatte er Simon Terence durchaus nicht so hart beurteilt.
Nun ja, zu Margit hatte er irgendwie gepasst, aber doch nicht zu Vanessa.
Ganz empört hatte sie ihn angesehen, als er sie fragte, ob sie denn nie allein mit Simon im Hotel gewesen wäre oder anderswo.
Nie zuvor hatte eine Frau so sehr die ritterlichen Instinkte in ihm geweckt wie Vanessa, noch nie hatte er sich in Gedanken so viel mit einem Mädchen beschäftigt und überlegt, wie er ihr eine Freude machen könnte und helfen, die Zweifel, die sie quälten, auszuräumen.
Er fuhr jetzt erst einmal in seine Wohnung, und dort fand er eine Nachricht von Dr. Endres vor.
Es waren zwei knappe Sätze:
Versuche dauernd, Sie telefonisch zu erreichen, vergeblich. Muss Sie dringend sprechen. Endres.
Er rief ihn an und wurde sofort mit ihm verbunden. Er vernahm ein erleichtertes »Endlich!« Dann fragte ihn Dr. Endres, ob er wohl sofort zu ihm kommen könne.
Er konnte! Er fuhr sogleich los und war eine Viertelstunde später bei dem Anwalt. Zuerst musste er sich einen Vorwurf anhören. »Ich habe gedacht, Sie würden sich sofort nach Ihrer Rückkehr bei mir melden, Herr Johanson«, sagte Dr. Endres.
»Ich bin nicht allein gekommen, sondern in Begleitung von Miss Violet Hunter und Lord Dalton. Wir sind sofort zur Klinik gefahren, und seither bin ich kaum zum Luftholen gekommen. Die Ereignisse überstürzten sich.«
»Ist schon wieder etwas passiert?«, fragte der Anwalt betroffen.
»Erzählen Sie erst. Was gibt es Dringendes?«
»Ich brauche Ihren Rat.«
»Sie meinen? Ich bin kein Anwalt.«
»Und Ihre Unterstützung. Außerdem volle Diskretion. Detloff will sein Testament ändern. Margit soll nur das Pflichtteil bekommen, alles andere Vanessa Hunter. Sie haben mehr Einfluss auf Herrn Detloff. Ich finde diese Entscheidung nicht gerecht. Mag ihm auch manches nicht an Margit passen, aber immerhin ist sie die ältere und eheliche Tochter. Sie müssen mit ihm sprechen, Herr Johanson. Morgen soll ich zu ihm in die Klinik kommen. Natürlich kann ich mich nicht weigern, das Testament so abzufassen, wie er es wünscht, aber es geht mir gegen den Strich. Jede die Hälfte, ja, aber so darf er mit Margit nicht umspringen.«
Der alte Herr war richtig aufgeregt. Harald war es jetzt auch ziemlich unbehaglich. Was war denn zwischen Gottfried Detloff und Margit vorgefallen, dass er plötzlich so unerbittlich hart war?
»Wenn er nicht krank wäre, hätte ich ihm empfohlen, einen anderen Anwalt zu nehmen, aber ich möchte nicht schuld sein, wenn er einen Rückfall bekäme … Aber das ist nicht alles. Heute Vormittag suchte mich ein Mr. Simon Terence auf, der eine Vollmacht vorlegte, dass er berechtigt sei, Miss Vanessa Hunters Ansprüche an Herrn Detloff geltend zu machen. Was sagen Sie dazu?«
»Aufgelegter Schwindel!«, stieß Harald barsch hervor. »Dieser Mann ist ein Gauner.«
Irritiert sah ihn Dr. Endres an. »Diesen Eindruck machte er nicht. Er ist außerdem Anwalt.«
»So? Haben Sie sich seine Legitimation zeigen lassen?«
»Selbstverständlich. Es war alles in Ordnung. Er ist in England als Anwalt zugelassen.«
»Wenn das stimmt, ist er ein Winkeladvokat. Nichts gegen Ihren Beruf, Dr. Endres, Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze, aber dieser Terence ist mit allen Wassern gewaschen. Eins weiß ich gewiss: Vanessa Hunters Interessen vertritt er nicht!«
»Aber ein bisschen deutlicher könnten Sie mir doch alles erklären«, seufzte der alte Herr.
Harald blieb nichts anderes übrig, obgleich er viel lieber in die Behnisch-Klinik gefahren wäre, um sich nach Vanessas Befinden zu erkundigen und ihr nun noch die Blumen zu bringen, die er ihr versprochen hatte.
Dr. Endres wunderte sich sehr, als Harald bat, telefonieren zu dürfen, und als er dann den Auftrag gab, einen Strauß rosa Rosen und Parmaveilchen zu Vanessa Hunter in die Behnisch-Klinik zu bringen, bevor der Laden geschlossen wurde. Es war nämlich gleich sechs Uhr. Der Tag war dahingegangen wie ein Sturmwind.
Aber nun erfuhr Dr. Endres doch ganz genau, was Harald alles erlebt und erfahren hatte.
*
Daniel und Fee Norden waren in ihrer Praxis so beansprucht, dass sie keine Gedanken an Gottfried Detloff und Vanessa verschwenden konnten. Sie hatten auch nichts mehr gehört, und ganz beiläufig hatte Daniel mittags bemerkt, dass sich wohl alles in Wohlgefallen auflösen würde und sie diesmal nicht in den Mittelpunkt des Geschehens gedrängt würden. Das konnte ihnen nur recht sein. Sie hatten schon oft genug eine unerwünschte Publicity erfahren.
Dramatische Schicksale hatte Fee auch in der Zeit erlebt, als sie noch bei ihrem Vater auf der Insel der Hoffnung mitarbeitete, obgleich man sich in einem Sanatorium wie diesem nur geruhsames Leben vorstellte.
Doch wie selten verlief das Leben problemlos, blieb eine Familie von Schicksalsschlägen verschont. Ein Arzt, der nicht nur an seinen Verdienst dachte, wurde halt unwillkürlich Mitleidender, ebenso wie er auch die Freuden seiner Patienten gern einmal teilte.
Wenn Fee auf den Karteischrank blickte, der auch die Krankengeschichten von den zahlreichen Patienten in sich barg, wurde ihr manchmal ganz mulmig, denn mindestens die Hälfte erzählte von einem schweren Schicksal.
Die anderen Patienten, die kamen, weil sie viel Zeit hatten und ihre Krankheiten intensiv pflegen ließen, wurden meist sehr alt. Und die anderen, die vorübergehenden Schmerz als läppisch abtaten und sich stark genug fühlten, um selbst damit fertig zu werden, waren sich nicht bewusst, dass sie oftmals selbst Schuld trugen an einem hartnäckigen, verschleppten Leiden, das dann zu einem unheilbaren wurde.
Solchen Gedanken gab sich Fee hin, als sie die Krankengeschichte von Herrn Ackermann studierte, diesem netten alten Herrn, der ihr jedesmal ein paar Blumen aus seinem Garten mitbrachte, der ganz Kavalier der alten Schule war. Vor einem Jahr war er zum erstenmal zu Daniel gekommen.
Da waren sie noch nicht verheiratet gewesen, aber Herr Ackermann schon ein Todeskandidat. Wie tapfer er mit seinem Leiden fertig wurde, war erschütternd. Gerade heute hatte er zu Fee gesagt: »Liebe Frau Doktor, gern würde ich noch einige Wochen auf die Insel der Hoffnung gehen. Aber es soll ja so schön dort sein, dass man an das Leben glaubt, und …«
»Kein Aber, Herr Ackermann«, hatte Fee gesagt. »Wir fahren am Wochenende hinaus zur Insel. Endlich einmal wieder, und wir nehmen Sie ganz einfach mit.«
»Ganz einfach?«, hatte er mit seinem gütigen Lächeln gefragt.
»Wir holen Sie am Morgen ab, und in zwei Stunden sind Sie dort. Keine beschwerliche Bahnfahrt muss Sie schrecken.«
Und dann hatte er sie angesehen mit einem Blick, der ihr ins Herz schnitt. »Und wenn ich die Insel in einem Sarg verlasse?«, hatte er gefragt. »Nichts sagen, liebe, verehrte Frau Doktor. Ich bin fünfundsiebzig, und es kann genug sein. Es ist schlimmer, wenn die Jungen vor einem gehen müssen.«
Er hatte beide Söhne, die sein ganzer Stolz gewesen waren, blutjung verloren. Seiner Frau hatte es das Herz gebrochen. Er hatte mit dem Schmerz weiterleben müssen und dann auch mit seinem Leiden.
»Wir werden Sie mitnehmen, Herr Ackermann«, hatte Fee gesagt.
Heute war nun Dienstag, und sie hoffte, dass bei ihnen nur ja nichts dazwischenkommen würde, nichts Ungewöhnliches, was nicht vorauszusehen war, um dieses alten Herrn willen, dessen Augen so aufgeleuchtet hatten, als sie ihm die Hand gab, die er ritterlich an die Lippen gezogen hatte.
Sie wollte den Hörer abnehmen, um ihren Vater anzurufen und ihm Bescheid zu sagen, dass sie einen Gast mitbringen würden, als das Telefon läutete. Sie erschrak und meldete sich mit unsicherer Stimme.
Am anderen Ende war Dr. Behnisch. »Ihr habt euch den ganzen Tag nicht gerührt, Fee«, sagte er.
»Bei uns war ein Mordsbetrieb«, erklärte sie.
»Hier auch, aber ich habe eben mit Herrn Detloff gesprochen. Er will Anfang nächster Woche mit seiner Tochter auf die Insel der Hoffnung fahren. Ist das möglich zu machen?«
»Mit welcher Tochter?«, fragte Fee benommen.
»Mit Vanessa natürlich. Margit hat er abgeschrieben, wie es scheint, aber er weiß noch nicht, dass sie ihn mehr denn je braucht.«
»Geht es ihr so schlecht?«, fragte Fee, die von ihrem Mann nur kurz über den bösen Zwischenfall unterrichtet worden war.
»Totaler Zusammenbruch, aber sie wird schon wieder, wenn jemand sie aufrichtet. Wir hätten uns viel zu erzählen. Könnt ihr heute Abend nicht zu mir kommen?«
»Ich glaube nicht, dass etwas daraus wird«, erwiderte Fee, »aber wenn es möglich ist, rufe ich noch mal an. Daniel ist sehr im Druck.«
*
Violet war schon einige Stunden bei Vanessa, allein, ohne Robin. Sie wollte es der Cousine schonend beibringen, dass sie per Zufall den Mann fürs Leben kennengelernt hatte, und dass dies wohl nicht geschehen wäre, wenn sie nicht nach Vanessa gesucht hätte.
Robin hatte volles Verständnis dafür. Bei dieser Gelegenheit konnte er in München gleich noch einiges erledigen, aber als er nach ein paar Stunden wieder zur Klinik kam, um Violet abzuholen, war sie noch immer bei Vanessa.
Selbst Violet war es nicht leichtgefallen, Vanessa die Zunge zu lösen, aber da sie sich von Kindheit an kannten und sie sich gut in Vanessas derzeitige seelische Verfassung einfühlen konnte, erfuhr sie dann doch, was sie wissen wollte.
Empörung und Zorn gegen Simon brodelten in ihr, heißes Mitgefühl mit Vanessa war dann aber stärker.
»Wie konnte er mir etwas antun wollen?«, fragte Vanessa, von trockenem Schluchzen geschüttelt. »Ich habe ihm doch nichts getan, Violet. Ich habe nur gesagt, dass ich mich erst damit abfinden muss, dass ich einen Vater habe und Zeit brauche, mich daran zu gewöhnen.«
»Aber es hatte dich in Bestürzung versetzt, dass er dir einsuggerieren wollte, wie du deine Vorteile nützen könntest«, stellte Violet fest. »Du hast plötzlich erkannt, wie materiell er eingestellt ist.«
»Ich sah ihn mit anderen Augen«, gab Vanessa zu. »Es erschien mir so hinterhältig und schäbig, wie er über diesen Mann sprach, und es wäre doch glatte Erpressung gewesen, wenn ich getan hätte, was er von mir verlangte.«
»Und da hat er den Spieß umgedreht, sich an Margit Detloff herangemacht, sich Chancen bei ihr ausgerechnet. Da warst du ihm im Wege.«
Es klang hart, aber Vanessa war jetzt schon bedeutend ruhiger geworden und hatte auch begriffen, dass es zwecklos war, sich solche Absicht ausreden zu wollen.
»Aber warum hast du dich nicht mit Herrn Detloff in Verbindung gesetzt und dich stattdessen mit Simon getroffen!«, fragte Violet.
»Ich habe mehrmals versucht, Herrn Detloff anzurufen«, erklärte Vanessa, »aber ich konnte ihn nicht erreichen. Dann sah ich ganz zufällig Simon mit einem sehr attraktiven Mädchen, und als ich zu Detloffs Villa gefahren war, sah ich beide wieder. Gemeinsam betraten sie das Haus. Ich ahnte, dass das Mädchen Margit Detloff war, aber ich wusste noch immer nicht, was ich davon halten sollte. Und da traf ich mich mit Simon, um ihm zu sagen, dass es besser wäre, wenn wir unsere Verlobung lösten. Wir haben uns sehr lange unterhalten. Er hat gesagt, dass er meine Interessen im Auge hätte, und dass Margit Detloff mit Harald Johanson verlobt wäre. Es würde wohl das Beste sein, wenn wir uns alle zusammensetzten.«
»Und dann?«, fragte Violet.
»Dann sind wir zu Herrn Johanson gefahren. Mir war schwindlig, als ich aus dem Wagen stieg.«
»Wo bist du aus dem Wagen gestiegen?«
»Vor dem Haus, in dem Harald wohnt.«
»Simon hat dich dorthin gefahren?«, fragte Violet verwundert.
»Nicht ganz. Man kann dort nicht parken. Er sagte, dass mir die frische Luft guttun würde. Er wollte den Wagen auf den Parkplatz fahren. Aber dann wurde mir so schlecht. Ich fühlte mich so schwach, und Simon kam nicht. Da habe ich mit letzter Kraft geläutet. Ich finde keine Erklärung für dies alles, Violet.« Es klang fast wie ein Aufschrei.
»Und ich frage mich, warum er dich zu Harald gebracht hat«, sagte Violet erregt. »Dafür gibt es nur die eine Erklärung, dass er durch dich in Schwierigkeiten gebracht werden sollte.«
»Aber aus welchem Grund?«, fragte Vanessa.
»Wahrscheinlich, damit er ihm bei Margit Detloff nicht in die Quere kommen könnte. Es gibt keine Entschuldigung für ihn, Vanessa. Du hast keinen Grund, etwas zu verschweigen, um Simon zu decken. Er wollte dich umbringen. Er rechnete nicht damit, dass du mit dem Leben davonkommen würdest, und wer hätte ihm dann eine Schuld nachweisen können? Dieser Schuft, wie abgebrüht er ist.« Sie nahm Vanessas Hand. »Du wirst jetzt nicht verzweifeln, mein Liebes. Du bist eine Hunter. Denk an deine Mutter. Sie war eine großartige Frau, und du hast einen Vater, der ein ehrenwerter Mann ist, du hast mich und Freunde.«
»Freunde?«, fragte Vanessa tonlos, und da kam Schwester Maria herein und brachte ihr das wunderschöne Blumengebinde aus Veilchen und zartrosa Rosen. Vanessas Augen weiteten sich, aber auch Violet war einen Augenblick überrascht. Doch sie ahnte, wer diese Blumen geschickt hatte, obgleich keine Karte dabei war.
»Hat sich Harald etwa nicht als Freund erwiesen?«, fragte sie, als Schwester Maria das Zimmer wieder verlassen hatte. »Die Welt hat sich nicht verändert, Vanessa. Sie ist so gut und auch so schlecht wie eh und je. Dein Leben wird sich jetzt verändern. Du bist nicht mehr das kleine unerfahrene Mädchen von Hunter Cottage. Du hast eine schlimme Erfahrung gemacht, aber daran wirst du nicht zerbrechen. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich. Du wirst dich ihrer würdig erweisen. Da wartet ein Mann auf dich, der sich so um dich sorgte, dass er einen Herzanfall bekam. Dieser Mann ist dein Vater, den es sehr schmerzt, dass er dich nicht früher in die Arme schließen konnte.«
»Warum hat Mummy mir und auch ihm gegenüber geschwiegen?«, fragte Vanessa.
»Weil sie meinte, dass dies die richtige Entscheidung wäre. Sie war eine stolze Frau. Sie hat diesen Mann sehr geliebt, aber sie wollte ihn nicht an sich ketten. So, und nun ruhst du dich erst einmal aus. Morgen besuche ich dich mit Robin.«
Sie gab Vanessa einen zärtlichen Kuss und bemerkte zu ihrer Erleichterung, wie sich deren Gesicht entspannte.
»Du wirst schlafen, meine Liebe, und du wirst nicht mehr an Simon denken. Dieses Kapitel ist abgeschlossen.«
*
Robin atmete erleichtert auf, als er Violet kommen sah. Er nahm ihre Hände und drückte sie an seine Brust.
»War es sehr schlimm, Liebes!«, fragte er leise.
»Ich fürchte, dass ich ziemlich hart mit Vanessa umgesprungen bin, aber sie ist eine Hunter, und in unserer Familie gibt es keine Schwächlinge.«
Er musste fast lächeln. Es klang zu forsch, um ganz ihrer inneren Überzeugung zu entspringen, und er sah ihr an, dass sie sehr mitgenommen war.
»Morgen werden wir Vanessa gemeinsam besuchen«, sagte Violet rasch, als Harald durch den Eingang trat. Er sah blass und ernst aus, und seine erste Frage galt Vanessas Befinden, dabei gab es doch immerhin noch zwei Menschen in dieser Klinik, die er länger kannte.
Was mochte ihm Margit bedeutet haben, fragte sich Violet. Stockend erzählte sie ihm, was sie in Erfahrung gebracht hatte. Er wurde noch blasser.
»Wenn ich ihn zu fassen bekomme, wird er nichts zu lachen haben«, sagte er grimmig. Und das glaubten ihm Violet und Robin aufs Wort.
»Heute Abend werden wir uns doch nicht mehr sehen«, sagte Harald dann nachdenklich. »Würden Sie morgen zum Mittagessen meine Gäste sein?«
»Wir werden morgen Vanessa besuchen«, erwiderte Violet.
»Dann treffen wir uns hier. Mein Stammlokal ist ganz in der Nähe, und ich kann Ihnen versprechen, dass es Ihnen dort schmecken wird.«
»Dann verraten Sie es uns gleich, Harald«, sagte Robin. »Es lässt sich nicht verheimlichen, dass wir hungrig sind.«
Harald beschrieb es ihnen. Sie verabschiedeten sich wie gute alte Freunde, und das waren sie auch schon geworden. Arm in Arm gingen Robin und Violet hinaus in die Dunkelheit.
Vom Parkplatz her, der beleuchtet war, kam ein anderes Paar. Unwillkürlich schaute Violet länger zu ihnen hinüber.
»Ein attraktives Paar«, sagte sie zu Robin. »So was sieht man selten.«
Er lachte leiser und drückte ihren Arm fester an sich. »Das sind wir doch auch. Was mir fehlt, machst du wett, Violet.«
Die Sorgen fielen von ihr ab, als sie sich in die Augen blickten und ganz rasch küssten, ohne zu bemerken, dass jetzt Daniel und Fee Norden ihnen schmunzelnd nachblickten.
»Wie schön ist es, verliebt zu sein«, sagte Fee.
»Kannst du dich beklagen?«, fragte er.
»Hast du mich heute überhaupt schon geküsst?«, fragte sie.
»Wirst du schon vergeßlich, mein Schatz? Aber bitte, immer zu Diensten.« Und schon küsste er sie auch, bevor sie die Klinik betraten.
*
Harald lenkte seine Schritte zuerst zu Vanessas Zimmer. Ganz leise öffnete er die Tür, sah die Blumen auf dem Tisch stehen und auf dem Kopfkissen nur eine Flut von Haaren. Vanessa hatte das Gesicht in dem Kissen verborgen. Ob sie schlief, konnte Harald nicht feststellen. Er wagte jetzt doch nicht, näher an ihr Bett zu treten. Leise schloss er die Tür wieder.
Er hatte noch etwas zu erledigen, was wichtig und unaufschiebbar war, so unbehaglich es ihm bei diesem Gedanken auch sein mochte.
Gottfried Detloffs Zimmer befand sich ein Stockwerk höher. In welchem man Margit untergebracht hatte, wusste Harald noch nicht, und er wollte die Schwester auch nicht fragen, nachdem sie ihm erklärt hatte, dass Dr. Behnisch jetzt nicht zu sprechen sei. Eigentlich war es ja auch schon ein bisschen spät für einen Besuch bei dem Patienten, aber Herr Detloff hatte ausdrücklich bestimmt, dass Herr Johanson vorgelassen würde.
»Endlich«, wurde Harald auch von Gottfried Detloff begrüßt. »Ich bin schon ganz kribbelig. Hoffentlich erfahre ich nun endlich etwas Gutes. Man behandelt mich hier wie ein rohes Ei. Das passt mir nicht. Lange bleibe ich nicht mehr hier.«
»Zuerst hat es Ihnen doch gefallen«, sagte Harald begütigend.
»Aber jetzt geht es mir besser, und ich will wieder mittendrin sein.«
»Um wieder zusammenzuklappen? Immer noch der Alte. Nichts dazugelernt.«
Harald war ganz froh, dass es eine lange Einleitung gab. Irgendwie würde er dann schon zu dem überleiten können, was ihm am Herzen lag.
»Ihr jungen Hüpfer, ihr seid ja so gescheit«, polterte Gottfried Detloff. »Also, was ist mit Vanessa? Ich will es jetzt endlich wissen. Keine Ausflüchte mehr.«
»Sie ist Ihnen näher, als Sie meinen«, erwiderte Harald.
»Wartet sie draußen? Dann möchte ich sie sofort sehen.«
»Das ist nicht möglich. Jetzt nicht. Sie schläft sich ein Stockwerk tiefer aus.«
Gottfried Detloffs Augenbrauen schoben sich zusammen. »Ist das ein Hotel oder eine Klinik?«, fragte er gereizt.
»Immer noch eine Klinik«, erwiderte Harald.
Der Mann richtete sich auf. »Ist Vanessa krank?«, fragte er erregt.
»Sie war es. Nun regen Sie sich nicht auf, sonst muss ich gleich wieder gehen. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie noch eine Tochter haben, Herr Detloff.«
»Margit? Die braucht mich doch nicht. Sie geht ihre eigenen Wege. Die ist sie schon gegangen, seit ich denken kann.«
»Sie haben sie gehen lassen«, sagte Harald ernst, »aber wenn sie nun auch Hilfe braucht?«
»Hilfe? Sie hat ein wohlgefülltes Konto.«
»Nicht alles ist mit Geld zu erkaufen«, sagte Harald bedächtig.
»Das habe ich gemerkt«, brummte Gottfried Detloff. »Was schert sie sich denn schon um ihren kranken Vater? Ich weiß, woran ich mit ihr bin.«
Er stöhnte laut.
»Ich will jetzt wissen, was mit Vanessa ist. Ist ihr der Flug nicht bekommen? Sie haben sie doch hoffentlich in Hunter Cottage gefunden?«
»Nein, als ich dort war, war sie schon hier in der Klinik. Und ich hatte sie selbst mit hierhergebracht, ohne zu wissen, wer sie ist.«
»Was wollen Sie mir da für eine Räubergeschichte erzählen?«
»Die Wahrheit, Herr Detloff, wenn Sie diese vertragen können.«
»Die Ungewissheit kann ich jedenfalls nicht mehr ertragen«, erwiderte der andere aggressiv. »Ich springe aus dem Bett und suche meine Tochter.«
»Welche?«
»Die hier in der Klinik liegt natürlich. Vanessa!«
»Vielleicht geraten Sie aber dabei in Margits Zimmer«, sagte Harald trocken. Und damit hatte er den Älteren zum Schweigen gebracht. Gottfried Detloff starrte ihn ungläubig an.
»Ich kann eine ganze Menge vertragen, aber reden Sie endlich«, verlangte er.
*
Dr. Behnisch, Jenny Lenz, Daniel und Fee unterhielten sich über das gleiche Thema, als Schwester Maria zaghaft an die Tür klopfte und ihr Bedauern ausdrückte, stören zu müssen, aber Herr Johanson verlange den Chefarzt unbedingt zu sprechen. Er sei bis jetzt bei Herrn Detloff gewesen.
Schwester Marias Stimme klang vorwurfsvoll, denn wenn es nach ihr gehen würde, müssten so späte Besuche verboten werden.
»Herein mit ihm«, sagte Dr. Behnisch. Da stand er schon in der Tür, und Schwester Maria entfernte sich mit beleidigter Miene. Das hatte sie nun davon, wenn sie dem überlasteten Chef mal eine Mußestunde gönnen wollte. Sie ging auf die Station zurück, und als sie dann ihren Rundgang machte, um zu sehen, ob in allen Krankenzimmern das Licht gelöscht war, sah sie Gottfried Detloffs Tür einen Spalt offenstehen.
Als sie dann das Bett leer fand, wurde ihr ganz schwindelig.
Sie schnappte nach Luft, rief nach Schwester Melanie, aber die war auch nirgends zu sehen, und dann rannte sie wie gejagt zum Chefarztzimmer zurück.
Eine halbe Stunde hatte Harald bereits ausführlich Bericht erstattet und einen Zuhörerkreis gefunden, der atemlos zuhörte, als Schwester Maria, diesmal ohne anzuklopfen, hereingestürzt kam.
»Herr Detloff ist weg, verschwunden«, stammelte sie.
Dr. Behnisch und Dr. Norden sprangen gleichzeitig auf. »Das ist doch nicht möglich«, flüsterte Dr. Jenny Lenz.
»Dieser Dickschädel«, sagte Harald, »aber nur keine Aufregung, bei einer seiner Töchter werden wir ihn schon finden. Ich gehe zu Vanessa.«
*
Schwester Melanie hatte auch einen Schreck in der Abendstunde erlebt, als Gottfried Detloff die Treppe heruntermarschiert kam. Im ersten Augenblick meinte sie einen Geist zu sehen, aber seine barsche Stimme belehrte sie rasch eines besseren.
»Wo liegt Margit, meine Tochter Margit?«, fragte er.
»Herr Detloff, Sie dürfen nicht …«, aber sie kam nicht weiter.
»Was ich darf oder nicht, bestimme ich selbst«, fuhr er sie an, doch Schwester Melanie hatte auch Haare auf den Zähnen.
»Hier bestimmt der Chef«, erklärte sie, »und Sie sind Patient. Ich werde den Chef benachrichtigen.«
»Das werden Sie nicht«, sagte er nun sanfter. »Lassen Sie den geplagten Mann doch in Ruhe. Er wird von meinem Freund Johanson heute noch genug zu hören bekommen. Zeigen Sie mir das Zimmer von Margit. Ich will meine Tochter sehen. Auf meine Verantwortung.«
Gebieterisch sagte er es und zeigte nicht eine Spur von Schwäche.
»Ich nehme alles auf meine Kappe«, fügte er begütigend hinzu. »Sie werden keine Schwierigkeiten bekommen.«
»Zimmer acht, aber ich habe nichts gesagt«, brummte Schwester Melanie.
»Ich habe Sie überhaupt nicht gesehen«, sagte er freundlich grinsend und folgte ihrem deutenden Finger.
Während Schwester Melanie zwischen Pflichtbewusstsein und Nachsicht schwankte, steuerte er auf das Zimmer zu.
Sie entfernte sich in der entgegengesetzten Richtung und überlegte, ob es nicht doch besser wäre, dem Chef Mitteilung zu machen.
Wenig später wurde sie von diesem höchstpersönlich fast über den Haufen gerannt. In seinem Gefolge befanden sich Dr. Norden und Schwester Maria.
»Wir suchen Herrn Detloff, er ist nicht in seinem Zimmer«, sagte Dr. Behnisch.
»Ich weiß, er ist nach Zimmer acht gegangen«, erwiderte Schwester Melanie zögernd.
»Und Sie haben ihn nicht aufgehalten?«, fragte Dr. Behnisch.
»Wer kann diesen Mann aufhalten?«, sagte Melanie. »Ich wollte Ihnen eben Bescheid sagen.« Sie verriet nicht, dass sie noch mit ihrem Gewissen gekämpft hatte.
Wenn er sich auch nicht aufhalten ließ, dieser Gottfried Detloff, so war er doch immer noch Patient, und Dr. Behnisch war für ihn verantwortlich. Er begab sich zu Zimmer acht und lauschte. Er konnte nichts hören und drückte leise die Klinke hinunter. Das Zimmer hatte wie alle anderen auch Doppeltüren, und die innere Tür stand offen.
Dr. Behnisch vernahm ein Schluchzen. »Hilf mir doch, Papa, lass mich nicht im Stich«, flehte Margit. »Ich bin so verzweifelt.«
»Wird schon alles wieder gut, Kleine«, sagte Gottfried Detloff tröstend. »Wird alles wieder gut. Ich lasse dich nicht im Stich.«
Und er hatte vergessen, dass er noch vor einer Stunde etwas ganz anderes gesagt hatte. Sein Groll war verschwunden. Es war lange her, dass er seine Tochter so in den Armen gehalten hatte, und in diesen Minuten dachte er nur an Margit und nicht an Vanessa.
*
Harald war erleichtert, als er Vanessa allein im Zimmer fand. Das Nachtlicht brannte. Sie schlief aber nicht, sondern sah ihn mit großen glänzenden Augen an, und sie sah bezaubernd, unendlich lieblich aus im matten Schein des Lichtes.
»Es ist sehr spät«, flüsterte sie. »Wieso sind Sie noch hier?«
»Weil ich nichts Besseres mit meiner Zeit anzufangen weiß«, erwiderte er. »Wie geht es Ihnen jetzt?«
»Schon besser. Haben Sie mit Violet gesprochen?«
»Nur flüchtig. Ich war die ganze Zeit unterwegs.«
»Violet war lange bei mir.« Ihr Kopf drehte sich, und ihr Blick wanderte zu dem Blumengebinde.
»Es ist von Ihnen«, flüsterte sie. »Sie haben ein gutes Gedächtnis.«
Er lächelte. »Ein paar Stunden hält es schon vor, kleines Mädchen.«
»Ich bin heute hundert Jahre älter geworden«, sagte Vanessa verhalten.
»Und noch hübscher. Für eine Hundertzwanzigjährige unglaublich. Sie werden Schlagzeilen machen.«
Er hatte sich nichts dabei gedacht, aber sie sah schnell von ihm fort.
»Eben das will ich nicht«, stieß sie hervor. »Meinen Sie, dass alles in die Zeitungen kommt?«
»Keine Sorge, Vanessa. Ich habe schon dafür gesorgt, dass dies nicht geschieht.«
»Haben Sie so viel Einfluss?«, fragte sie befangen.
»Manchmal genügt die Androhung einer Klage. Wer kennt hier schon Vanessa Hunter?«
»Aber jeder kennt Harald Johanson«, sagte sie.
»Glauben Sie ja nicht, dass mir das Spass macht, aber in diesem speziellen Fall ist es nicht von Nachteil. Man weiß, dass ich eine lange Puste habe und ein dickes Fell. Aber jetzt etwas anderes. Ich habe vorhin mit Ihrem Vater gesprochen und dachte schon, er hätte Ihnen einen Besuch abgestattet. Es ist ihm zuzutrauen, dass er hier ganz einfach aufkreuzt.«
»Darf er denn einfach herumspazieren?«, fragte sie verwundert.
»Er fragt nicht danach, was er darf. Er tut, was er will.«
»Und er hat immer bekommen, was er haben wollte«, sagte Vanessa mit einem Anflug von Bitterkeit.
»Ich weiß, dass er mehr Gefühl hat, als man ihm zutraut. Er hat nicht von mir verlangt, dass ich mich zu seinem Fürsprecher mache, aber ich schätze ihn so sehr, dass ich es doch tun möchte. Reichen Sie ihm die Hand, Vanessa, wenn er kommt. Ich ahne, was in ihm vor sich gegangen ist, seit er erfuhr, dass er noch eine Tochter hat. Es ist schwer für einen Mann, der einmal in seinem Leben einer ganz starken Liebe fähig war, das Glück nicht festhalten zu können. Es ist für jeden Mann schwer.«
»Haben Sie das auch schon erlebt?«, fragte Vanessa.
»Nein, und was mich angeht, muss ich sagen, dass ich das Glück festhalten würde, komme, was da wolle.«
»Auch, wenn es Ihnen erst begegnen würde, wenn Sie schon verheiratet sind?«
»Ich würde niemals heiraten, wenn ich nicht restlos überzeugt wäre, dass es die ganz große Liebe ist.«
Vanessa schloss die Augen.
»Aber Sie haben sich mit Margit verlobt.«
»Nein, soweit ist es nicht gekommen. Ich gebe zu, dass eine Verlobung geplant war, aber dann kam mir die Erleuchtung, wie sinnlos ein so spektakulärer Akt ist.«
»Sie ist ein sehr attraktives Mädchen«, sagte Vanessa.
»Bestreite ich nicht. Sie ist auch sehr intelligent. Sie weiß genau, was sie will, und ich wusste es nicht. Das war der Unterschied.«
»Sie liebt Sie?«
»Na, das nun auch wieder nicht. Das würde bei Margit nie den Ausschlag geben. Sagen wir es mal so: Ich entsprach ihren Vorstellungen. Aber es ist unnütz, darüber zu sprechen. Die Verhältnisse sind geklärt. Gottfried Detloff hat mich verstanden und meine Einstellung akzeptiert, und Margit wurde dadurch kein Schock versetzt. Den versetzte ihr ein anderer.«
»Simon?«, fragte Vanessa.
»Eines haben Sie mit Margit gemeinsam, Vanessa. Sie haben beide mit demselben Mann schlimme Erfahrungen gemacht. Vielleicht erweist sich das eines Tages als Brücke zwischen Ihnen. Und jetzt werde ich mich für heute verabschieden müssen, sonst wirft man mich noch hinaus und verhängt Hausverbot über mich. Dann dürfte ich Sie nicht mehr besuchen, und das möchte ich doch.«
Seine Stimme hatte einen ganz weichen Klang, und behutsam hob er ihre Hand an die Lippen. Er spürte, wie ihre Finger bebten, und küsste jeden einzelnen. »Ich hoffe, dass wir uns noch oft sehen, auch wenn Sie diese Klinik wieder verlassen haben.«
»Ich will nicht hierbleiben, Harald«, sagte Vanessa. »Ich möchte zurück nach Hunter Cottage zu Laura. Ich werde das Herrn …«, sie machte eine kleine Pause, »meinem Vater erklären«, berichtigte sie sich dann stockend.
»Lassen Sie sich damit Zeit«, bat er. »Hunter Cottage ist übrigens sehr
hübsch. Und mit Laura habe ich mich schon angefreundet.«
»Tatsächlich? Sie ist aber sehr störrisch im allgemeinen.«
»Vorsichtig, wollen wir besser sagen, aber ich kann mich nicht beklagen. Sie würde sicher nichts dagegen haben, wenn ich Sie auf Hunter Cottage besuchen würde.«
»Soll ich es so verstehen, dass Sie es billigen, wenn ich an meinem Entschluss festhalte?«
»Jeder Mensch muss das tun, was er für richtig hält. Manchmal kann man seine Meinung aber auch ändern. Morgen ist ein neuer Tag, und niemand wird Ihnen noch etwas zuleide tun. Sie sollen jetzt gesund werden und auch ein glückliches Mädchen, das ich gern einmal fröhlich lachen hören möchte. Und wenn es mir gestattet wird, möchte ich diesem Mädchen auch meine Heimat zeigen. Es gibt hier auch so schöne Plätze wie Hunter Cottage. Einen zauberhaften Platz sogar, wo Sie sich wunderbar erholen können. Eine Insel mit einem vielversprechenden Namen.«
»Wie heißt sie?«
»Insel der Hoffnung.«
»Isle of Hope. Insel der Hoffnung«, wiederholte sie gedankenverloren. »Gehört sie Ihnen?«
»Nein, sie gehört Dr. Norden, und um kein Geld der Welt würde er sie sich abhandeln lassen.«
Sie sah ihn mit einem Blick an, der eigentümliche Gefühle in ihm weckte, in dem Staunen, Nachdenklichkeit und noch ein anderer, undeutbarer Ausdruck lag.
»Harald«, sagte sie gedankenverloren, schon ein bisschen schläfrig, und ausgerechnet in diesem Augenblick tat sich die Tür auf, und Dr. Behnisch erschien.
»Nun werde ich hinausgeworfen«, sagte Harald schnell.
»Aber er darf doch wiederkommen?«, sagte Vanessa bittend.
»Natürlich darf er wiederkommen«, erwiderte Dr. Behnisch.
*
Er kam schon am nächsten Vormittag. Diesmal brachte er ihr selbst Blumen. Er sah sofort, dass sie geweint hatte, und tiefe Besorgnis erfüllte ihn.
»Schmerzen, Vanessa?«, fragte er gepreßt.
»Nein, es geht mir schon ganz gut. Mein Vater war bei mir. Er tut mir sehr leid.«
Der große starke Gottfried Detloff tat der kleinen Vanessa leid. Was sollte man dazu sagen?
»Er wird bald wieder auf den Beinen sein«, sagte Harald beruhigend. »Wenn er die ärztlichen Ratschläge befolgt, wird er noch lange leben.«
»Das hoffe ich sehr«, sagte sie leise, »aber das meinte ich nicht. Er hat Mummy auch sehr geliebt, und er war viele Jahre sehr einsam. Sie hätten zusammen glücklich sein können. Es war ihnen nicht beschieden. Und nun hat er zwei Töchter und weiß nicht so recht, wie er jeder gerecht werden soll. Er hat es nicht gesagt, aber ich spüre es. Er hat mir erzählt, was Margit widerfahren ist. Müssten Sie jetzt nicht zu ihr stehen, Harald?«
Er sah sie bestürzt an. »Nein, das kann ich nicht, Vanessa«, sagte er heiser, »jetzt nicht mehr.«
»Warum nicht? Sie hat Ihnen doch gefallen, und Sie haben sich auch verstanden. Vielleicht hat sie sich verändert. Dad hat es gesagt.«
»Hat er auch gesagt, dass ich mich um sie kümmern sollte?«
»Nein, das hat er nicht gesagt, aber es mag sein, dass er es hofft.«
»Mein kleines Mädchen, jetzt werden wir einmal ganz vernünftig miteinander sprechen. Gestern war der gute Gottfried Detloff soweit, dass er sein Testament zu Ihren Gunsten ändern wollte. Und wie ich gestern Abend von Dr. Norden hörte, wollte er mit Ihnen zur Insel der Hoffnung fahren. Von Margit wollte er gar nichts mehr wissen, dieser Dickschädel. Ich bin froh, dass er schnell anderen Sinnes geworden ist, aber ich sehe nicht ein, dass ich auch noch in die Bresche springen soll. Wenn Margit sich von dem Schock erholt hat, wird sie sich schnell wieder zurechtfinden, wenn für sie alles beim alten bleibt. Ich kann für sie nur wünschen, dass der Schock wenigstens bewirkt hat, dass sie nicht mehr so grenzenlos egoistisch ist.«
»Sie ist völlig gebrochen«, sagte Vanessa bebend.
»Und Sie fließen über vor Mitleid.«
»Ist das verwerflich?«
»Hoffentlich hat Margit mit Ihnen auch so viel Mitleid«, sagte Harald.
»Ich brauche kein Mitleid. Ich bin eine Hunter.« Es klang stolz und rührend zugleich. Und wenn Harald sich bisher noch nicht darüber klargeworden war, was er für dieses Mädchen empfand, wusste er es in diesem Augenblick mit aller Deutlichkeit. Am liebsten hätte er sie in die Arme genommen und geküsst, aber dafür schien ihm die Zeit doch noch nicht reif.
Aber vielleicht sagte sein Blick doch mehr als alle Worte. Vanessa errötete heiß. Sie schlug die Augen nieder, und als sich im nächsten Augenblick die Tür auftat, atmete sie sichtlich erleichtert auf.
Violet und Robin kamen. »So früh schon hier?«, begrüßte Violet Harald munter. »Damit haben wir nicht gerechnet.«
»Ich habe etwas Wichtiges mit Herrn Detloff zu besprechen und wollte nur schnell bei Vanessa hereinschauen«, redete sich Harald schnell heraus. »Wir treffen uns doch mittags?«
»Schon beschlossen«, sagte Robin. »Wir haben gestern Abend in Ihrem Stammlokal vorzüglich gegessen. Aber jetzt muss ich mich doch erst mit Vanessa bekannt machen.«
Es wurde für Harald und Vanessa ein flüchtiger Abschied, ein zu flüchtiger. Er hätte plötzlich noch so viel zu sagen gewusst. Aber sie sprach schon mit Robin und Violet, und Harald kam sich überflüssig vor. Es war ein scheußliches Gefühl. Und mit sehr gemischten Gefühlen begab er sich nun zu Gottfried Detloff.
Wenn er nun doch von ihm erwartete, dass er unter nun veränderten Umständen seine Beziehungen zu Margit wieder aufnahm und vertiefte?
Gottfried Detloff lag nicht mehr im Bett. Er war vollständig angekleidet. Harald war erst einmal fassungslos.
»Dr. Behnisch hat es mir erlaubt«, sagte der Ältere brummig. »Er meint, dass es besser wäre, als wenn ich im Schlafrock in der Klinik herumlaufe. Ich konnte meiner Tochter den ersten Besuch auch unmöglich im Schlafrock machen.« Er drehte sich um und stellte sich vor das Fenster. Harald konnte nur seinen breiten Rücken sehen, als er dann leise fortfuhr: »Vanessa sieht ihrer Mutter sehr ähnlich. Es hat mich fast umgeworfen. Ich glaube, dass ich es kaum ertragen könnte, sie Tag für Tag um mich zu haben, immer daran erinnert zu werden, was das Schicksal mir vorenthalten hat. Sie will auch gar nicht bei mir bleiben. Sie hat ihre Mutter sehr geliebt.«
»Sie hatte nur ihre Mutter«, sagte Harald.
Abrupt drehte sich Gottfried Detloff zu ihm um. »Sie sagen das so seltsam, Harald.«
»Wieso seltsam? Es ist eine Tatsache.«
»Sie sagen es so, als hätten Sie viel für Vanessa übrig.«
Harald schluckte. »Und wenn es so wäre?«, fragte er.
Detloff strich seine Haarsträhne aus der Stirn.
»Ich habe es einmal erlebt«, sagte er gedankenvoll. »Ich sah Vanessa, die ältere Vanessa, aber damals war sie so jung wie die Kleine, wie meine Tochter. Ich war verloren. Das hätten Sie mir nie zugetraut, nicht wahr, Harald? Ach was, sagen wir doch du zueinander, mein Junge. Verstehen kannst du mich ja nun. Oder täusche ich mich?«
Harald wusste nicht, was er erwidern sollte, aber Gottfried Detloff fuhr auch sogleich fort, und es war fast ein Monolog.
»Ich sah sie und war verloren. Wir gingen aufeinander zu und wussten, dass wir zusammengehören. Dazu braucht man nicht viel zu sagen. Ich hätte sie nur nie wieder gehen lassen dürfen. Mach nicht den gleichen Fehler, Harald, wenn es dir ernst ist. Halte sie fest, ganz fest.«
Harald spürte sein Herz stürmisch schlagen. Es sprengte ihm fast die Brust. Noch immer fand er keine Worte.
»Es würde mich glücklich machen«, sagte Gottfried Detloff leise. »Ich kann ihr nie das sein, was ich sein möchte, das habe ich begriffen. Aber ich weiß, dass es dich gepackt hat. Ich lese es in deinen Augen. Und ich kenne dich besser als jeder andere. Sie würde alles wecken, was in dir steckt. Sie will keine Vanessa Detloff werden, aber vielleicht doch eine Vanessa Johanson.«
»Meinst du das wirklich?«, fragte Harald mit einer Stimme, die ihm nicht gehorchen wollte.
»Ich hoffe es. Ich könnte dann ruhig leben.«
Lange Zeit war Schweigen zwischen ihnen. »Soll ich jetzt Margit einen Besuch machen?«, fragte Harald, um sich gewaltsam auf andere Gedanken zu bringen.
»Nein, besser nicht. Sie braucht Zeit, viel Zeit, um sich selbst zu finden, und sie wird nicht mehr die Margit werden, die wir kannten. Das macht mir alles ein bisschen leichter, Harald. Sie war schon so weit von mir entfernt, und jetzt will sie wieder mein Kind sein. Sie braucht mich. Vanessa braucht mich nicht. Sie hat das nicht gesagt, aber auch das fühle ich … Ich werde mit Margit auf die Insel der Hoffnung gehen. Es ist alles schon beschlossen.«
»Vielleicht werden wir euch dort besuchen, wenn alles so kommt, wie du es dir wünschst«, sagte Harald.
Ein tiefes Lächeln legte sich um Gottfried Detloffs Lippen. »Wünschst du es dir nicht?«, fragte er.
»Ich? Ich wünsche mir viel mehr. Doch für mich ist es schön, dass du mich deine Gedanken wissen ließest. Verstanden haben wir uns immer. Eigentlich warst du schon lange Zeit so etwas wie ein Vater für mich. Ja, warum soll man es auch unter Männern nicht einmal sagen, dass ich dich sehr, sehr gern habe.«
»So gern, dass du mir zuliebe bereit warst, Margit zu heiraten, oder dich wenigstens mit ihr zu verloben. Ihr passt nicht zusammen. Das habe ich immer gewusst. Aber wenn du mir eines Tages mitteilst, dass du Vanessa geheiratet hast, dann weiß ich, dass dies die richtige Entscheidung war.«
»Wenn sie mich haben will, dann hoffe ich doch, dass du an diesem Tage dabeisein wirst«, sagte Harald.
»Das ist ein Wort!«, rief Gottfried Detloff aus. Dann fanden sich die Männerhände zu einem festen Druck.
*
Für Daniel Norden und Fee hatte dieser Morgen düster begonnen, obgleich die Sonne strahlend am Himmel stand.
Bevor sie sich an den Frühstückstisch setzen konnten, läutete das Telefon. Es war die Nachbarin von Herrn Ackermann, die ihm auch den Haushalt mit versorgte.
»Herrn Ackermann geht es sehr schlecht«, sagte sie, nachdem sie sich wortreich für die frühe Störung entschuldigt hatte. Ob der Herr Doktor wohl bald mal kommen könne?
Daniel war schon unterwegs. Er hatte den Hörer Fee in die Hand gedrückt.
Am Samstag wollten wir zur Insel fahren, dachte sie traurig. Sie hatte ihrem Vater schon mitgeteilt, dass sie Herrn Ackermann mitbringen wollten. Und nun ahnte sie, dass daraus nichts mehr werden würde.
Daniel bestätigte es ihr eine Stunde später. Herr Ackermann war gestorben.
»Mit einem Lächeln auf den Lippen, Fee, und mit Grüßen an dich. Er dankt dir für alles.«
Tränen quollen aus ihren Augen. Daniel streichelte ihr Haar.
»Er hat sein Leiden so tapfer ertragen. Jetzt hat er seinen Frieden, Fee.«
»Seine Augen strahlten so, als ich ihm sagte, dass wir zusammen fahren würden«, flüsterte sie.
»Weil du ihm eine Freude machtest. Er wusste es wohl, dass er die Insel nicht mehr sehen würde, Liebes, er hat keine Schmerzen mehr. Er ist in einer Welt, in der er mit denen vereint ist, die er liebte.«
»Ich könnte nie ohne dich leben, Daniel«, schluchzte Fee. »Lass mich nie allein.«
»Ich möchte auch nicht mehr ohne dich sein, Feelein«, sagte Daniel weich.
Aber wieviel Menschen hatten das schon gedacht und gesagt und mussten ihr Leben dann doch allein zu Ende leben. Alles lag in Gottes Hand. Und so nahe ihnen beiden der Tod dieses gütigen alten Mannes ging, sie mussten sich der Patienten annehmen, die Hilfe von ihnen erhofften.
Molly machte Schreibarbeiten. Die Abrechnungen für die Krankenkassen mussten fertig gemacht werden.
Molly hatte das Radio angestellt, was Fee verwunderte.
»Gibt es etwas Besonderes, Molly?«, fragte sie.
»Wissen Sie es noch nicht? Die Araber haben wieder ein Flugzeug entführt«, sagte Molly empört. »So eine Schurkerei. Sie wollen eine Geisel erschießen. Warten Sie mal, jetzt kommt wieder eine Meldung.«
Fee fröstelte es. Gewalt erzeugt immer wieder Gewalt, ging es ihr durch den Sinn. Warum musste das sein? Warum können die Völker sich nicht in einer friedlichen Koexistenz einigen? – Und dann horchte sie plötzlich auf. Die erregte Stimme des Rundfunksprechers tönte durch den Raum:
»Die Flugzeugentführer haben ihre Drohung wahrgemacht. Sie haben eine Geisel erschossen. Wie uns mitgeteilt wurde, handelt es sich um den britischen Staatsbürger Simon Terence.«
Simon Terence! In ihren Ohren dröhnte der Name nach. Sie haben ihn hingerichtet.
Fee musste sich jetzt erst einmal setzen, und Molly fühlte sich ganz schuldbewusst.
»So was Schreckliches sollten Sie eigentlich gar nicht mehr hören, Frau Doktor«, sagte sie kleinlaut.
*
In der Behnisch-Klinik gab es Radio in allen Zimmern, und wenn ein Patient nichts davon wissen wollte, genügte ein Knopfdurck, um die Anlage ein- oder auch auszustellen.
Margit hatte unbewusst auf den Knopf gedrückt, der die Musik ertönen ließ. Eigentlich hatte sie die Klingel drücken wollen. Dann kam Musik, und sie vergaß, was sie gewollt hatte.
Wenn sie daheim war, hatte sie das Radio immer ununterbrochen laufen. Sie hatte schon gar nicht mehr richtig gemerkt, ob es lief oder nicht.
Jetzt drang zärtliche Musik an ihr Ohr, und sie schlief wieder ein. Doch dann erwachte sie nach einer halben Stunde wieder, und eine Männerstimme drang an ihr Ohr.
Nachrichten! Daran lag ihr nicht viel, aber sie wusste nicht, wie sie diese Stimme abstellen konnte. Und auch sie hörte, was da über die Flugzeugentführung verkündet wurde.
Sie glaubte zu träumen, als der Name Simon Terence in ihr Bewusstsein drang.
Dann, als ihr bewusst wurde, dass es kein Traum war, begann sie zu schreien. Als dann noch immer niemand kam, sprang sie aus dem Bett und lief auf den Gang, schreiend, mit tränenüberströmtem Gesicht, fiel sie in die Arme von Dr. Jenny Lenz.
»Sie haben ihn umgebracht, sie haben Simon getötet!«, schluchzte sie.
»Sie haben schlecht geträumt«, sagte Jenny beruhigend. »Kommen Sie, Fräulein Detloff, legen Sie sich wieder hin.«
»Aber die Stimme, die Stimme«, schluchzte Margit. »Der Mann hat gesagt, dass sie Simon erschossen haben.«
Willenlos ließ sie sich von Jenny aber doch wieder in ihr Krankenzimmer führen. Aus dem Radio tönte Musik, weiche, träumerische Klänge.
Margit sank auf ihr Bett. »Sie dürfen ihn nicht töten«, flüsterte sie. »Er ist kein Verbrecher.«
Er hätte sie beinahe umgebracht, dachte Jenny Lenz, ohne zu wissen, welches Schicksal Simon Terence tatsächlich erlitten hatte.
Sie streichelte Margits Wangen. Sie war voller Mitgefühl, denn sie ahnte, dass Margit sehr viel für diesen Mann empfunden hatte, der ihr beinahe den Tod gebracht hätte. Und als sie dann später die Bestätigung erhielt, wie elend Simon Terence gestorben war, ahnte sie, was Margit durchmachen musste.
*
Mittags erfuhren es auch Harald, Violet und Robin. Ihnen verging der Appetit an der schon so verlockend gedeckten Tafel.
»Was mag er in seinen letzten Sekunden gefühlt haben?«, sagte Violet bebend.
»Hoffentlich ist ihm seine Schuld bewusst geworden«, sagte Harald und erhob sich. »Ich gehe zu Vanessa.«
Violet brachte kein Wort heraus, aber in dem Blick, den Robin ihm nachschickte, war ein nachdenklicher Ausdruck.
»Die ausgleichende Gerechtigkeit«, sagte er leise vor sich hin.
»Er wollte seiner Strafe entfliehen«, flüsterte Violet.
»Ich dachte jetzt nicht an Terence«, sagte Robin. »Ich meinte Harald und Vanessa. Er liebt sie genauso, wie ich dich liebe, Violet. Simon Terence hat, ohne es zu wissen und zu wollen, vier Menschen glücklich gemacht.«
»Wird Vanessa auch glücklich werden?«, fragte Violet leise.
»Hast du nicht bemerkt, wie sie Harald heute nachschaute, als wir bei ihr waren? Nicht immer geht die böse Saat auf, mein Liebling. Gott hält seine schützende Hand über die, die er liebt, und über die Liebenden, die mit ganzem Herzen bereit sind zu geben und nicht nur zu nehmen. Du kannst alles von mir haben, Violet.«
»Du auch, Robin«, erwiderte sie und schmiegte sich in seine Arme.
*
Vanessa schlief, als Harald kam. Er setzte sich an ihr Bett und betrachtete ihr Gesicht. Er prägte es sich ein,
obgleich diese Anmut ihm doch schon so vertraut war. Ganz sanft streichelte er ihre kleine schmale Hand, beugte sich darüber und legte seine Lippen darauf.
»Harald«, hauchte sie, und dann versanken ihre Blicke ineinander. Es gab nichts mehr auf der Welt als Vanessa und Harald.
Ihre Hände fanden sich und dann auch ihre Lippen. Im Unterbewusstsein dachte Harald anfangs an Gottfried Detloff und Vanessas Mutter, an das, was Gottfried ihm am Vormittag gesagt hatte, aber dann dachte er nur noch an diese Vanessa, die in seinen Armen lag, die er küsste, und die er nie mehr freigeben wollte.
Schmerzhaft hielt er sie, aber ebenso klammerte sie sich an ihn.
»Wir bleiben immer zusammen, mein Geliebtes. Ich gebe dich nie mehr her«, flüsterte er. »Willst du meine Frau werden? Ich liebe dich, Vanessa. Vergiß alles, was vorher war.«
»Ich will gesund werden«, sagte sie. »Ich will mit dir gehen, wohin du willst. Ich will nicht so leben wie Mummy. Meine Kinder sollen ihren Vater von Anfang an haben und lieben, wie ich ihn liebe.«
Und Harald, der nie daran gedacht hatte, einmal auch Vater zu sein, bedeckte ihr Gesicht mit zärtlichen Küssen und fühlte sich als der glücklichste Mann auf der ganzen Welt.
*
Zwei Wochen später fuhren sie zur Insel der Hoffnung, auf der Gottfried Detloff und Margit nun schon zehn Tage weilten.
Fee und ihr Vater, Dr. Cornelius, kamen ihnen entgegen.
»Schön ist es hier«, sagte Vanessa. »Hier muss man genesen.«
»Der Anfang ist bereits gemacht«, sagte Fee. »Sie brauchen die Insel zur Genesung nicht, Vanessa, wie ich meine.«
»Aber wir würden gern ein paar Tage hierbleiben«, erwiderte Harald.
»Wir sind leider ausgebucht«, warf Dr. Cornelius ein, »aber wenn Sie sich mit Herrn und Fräulein Detloff über die Unterbringungsmöglichkeit einigen könnten, stünde dem nichts im Wege.«
Und da nahten sie schon, Gottfried und Margit Detloff, Hand in Hand. Langsam ging Vanessa ihnen entgegen, und zuerst reichte sie Margit die Hand.
»Ich will dir nichts wegnehmen«, sagte sie leise.
»Du kannst alles haben, wenn ich Papa behalten darf«, erwiderte Margit.
»Ich möchte nur, dass ihr einverstanden seid, wenn ich Harald heirate«, sagte Vanessa. »Und auch, dass du mir nicht böse bist, dass ich auf der Welt bin, Margit.«
Während sich Gottfried ausgiebig schneuzte, umarmte Margit die Jüngere.
»Ich habe viel gelernt, Vanessa. Papa und ich haben hier viel Zeit gehabt, miteinander zu sprechen. Ich wünsche dir viel Glück, und dir auch, Harald. Wir werden noch ein Weilchen hierbleiben. Wann werdet ihr heiraten?«
Vanessa sah Harald an, der Margit immer noch verwirrt anblickte.
»Wir wollten jetzt erst einmal nach Schottland fliegen, um an Robin und Violets Hochzeit teilzunehmen«, sagte er.
»Und um Laura zu fragen, ob sie mit uns kommen würde«, warf Vanessa ein.
»Einen Termin für eure Hochzeit habt ihr immer noch nicht festgelegt?«, fragte Gottfried Detloff.
»Ich muss dich doch wohl erst um die Hand deiner Tochter bitten«, sagte Harald.
»Ja, ja«, erwiderte Gottfried Detloff. »Also, wenn ihr so unentschlossen seid, dann sagen wir in vier Wochen. Was meinst du, Margit?«
»Ich sage auch ja und wünsche euch viel Glück«, erwiderte Margit, und dann umarmte sie Vanessa.
Fee sah es aus der Ferne. »Ich muss jetzt fahren, Paps«, sagte sie zu Dr. Cornelius. »Wo ist Anne?«
»Im Büro. Ihr raucht der Kopf. Wir können uns kaum noch retten vor Anfragen.«
Zum Glück hatte er in seiner zweiten Frau die richtige Gefährtin gefunden.
Und mit Anne war auch Fee restlos einverstanden.
»Ich will dich gar nicht stören, Liebe«, sagte sie, von rückwärts die Arme um Annes Schultern schlingend. »Ich muss nach Hause. Daniel erstickt in Arbeit.«
»Ist sonst alles in Ordnung?«, fragte Anne Cornelius.
»Was die Detloffs betrifft, bin ich sehr zufrieden. Schau mal zum Fenster hinaus, Anne.«
Und da sahen sie Harald und Vanessa. Er hatte den Arm um sie gelegt und Gottfried Detloff seinen um Margit. Ein Bild voller Harmonie boten sie. Als Fee dann zu ihrem Wagen ging, kamen sie aber rasch näher.
»Wir bleiben noch ein paar Tage hier«, sagte Vanessa. »Ich kann bei Margit schlafen, und Harald schläft bei Papa auf der Couch. Das haben wir eben beschlossen.«
»Es freut mich sehr«, sagte Fee.
»Aber in vier Wochen ist Hochzeit bei uns«, sagte Gottfried Detloff. »Und da werden wir Sie hoffentlich auch dabei haben?«
»Wenn nicht zufällig ein Patient einen Herzanfall bekommt«, erwiderte Fee lächelnd.
»Ich passe auf Papa auf«, sagte Margit, und Fee fand, dass sie sich sehr zu ihrem Vorteil verändert hatte. Ihre Augen hatten einen ganz anderen Ausdruck als früher. Und in ihrem Händedruck lag viel Wärme. Daniel würde staunen, was sie zu berichten hatte. Jetzt hatte sie es eilig. Sie hatte Sehnsucht nach ihrem Mann.
- E N D E -