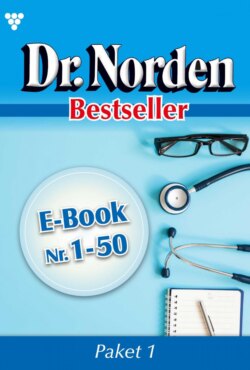Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 1 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDr. Daniel Norden und seine Frau Fee hatten ein sonniges, frohes Wochenende im Kreise der Familie auf der Insel der Hoffnung verbracht. Es war beschlossen gewesen, dass Fee noch die Woche über hierbleiben sollte, da nun der letzte Monat ihrer Schwangerschaft anbrach.
Als sehr früh am Montagmorgen der Wecker klingelte, war sie jedoch wieder anderen Sinnes geworden.
»Ich komme mit dir, Dan«, flüsterte sie.
»Nein, du bleibst hier«, erklärte er kategorisch. »Du lässt dich verwöhnen, Feelein. So war es abgemacht und dabei bleibt es.«
»Ich werde aber ganz schreckliche Sehnsucht nach dir haben.«
»Wir werden jeden Morgen und jeden Abend telefonieren, mein Liebes, und dazwischen würde ich für dich zu Hause auch kaum Zeit haben. Hier kannst du Sauerstoff tanken noch und noch. Es ist mir wirklich lieber, wenn du bei dem grässlichen Wetter nicht in der Stadt bist.«
»Es ist aber schönes Wetter«, widersprach Fee.
»Hier ja, aber hör mal, was der Rundfunk über München berichtet. Dort macht sich der Föhn so narrisch bemerkbar, dass die Menschen kaum noch Luft bekommen. Die Krankenhäuser können die Herzkranken schon gar nicht mehr unterbringen. Du willst doch nicht, dass ich mich um dich auch noch sorgen muss, Liebstes.«
»Mir geht es aber blendend«, entgegnete Fee.
»Hier geht es dir blendend, und darüber bin ich sehr froh. Am Freitag, bevor wir wegfuhren, ging es dir gar nicht so gut, wenn ich dich daran erinnern darf.«
»So eine ganz kleine vorübergehende Schwäche wird sich eine werdende Mutter doch mal leisten dürfen«, begehrte Fee auf. Fast hätte Daniel ihrem bittenden Blick nicht mehr widerstehen können, aber da kam ihm sein Schwiegervater zu Hilfe.
»Das Frühstück steht bereit, Dan«, sagte er. »Mit leerem Magen fährst du nicht weg.«
»Ich werde doch mit heimfahren, Paps«, erklärte Fee.
»Nein, das wirst du nicht«, erklärte Dr. Cornelius energisch. »Nur für ein kurzes Wochenende nimmst du die Strapazen der Fahrt nicht auf dich, mein liebes Kind.«
Daniel warf ihm über Fees Schulter hinweg einen dankbaren Blick zu. Er wurde ja doch weich, wenn sie auf einem Wunsch beharrte.
»Ihr Männer«, sagte Fee vorwurfsvoll, »ihr seid euch doch immer einig.«
»Wir lieben dich und sind besorgt um dich«, erklärte Dr. Cornelius. »Und du bist eine vernünftige kleine Mama, die das Beste für ihr Baby will.«
Und wie gut es war, dass sie beide standhaft blieben und Fee doch nachgab, sollte sich schon hundert Minuten später beweisen.
»Fahr vorsichtig! Pass auf dich auf!«, hatte Fee ihrem Mann unter zärtlichen Abschiedsküssen ins Ohr geflüstert, obgleich es solcher Ermahnungen nicht bedurft hätte. Daniel Norden war ein besonnener Fahrer. Er war immer auf der Hut. Er beharrte nicht auf Vorfahrtsrechten, und rechnete immer mit der Unzulänglichkeit und Unachtsamkeit der anderen.
Er kannte die Straße genau. Oft genug war er diese Strecke schon gefahren. Er kannte jede Kurve und auch jeden Bahnübergang, die beschrankten und die unbeschrankten.
Er wurde doppelt aufmerksam, als er Motorengeräusch über sich vernahm und er schon die Türme von München vor sich sah.
Ein Rettungshubschrauber flog dicht über den Bäumen in der gleichen Richtung, in der er fuhr. Er sah das rote Kreuz auf weißem Rund, und sofort waren seine Nerven aufs Äußerste gespannt. Er wusste, dass ganz nahe ein beschrankter Bahnübergang war. Und bald darauf wurde es ihm auch schon zur Gewissheit, dass dort etwas geschehen sein musste.
Eine Wagenkolonne stand vor ihm. Er stoppte und sprang aus dem Wagen. Er vernahm erregte Stimmen, in die sich angstvolle und stöhnende Schreie mischten.
»Was ist geschehen?«, fragte er einen Mann.
»Ein Bus ist in den Zug gerast«, schrie der aufgeregt zurück.
»Mein Gott, mein Gott, die armen Kinder«, rief eine Frau, die die Hände vor das Gesicht geschlagen hatte.
»Er hat die Schranke nicht geschlossen«, rief eine andere.
Mechanisch nahm Daniel seinen Arztkoffer, den er immer mit sich führte, aus dem Wagen. »Ich bin Arzt«, sagte er tonlos. »Geben Sie mir bitte den Weg frei. Wann ist das passiert?«
»Vor ein paar Minuten«, erwiderte jemand.
Wenig später sah er die Stätte des Grauens und hielt den Atem an. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte er an Fee und was es für sie bedeuten würde, dies sehen zu müssen, sie, die doch auch Ärztin war.
Metallteile, Kleiderfetzen – Grauen, nur Grauen sah er. Aber er war Arzt. Wenn man Hilfe brauchte, mussten Erschütterung und menschliche Erregungen zurückgedrängt werden.
»Dr. Norden!«, rief eine Stimme von irgendwo, doch sie ging unter im Lärm des landenden Rettungshubschraubers. Auch er hörte sie nicht. Er ging dem Stöhnen und Weinen nach, das an seine Ohren drang. Er sah im Gebüsch eine Frau liegen und unweit ein kleines Kind. Er bemerkte, dass beide lebten, und vielleicht entschieden die nächsten Sekunden schon darüber, ob diese beiden Leben erhalten bleiben konnten.
Eine fremde Stimme fragte ihn, ob man denn helfen könne. »Ich habe nämlich einen Kombiwagen«, sagte der grauhaarige Mann, der sich jetzt neben Daniel niederkniete.
»Helfen Sie mir, diese beiden in die Klinik zu bringen«, sagte Daniel.
»Gern, Herr Doktor. Es ist ja so schrecklich!«
Wie unterschiedlich die Menschen unter einem solchen Schock reagierten, wurde Daniel Norden in diesen Minuten nicht bewusst. Ihm zur Seite stand ein Mann, dem fremdes Leben mehr wert war, als sein neuer Wagen, als seine Polster, die bald vom Blut einer jungen Frau und eines Kindes rotgefärbt wurden.
Ein Mann, mindestens sechzig Jahre alt, steuerte seinen Wagen zur Behnisch-Klinik, wie Daniel es ihm geheißen hatte. Ein Mann, den nicht Sensationsgier in Bann geschlagen hatte, sondern der Leben retten wollte, genau wie er.
Er war von ihm mit seinem Namen angesprochen worden. Und als sie die Frau und das Kind in seinem Wagen getragen hatten, sagte er: »Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie nicht lange fackeln und erst Fragen stellen. Da kann es doch manchmal um Minuten gehen.«
Und wie oft dauerte es viel zu lange, bis ärztliche Hilfe kam. Gerade bei Katastrophen wurde später darüber immer wieder Kritik laut.
Daniel Norden dachte jetzt nicht darüber nach. Das Kind begann sich schon zu regen. Es schrie nach seiner Mami. Die junge Frau war bewusstlos, aber das Schreien holte sie für Sekunden ins Leben zurück.
»Mein Kind«, murmelte sie, »mein Kind«, dann wurde sie wieder bewusstlos.
Sie waren bei der Behnisch-Klinik angelangt. Dort war man bereits in Alarmzustand versetzt, wie alle anderen umliegenden Kliniken auch. Noch wusste man ja nicht, wie viele Tote und Verletzte es gegeben hatte.
»Dich erwischt es aber auch immer«, sagte Dr. Dieter Behnisch zu seinem Freund Daniel.
»Mich hat’s zum Glück nicht erwischt«, brummte Daniel. »Um ein paar Minuten«, und dabei dachte er an Fee, die ihn mit ihren Abschiedsküssen diese Minuten aufgehalten hatte.
Schwester Melanie hatte sich des Kindes angenommen, das fast noch ein Baby war. Es war ein kleiner Junge mit gelocktem Haar, bestens gekleidet, wenngleich die Sachen, genau wie er, auch jetzt schmutzverkrustet waren. Aber außer ein paar Schrammen schien er ganz wie durch ein Wunder keine Verletzungen davongetragen zu haben.
Die junge Frau hatte es schlimmer erwischt. Ihre Kleidung war arg mitgenommen, und sie hatte eine beträchtliche Menge Blut verloren, dazu schwere Prellungen erlitten und einen Unterarmbruch. In Anbetracht der Katastrophe würde aber auch sie von Glück sagen können, so davongekommen zu sein, wenn sie erst wieder zu sich kommen würde.
Schwester Melanie hatte das Kind beruhigt. Es jammerte jetzt nur noch leise nach seiner Mami und schien müde zu sein.
Dr. Jenny Lenz hatte Dr. Behnisch assistiert und blieb bei der jungen Frau, nachdem sie ärztlich versorgt worden war. Nun wurden auch andere Verletzte gebracht, und jeder in der Klinik wurde gebraucht.
Dr. Norden rief in seiner Praxis an. Molly meldete sich schon aufgeregt und brach gleich verschreckt in Tränen aus, als er ihr sagte, was geschehen war, beruhigte sich aber schnell, als sie erfuhr, dass Fee auf der Insel geblieben war. Sie musste den wartenden Patienten nur erklären, warum der Doktor die Sprechstunde nicht pünktlich beginnen konnte.
Indessen kamen schon die ersten Radiomeldungen über das Unglück, und Fee hörte sie. Schreckensbleich lief sie zu ihrem Vater, der schnell sein Radio ausschaltete, als sie hereinkam.
»Ich habe es schon gehört, Paps«, flüsterte sie. »Es ist unsere Strecke. Daniel muss etwa zu der Zeit dort gewesen sein.«
»Beruhige dich, Kindchen«, sagte Dr. Cornelius, der seine eigene Erregung kaum verhehlen konnte. »Ich rufe gleich in der Praxis an.«
Dort war das Telefon dauernd besetzt, und Dr. Cornelius war heilfroh, als er Molly endlich an den Apparat bekam, denn Fee bebte am ganzen Körper und war außer sich vor Angst. In ihrem Zustand war das bedenklich, aber als Dr. Cornelius dann erfuhr, dass Daniel in der Behnisch-Klinik mit Erste Hilfe leistete, war er erleichtert, dass Fee nicht mit ihm gefahren war. Der grässliche Anblick hätte schlimmere Folgen haben können als die Minuten der Angst.
Auch einem Mann, von dem sie bis zu diesem Tage noch nicht gehört hatte, blieb fast das Herz stehen, als er aus dem Autoradio die Meldung hörte.
Er fuhr an den Straßenrand und stoppte. Penny und Tim waren in diesem Zug. Er hatte sie selbst zum Bahnhof gefahren.
»Warum sollst du erst diesen Umweg machen, Dirk«, hatte Penny gesagt. »Tim macht es sicher Spaß, mit der Eisenbahn zu fahren, und du bist schon an der Grenze, wenn der Verkehr dort richtig losgeht.«
Er, Dirk Holzmann, Verkaufsleiter der Schott-Gesellschaft, hatte eine kurze Geschäftsreise nach Wien machen müssen. Die drei Tage seiner Abwesenheit wollte Penny dann mit dem kleinen Tim bei seinen Eltern verbringen.
Dirk wurde es schwarz vor Augen. Er konnte minutenlang keinen klaren Gedanken fassen, dann aber wendete er seinen Wagen und fuhr zurück. Wie hätte er auch weiterfahren können, ohne zu wissen, was mit Penny und Tim war. »Mein Gott, hätte ich sie doch nur hingebracht«, murmelte er unaufhörlich.
Vielen Menschen erging es ähnlich wie ihm an diesem Morgen. Und manch einer wusste bereits, dass jede Hoffnung auf ein Wiedersehen mit einem geliebten Menschen vergeblich war. Mütter weinten um ihre Kinder, Frauen um ihre Männer, ein dürsterer Schatten des Grauens breitete sich über die Unglücksstätte, als Dirk Holzmann sie erreichte. Und dann begann das Suchen nach seiner Frau und seinem Kind, die entsetzlichsten Stunden seines Lebens, das bisher so glücklich und unkompliziert verlaufen war. Ein Telefongespräch mit seinen Eltern nahm ihm die winzige Hoffnung, dass Penny sich bei ihnen gemeldet haben könnte.
Es wurde später Nachmittag, bis er erfuhr, dass seine junge Frau schwerverletzt ins Kreiskrankenhaus eingeliefert worden war, doch von seinem kleinen Tim hatte man keine Spur gefunden. Es war nicht zu beschreiben, was Dirk Holzmann durchmachte, als man ihm Kleiderfetzen zeigte, einen winzigen Schuh, ein kleines, ensetzlich zugerichtetes Bündelchen, das er nicht ansehen konnte. Der Schock war zu entsetzlich! Und wie hätte es ein Trost für ihn sein können, dass es vielen anderen ebenso erging an diesem Tage wie ihm.
Er musste sein Kind, seinen geliebten kleinen Tim verloren geben. Pennys junges, blühendes Leben hing an einem hauchdünnen Faden. Es würde sofort verlöschen, wüsste sie, dass es keinen Tim mehr gab.
Noch nie hatte Dirk einen solchen lähmenden Schmerz kennengelernt. Ohne jeden Schicksalsschlag war sein Leben bisher verlaufen, immer in der goldenen Mitte, Schritt für Schritt vorwärts und aufwärts.
Als seine Eltern am Abend kamen, fanden sie einen um Jahr gealterten Dirk vor, grau im Gesicht, sie blicklos anstarrend, als wären sie Fremde.
»Junge«, sagte Walter Holzmann erschüttert, und von seiner Mutter wurde Dirk stumm in die Arme genommen.
»Sie lassen mich nicht mal zu Penny«, brachte er nach langer Zeit mühsam über die Lippen. »Sie haben mich weggeschickt, als hätte ich ihr etwas zuleide getan. Und Tim …«, er konnte nicht mehr weitersprechen. Trockenes Schluchzen schüttelte ihn.
»Vielleicht ist er gar nicht tot, vielleicht haben sie ihn in eine andere Klinik gebracht«, flüsterte Renate Holzmann.
»Es war sein Schuh, den sie mir gezeigt haben«, murmelte Dirk tonlos. Und dann redete er wirres Zeug, das den Regierungsdirektor Walter Holzmann veranlasste, sich genauer zu informieren.
*
Nachdem der panische Schrecken abgeklungen war, herrschte in den verschiedenen Kliniken wieder die gewohnte Nüchternheit, jedoch nicht in der Behnisch-Klinik. Dort weinte ein kleines Kind wieder schmerzlich nach seiner Mami. Antwort geben konnte es noch nicht auf die Fragen, die ihm gestellt wurden.
Der Kleine hatte ein paar Stunden geschlafen, aber nun schrie er jammervoll nach seiner Mami und dann auch nach seinem Papi.
Dr. Jenny Lenz befasste sich mit dem Kleinen, aber er war nicht zu beruhigen.
»Wie heißt du?«, fragte sie, aber er schüttelte nur wild das Köpfchen. »Will zu Mami, will zu Mami.«
Was sollten sie nur machen? Die junge Frau war noch immer bewusstlos, und wenn man den Kleinen zu ihr brachte, würde er womöglich erschrecken, sie mit dem verbundenen Kopf zu sehen. Und noch wusste man den Namen der jungen Frau nicht. Dr. Behnisch hatte sich sehr bemüht, aber von allen Verletzten war sie die wirklich einzige, die von niemandem gesucht zu werden schien.
Die Liste der Todesopfer war schlimm genug. Zweiundzwanzig Menschenleben hatte es gefordert, darunter fünf Kinder und zwei Babys.
Fünf Personen waren zur Behnisch-Klinik gekommen, aber niemand von ihnen hatte in der jungen Frau jene erkannt, die von ihnen gesucht wurde, niemand hatte das Kind vorher gesehen.
Dr. Behnisch ging ins Ärztezimmer, wo Jenny den Kleinen abzulenken versuchte. Mit verweinten Äuglein sah das bildhübsche kleine Kerlchen ihn an.
»Dotto?«, fragte er. »Kiekiek?« Und nun bekamen seine Augen auch noch einen ängstlichen Ausdruck.
»Nein, der Dotto macht nicht kiekiek«, erwiderte Dieter Behnisch, und Jenny konnte nur staunen, wie er sofort diese Kindersprache verstand und darauf einging.
»Sagst du dem Dotto, wie du heißt?«, fragte Dieter. Wieder schüttelte der Kleine den Kopf. Dann legte er ihn schief und blinzelte. »Bärle?«, fragte er.
»Bist du ein Bärle?«, fragte Dieter.
»Bärle haben, Hoppi. Mami gehn.«
Dieter Behnisch nahm den Kleinen auf den Arm. »Mami ist krank und muss im Bett liegen. Mami hat sich wehgetan.«
»Heile, heile machen.«
»Reden kann er. Wir müssen ihm Zeit lassen. Schätze, dass er zwei Jahre ist.«
»Sehr gepflegt, sehr gut gekleidet«, sagte Jenny. »Ein süßes Kind.«
»Papi fott?«, fragte der Kleine. »Tutauto fott. Mami gehn.«
»Du musst aber ganz lieb sein und Mami nicht erschrecken. Sie schläft«, sagte Dr. Behnisch.
Dr. Jenny Lenz war nicht ganz damit einverstanden, dass er den Kleinen in das Krankenzimmer brachte, aber Dieter hörte nicht auf ihre Warnung.
Erschrocken drückte das Kind sein Köpfchen an die Schulter des Arztes.
»Mami?«, wisperte es ängstlich. Und dann begann er doch wieder laut zu weinen.
»Mein Kind«, stöhnte die Kranke auf, »mein Kind.« Das Weinen hatte sie wieder aus der Bewusstlosigkeit geholt.
»Nicht Mami«, jammerte der Junge.
»Mein kleiner Toby«, hauchte die Kranke.
»Papi gehn«, flüsterte das Kind ängstlich.
Dr. Behnisch ging mit ihm hinaus. Er hat sich vor dem verbundenen Kopf erschrocken. Jenny hatte doch recht gehabt, sagte sich der Arzt.
Jenny war bei der Patientin geblieben. Sie streichelte deren Hand.
»Toby kommt wieder. Er ist jetzt müde«, sagte sie beruhigend.
»Sie hat ihn mir weggenommen. Sie hat mir mein Kind weggenommen«, stöhnte die Kranke.
»Wie heißen Sie?«, fragte Jenny Lenz. »Wir müssen es wissen. Wir möchten Ihre Angehörigen benachrichtigen.«
»Toby – nein, nein«, tönte es klagend an ihr Ohr und dann nichts mehr. Eine schreckliche Angst ergriff Jenny Lenz, dass das Herz versagen könnte, aber die junge Frau war nur wieder in einer tiefen Ohnmacht gefangen.
*
Für Dr. Norden hatte dieser Tag auch das schlimmste Grauen gebracht. Etwas so Entsetzliches hatte er noch nicht erlebt, wenngleich ihm als Arzt schon manches Schlimme nicht erspart worden war.
Nachdem er mit Fee telefoniert hatte, war er etwas ruhiger geworden, aber die furchtbaren Bilder gingen ihm nicht aus dem Sinn. Es war nur ein Glück, dass er heute nicht von seinen Patienten herumgehetzt wurde.
Lenchen hatte das Abendessen fast unberührt wieder abräumen müssen und meinte, dass er damit auch niemandem nütze, wenn er nichts esse.
Das gute schwerhörige Lenchen hatte nicht alles verstanden, was im Rundfunk berichtet wurde, weil ihr Hörgerät manchmal bockte, aber sie hatte wieder einmal Grund gehabt, der Technik für alles die Schuld zu geben, und es war müßig, ihr einreden zu wollen, dass gerade diesbezüglich an Bahnübergängen zu wenig getan würde.
Daniel hörte die neuesten Meldungen. Er hörte sie innerlich beteiligt
und mit Erregung und Anteilnahme. Staatsanwaltschaftliche Untersuchungen, fahrlässige Tötung? Menschliches Versagen? Auch damit waren die Toten nicht zum Leben zu erwecken, die Hinterbliebenen nicht zu trösten.
Der Gong schlug an. Daniel glaubte sich verhört zu haben. Es war schon nach zehn Uhr. Wenn ein Patient ihn brauchte, rief er an. Sollte etwa Fee …? Er dachte nicht weiter, sondern eilte zur Tür, aber vor ihm stand ein fremder Mann, so um die Fünfzig, sympathisch, aber sichtlich erschöpft und erregt.
»Verzeihung, Herr Dr. Norden, mein Name ist Holzmann. Es ist spät, aber ich muss Sie wegen des Unglücks sprechen. Meine Schwiegertochter …«, er geriet ins Stocken, fasste sich an die Kehle. Daniel stützte den schwankenden Mann, schob ihn in die Wohnung.
»Beruhigen Sie sich bitte erst«, sagte er fürsorglich, drückte den Mann in den Sessel, holte ein Glas Wasser und gab ein paar Beruhigungstropfen hinein, von denen er heute selbst welche genommen hatte.
»Ich bitte Sie um einige Auskünfte«, begann Walter Holzmann, nachdem er tief Luft geholt hatte. »Meine Schwiegertochter liegt schwerverletzt im Kreiskrankenhaus, aber ich hörte, dass Sie an der Unglücksstelle waren. Es geht um unser Enkelkind.«
Er fuhr sich mit dem Taschentuch über das Gesicht, rang sichtlich nach Fassung.
»Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann«, sagte Daniel gepresst, obgleich er nicht wusste, wie da zu helfen wäre.
»Mein Sohn ist unfähig, etwas zu unternehmen«, fuhr Walter Holzmann heiser fort. »Ich bin jetzt seit Stunden unterwegs, aber ich konnte unseren kleinen Enkel nicht identifizieren. Es war so schrecklich, was ich sehen musste. Entschuldigen Sie …«, er wischte sich Tränen aus den Augen.
»Ich verstehe Sie. Ich empfinde auch so«, sagte Daniel leise.
»Man sagte mir, dass Sie eine junge Frau und ein kleines Kind weggebracht hätten«, sagte Walter Holzmann stockend. »Es ist eine so winzige Hoffnung, aber vielleicht ist es unser Tim.«
»Ich weiß nicht«, murmelte Daniel. »Es schien, als gehörten die Frau und das Kind zusammen.«
»Es kann doch sein, dass sie in einem Abteil gesessen haben, dass diese junge Frau auch ein Kind bei sich hatte und dass nicht unser Tim tot ist, sondern dieses Kind. Es mag für andere grausam klingen, aber ich klammere mich an diese Hoffnung. Pennys Leben hängt an einem dünnen Faden, wenn sie erfährt, dass Tim tot ist …«, wieder unterbrach er sich. »Wir waren so glücklich, wir haben uns so gut verstanden. Penny wollte mit Tim zu uns kommen, weil mein Sohn eine Geschäftsreise antreten musste.« Er sprach mehr zu sich selbst, ein Mann, der bis ins Innerste verzweifelt war, obwohl er ganz so aussah, als hätte er immer tapfer seinen Mann gestanden.
»Es ist diese eine winzige Hoffnung«, flüsterte Walter Holzmann.
Und wenn es eine vergebliche sein sollte, war es wohl besser, er überzeugte sich gleich.
»Wenn Sie sich stark genug fühlen, könnten wir zur Behnisch-Klinik fahren, Herr Holzmann«, schlug Daniel vor. »Ich bin mit Dr. Behnisch befreundet.«
Der Mann richtete sich auf. Aus trüben, trostlosen Augen sah er Daniel an. »Ich danke Ihnen«, flüsterte er mit tonloser Stimmer.
*
Die Patienten in der Behnisch-Klinik schliefen, nur der Kleinste war munter. Er weinte nicht mehr und war schon zutraulicher geworden, aber zwischendurch sagte er nun immer wieder: »Papi gehn.«
»Morgen gehen wir zum Papi«, tröstete ihn Jenny Lenz und hoffte aus tiefstem Herzen, dass der dazugehörige Papi sich bis dahin gemeldet hatte. Alle möglichen Vermutungen hatte sie angestellt. Schließlich konnte es ja sein, dass die junge Frau mit ihrem Kind zu ihrem Mann hatte fahren wollen, dass er weit entfernt arbeitete und keine Ahnung hatte, dass sich seine Frau in dem Zug befand, vielleicht noch nicht einmal etwas von dem Unglück wusste.
Zusammengesunken saß Walter Holzmann neben Dr. Norden auf dem Beifahrersitz. »Bei uns war halt alles zu harmonisch«, murmelte er, »ohne jeden Konflikt. Unsere Penny, Tim … Dirk wird nie darüber hinwegkommen.« Dann versank er in Schweigen, und als sie bei der Behnisch-Klinik aus dem Wagen stiegen, war er kreidebleich.
Hoffentlich bekommt er nicht einen Herzanfall, ging es Daniel durch den Sinn. Wir müssen gleich Vorsorge treffen.
Aber er kam gar nicht richtig dazu, Dr. Behnisch eine ausreichende Erklärung zu geben. Aus einem Zimmer, dessen Tür einen Spalt offenstand, klang das Geplapper eines Kindes. »Nun Papi gehn.« Und da eilte Walter Holzmann schon auf diese Tür zu.
Daniel und Dieter Behnisch liefen hinter ihm her, hörten ein Aufstöhnen, ein erschütterndes Aufschluchzen: »Tim, Timmi, mein Liebling«, und dann der Kleine: »Oppi-hoppi, Oppi, Oppi.« Er jauchzte, und der Mann drückte den Kleinen an sich, während Tränen über seine Wangen rannen.
Die kleinen Hände streichelten sein Gesicht. »Nicht weine-weine, Oppi. Mami Wehweh, schläft.«
»Herrgott, ich danke dir«, flüsterte Walter Holzmann. »Es ist unser Tim.«
Dr. Norden und Dr. Behnisch tauschten einen langen Blick. Daran konnte kein Zweifel bestehen, dass dies das Kind war, das Walter Holzmann gesucht hatte, aber auch jene Patientin in Zimmer vierzehn weinte ganz jämmerlich nach ihrem Kind. Was des einen Glück, war der andern Leid.
»Ich kann ihn doch mitnehmen?«, fragte Walter Holzmann.
»Gewiss«, erwiderte Dr. Behnisch. »Er ist mit ein paar Schrammen davongekommen. Ein wahres Wunder!«
»Wir können es brauchen«, sagte Walter Holzmann. »Seine Mami ist schlimm dran.« Er hielt inne, dann: »Wäre es wohl möglich, dass wir Penny in diese Klinik bringen lassen? In diesem großen Krankenhaus ist alles so schrecklich nüchtern. Was menschenmöglich ist, möchte ich für meine Schwiegertochter getan wissen.«
Dr. Behnisch dachte an seinen Chefarzt, der recht selbstherrlich »regierte«.
»Von mir aus steht dem nichts im Wege«, erklärte er, »wenn Ihre Schwiegertochter transportfähig ist und Sie die Überführung veranlassen?«
»Ich werde mich gleich morgen darum kümmern. Jetzt soll unser Timmi heim zu Papi und Omi und in sein Bettchen.«
»Mami auch«, verlangte Tim.
»Mami kommt auch heim, bald«, sagte Walter Holzmann tröstend. »Würden Sie mir bitte ein Taxi rufen?«, bat er Daniel.
»Ich bringe Sie nach Hause«, sagte Daniel.
»Wie soll ich Ihnen nur danken«, stammelte Walter Holzmann.
»Tim hatte einen Schutzengel, ich konnte ihm nur ein bisschen helfen«, erwiderte Daniel.
*
Renate Holzmann stand im ersten Moment wie versteinert, stammelte unzusammenhängende Worte und nahm Tim dann behutsam, als zweifele sie an der Tatsache, ihn lebend in den Armen halten zu können, an ihr Herz.
»Papi?«, fragte Tim.
»Dirk ist zu Penny gefahren. Man hat ihn gerufen«, sagte Renate Holzmann bebend. »Sie ist zu Bewusstsein gekommen. Sie wird nach Tim fragen.«
»Ich muss sofort ins Krankenhaus«, sagte Walter Holzmann hastig.
»Überlassen Sie das ruhig mir«, bot sich Daniel an. »Sie sind doch mit den Nerven fertig, Herr Holzmann. Darüber sind wir uns im Klaren. Und ich kenne dort Kollegen.«
Dass man seine Einmischung nicht freudig dulden würde, war ihm auch klar, aber irgendwie war es für ihn eine gelinde Erleichterung, dass dieser Tag nicht ganz deprimierend zu Ende ging. Ein kleines Kind war in die Geborgenheit seiner gewohnten Umgebung zurückgekehrt. Vielleicht war diesen lieben Menschen auch beschieden, ihre Schwiegertochter zu behalten. Selten hatte Dr. Norden es erlebt, dass eine Schwiegertochter so abgöttisch geliebt wurde, wie es hier der Fall war.
Und dann konnte er auch noch erleben, dass auch Dirk Holzmann seine Frau unendlich liebte und mit ihr litt.
Daniel hatte ein bisschen Glück, weil Dr. Dahm Dienst hatte. Er war noch jung, und von ihm wusste er, dass er hier in diesem Krankenhaus nicht die berufliche Erfüllung gefunden hatte, die er sich wünschte. Er hatte sich nicht in die Maschinerie eingeordnet.
»Wie steht es um Frau Holzmann?«, fragte Daniel, nachdem er schnell den Grund seines Kommens erklärt hatte.
»Es besteht Hoffnung«, erwiderte Dr. Dahm, »aber wenn das Kind tot wäre …«
»Es lebt«, unterbrach ihn Daniel, »und sie muss es schnellstens und überzeugend erfahren. Lassen Sie mich zu ihr ins Zimmer.«
Leise öffnete er die Tür und hörte, wie Penny Holzmann sagte: »Ich glaube es erst, wenn ich Tim sehe. Bring ihn mir, Dirk.«
Und da saß dieser hilflose, noch unwissende, verzweifelte Mann, in sich zusammengesunken. Daniel trat an ihn heran, legte seine Hand auf die zuckende Schulter. »Ich bin Dr. Norden«, sagte er. »Ich habe Ihren Sohn eben zu Ihren Eltern heimgebracht. Es ist ihm nicht viel passiert.«
Man sah es Dirk Holzmanns Blick an, dass er diesen Worten nicht glaubte, sondern sie nur für eine Täuschung hielt, um Penny zu beruhigen.
Sie schluchzte glücklich auf. »Ich kann ihn morgen sehen?«, fragte sie.
»Ja, Sie können ihn morgen sehen«, bestätigte Dr. Norden.
»Verzeih mir, Dirk, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ich hatte so schreckliche Angst. Jetzt geht es mir schon besser. Es tut nicht mehr so weh.« Sie sank zurück, und Dirk Holzmann starrte Daniel Norden entsetzt an.
»Sie schläft«, sagte Dr. Norden beruhigend. »Und Sie sollten jetzt auch heimfahren und schlafen, Herr Holzmann.«
Aber Dirk wollte doch erst wissen, was sich nun wirklich erreignet hatte. Es war verständlich. Daniel hatte noch niemals einen Mann so haltlos und erleichtert weinen sehen.
*
Mitternacht war vorbei, als Daniel endlich ins Bett sank, und er war so müde, dass er allen Aufregungen zum Trotz sofort einschlief, so tief, dass keine Träume Gestalt annehmen konnten.
Dirk Holzmann schlief mit seinem Söhnchen im Arm nicht so tief. Er lauschte immer wieder auf den Atem des Kindes, er dachte an seine Penny und schickte flehende Bitten zum Himmel, dass auch sie ihm erhalten bleiben möge. Diesen Schock würde er lange nicht vergessen.
Vielen Menschen erging es ebenso, andere weinten in der Hoffnungslosigkeit, geliebte Menschen verloren zu haben.
In ihrem Bett im Zimmer vierzehn der Behnisch-Klinik erwachte eine junge Frau aus der Bewusstlosigkeit. Sie erinnerte sich nicht daran, was mit dem Bus geschehen war, in dem sie gesessen hatte. Sie erinnerte sich an etwas anderes, das ihre Seele zerquälte.
Sie läutete an einer Haustür. Sie sah eine hagere Frau vor sich stehen.
»Du? Was willst du hier?«, gellte eine schrille Stimme in ihren Ohren.
»Ich komme heim, Mutter.«
»Sag nicht Mutter zu mir. Geh dahin, wohin du gehörst. Dieses Haus betrittst du nicht mehr. Es ist mein Haus.«
Mein Haus, mein Haus, mein Haus, wie oft hatte sie das gehört.
»Ich will zu meinem Kind«, hatte sie gesagt.
»Tobias ist nicht da.«
»Wo ist er? Sei nicht unbarmherzig. Ich habe doch nichts getan.«
»Du bist verrückt. Bist du ausgerissen? Man hat dich doch nicht freiwillig gehen lassen.«
»Wo ist Toby, wo ist Bert?«
»Ich rufe die Polizei, wenn du nicht verschwindest. Ich lasse dich zurückbringen. Du bist gemeingefährlich. Lass meinen Sohn in Ruhe. Das Kind bekommst du nicht mehr zurück.« Und dann war die Tür zugefallen.
Zitternd, schweißgebadet lag sie nun in einem Bett und wusste nicht, was zwischen gestern und heute geschehen war.
»Ich bin nicht wahnsinnig«, sagte sie vor sich hin, laut und deutlich, nicht ahnend, dass jemand es hörte. »Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Sie will es. Aber ich will mein Kind haben, mein Kind. Es gehört mir. Bert kann es doch nicht wollen, dass ich auch dieses Kind verliere.«
Eine weiche, behutsame Hand legte sich auf ihren Arm. Ein Gesicht beugte sich über sie.
»Brauchen Sie etwas?«, fragte eine sanfte Stimme.
»Nein, habe ich etwas gesagt?«
»Nein«, erwiderte die Stimme.
»Ich habe geträumt. Wo bin ich?«
»In der Behnisch-Klinik. Erinnern Sie sich an den Unfall? Waren Sie im Zug oder im Bus?«
»Im Bus. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Ich möchte Toby holen. Wo ist Toby?«
Jenny Lenz dachte vieles. Die Patientin zeigte so merkwürdige Reaktionen, dass sie nicht an Fieberphantasien glauben konnte.
»War Toby bei Ihnen?«, fragte sie.
»Nein. Ich weiß nicht, wo er ist.«
»Und wir wissen bis jetzt nicht Ihren Namen. Wir werden Toby holen, wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse sagen.«
Die junge Frau richtete sich auf. Starr waren ihre Augen auf Jenny gerichtet.
»Ich kenne Sie nicht. Hat sie mich wieder zurückbringen lassen? Sind Sie neu?«
Jennys Gedanken überstürzten sich. »Sie sind in der Behnisch-Klinik«, wiederholte sie noch einmal betont. »Ich bin Dr. Jenny Lenz. Sie wurden hier nach einem Unfall eingeliefert. Aber ich kann Ihren Toby nicht holen, wenn Sie mir Ihren Namen nicht sagen.«
Die blassen Lippen der jungen Frau zuckten. »Sie sagt, dass ich verrückt bin. Sie will mich aus dem Hause haben. Sie hat uns auseinandergebracht. Ich bin nicht verrückt. Ich kann nichts dafür, dass das Kind nicht gelebt hat, mein kleines Mädchen. Mein armes kleines Mädchen.«
Würde sie noch mehr sagen? Jenny wollte jetzt kein noch größeres Risiko eingehen. Es war schon möglich, dass der Schock den Geist dieser jungen Frau verwirrt hatten. Sie gab ihr eine Spritze. Die Kranke spürte es kaum. Schwer atmend lag sie in den Kissen.
»Ich heiße Birgit Blohm«, flüsterte sie. »Meine Schwiegermutter sagt, dass ich verrückt bin.«
Monoton leierte sie es herunter, schon im Einschlafen begriffen. Aus ihren Augenwinkeln hatten sich Tränen gelöst. Sanft wurden diese von Jenny in überströmendem Mitleid abgetupft.
Sie konnte jetzt nicht beurteilen, ob und wie weit der Geist dieser jungen Frau verwirrt war, aber sie war überzeugt, dass sie Schreckliches erlebt hatte, was mit dem Unfall nichts zu tun hatte. Sie war ein Mensch, dem man helfen musste!
Später, als sie in ihrem Zimmer saß, rief sie sich noch einmal alles in die Erinnerung zurück, was die junge Frau gesagt hatte, und sie machte sich Notizen. Sie wollte Dr. Behnisch jetzt nicht wecken, so gern sie auch mit ihm darüber gesprochen hätte, aber morgen, nein, heute war es schon, standen zwei Operationen auf dem Plan. Er brauchte seine Ruhe nach diesem schrecklichen, turbulenten Tag.
Dr. Jenny Lenz dachte nicht daran, dass auch sie eine Nachtruhe nötig gehabt hätte. Sie war wieder einmal eisern und zuverlässig wie immer, und doch mehr bewegt als sonst von einem menschlichen Schicksal, das in rätselhaftem Dunkel lag.
*
Bevor für Dr. Norden der Arbeitstag begann, rief er Fee an. Er musste ihr erzählen, dass bei allem Unglück nun doch noch ein Hauch von Glück zu ahnen war. Sie erkundigte sich sogleich, was nun mit der anderen jungen Frau wäre.
»Du musst dich darum kümmern, Dan«, sagte sie. »Wenn wir ihr helfen können, schick sie uns.«
Ja, wenn man helfen könnte! Er rief in der Behnisch-Klinik an. Dieter war schon im OP, Jenny sollte nach dem langen Nachtdienst nicht gestört werden.
Dieter schafft das auch nicht, dachte Daniel besorgt. Verlassen kann er sich tatsächlich nur auf Jenny.
Er fuhr hinunter in die Praxis. Dort musste er auch Molly Bericht erstatten. Helga Moll, die selbst Mutter von drei Kindern war, fühlte mit allen Müttern. Kaum einer der Patienten sprach nicht von dem Unglück. Das legte sich bei Molly ebenso aufs Gemüt wie bei Daniel. Aber die Arbeit musste doch getan werden.
Daniel fuhr am frühen Nachmittag zur Behnisch-Klinik. Dr. Jenny Lenz war schon wieder auf ihrem Posten, und man sah ihr die durchwachte Nacht nicht an.
Dr. Behnisch hatte Neuigkeiten aus dem Kreiskrankenhaus. »Ich habe von dem Chef vielleicht was zu hören bekommen. Ihm die Patienten wegstehlen und so. Er fühlt sich wie der liebe Gott persönlich, aber vor dem Regierungsdirektor Holzmann hat er dann doch kapituliert. Morgen wird Frau Holzmann hierher verlegt. Aber Dr. Dahm hat auch eine Abreibung bekommen.«
»Daran bin ich wohl schuld«, sagte Daniel. »Das wäre doch eigentlich ein Arzt für dich, Dieter. Ordentlicher Bursche. Kann auch was.«
»Eine Karriere ist bei mir aber nicht drin, das weißt du doch.«
»Und dort ist er Ausputzer. Er ist zu sensibel, um sich durchzusetzen.«
»Man kann ja mal mit ihm reden.«
»Habt ihr etwas über die Verletzte erfahren?«, fragte Daniel.
»Sie sagt, sie heiße Birgit Blohm. Viel mehr wissen wir noch nicht. Sprich mal mit Jenny. Sie hat aufgeschrieben, was sie phantasiert hat. Jenny misst dem einige Bedeutung bei. Du weißt ja, wie die Frauen sind. Sie reimen sich schnell was zusammen. Jenny mach da keine Ausnahme.«
Daniel sprach mit Jenny. »Ich habe schon sämliche Blohms in München angerufen, aber niemand vermisst eine Birgit. Man hört ganz schön dumme Antworten, Daniel.«
»Kannst du sie nicht fragen, wo sie wohnt?«
»Sie ist wieder ganz verschlossen. Wahrscheinlich erinnert sie sich nicht daran, was sie gesagt hat. Als ich sie mit ihrem Namen ansprach, geriet sie in panische Angst. Ich habe mir schon alles Mögliche durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht kommt sie aus dem Gefängnis, wenn sie auch durchaus nicht wie eine Kriminelle wirkt. Vielleicht war sie tatsächlich in einer Nervenheilanstalt. Es ist schwierig, sich da ein Bild zu machen. Ihre Reaktionen sind unterschiedlich, aber ich bin überzeugt, dass sie ein Kind hatte oder hat und dass sie eines verloren hat. Sie spricht, oder besser sie sprach von einem Jungen, Toby, und von einem Mädchen. ›Mein armes, kleines Mädchen‹, sagte sie. Hier, du kannst die Notizen lesen, die ich mir gemacht habe.«
Daniel las sie aufmerksam und sah Jenny nachdenklich an. »In der Schockwirkung mischen sich Wahrheit und Vorstellung. Aber immerhin sind wir doch schon einen Schritt weiter. Wenn der Name stimmt, werden wir die Angehörigen ausfindig machen.«
»In einem solchen Zustand, in einer so furchtbaren Konfliktsituation, ist es nur ein winziger Schritt zum Wahnsinn«, sagte Jenny gedankenvoll. »Erstaunlich ist allerdings ihr Lebenswille. Diese Frau will nicht kapitulieren. Ich bin sehr gespannt, was wir da noch erfahren werden.«
*
Etwa zur gleichen Stunde betrat ein schlanker, mittelgroßer Mann das Sanatorium Breitenstein. Man konnte hier nicht einfach hineinspazieren. Ein gewichtiger Mann öffnete die schwere Eichentür. Bestürzt blickte er den Mann an.
»Herr Blohm?«
»Erkennen Sie mich nicht? Ich möchte meine Frau besuchen.«
»Ich werde den Chefarzt verständigen«, stotterte der Mann.
»Was ist mit meiner Frau? Hat sich ihr Zustand wieder verschlechtert?«
»Der Herr Chefarzt wird Ihnen schon Auskunft geben«, brummte der Mann verlegen.
Bert Blohm wartete in der kühlen Halle. Es fröstelte ihn. Kann man hier denn gesund werden, ging es ihm durch den Sinn.
Er musste ziemlich lange warten, dann sah er sich dem grauhaarigen Chefarzt gegenüber, der einen wahnsinnig nervösen Eindruck machte.
»Ist Ihre Frau denn nicht zu Hause angekommen?«, fragte er.
»Zu Hause angekommen?«, wiederholte Bert Blohm mechanisch. »Wie meinen Sie das?«
»Wir haben sie doch vor drei Tagen entlassen. Es bestand keine Veranlassung, sie noch hier festzuhalten. Sie hatte außerdem ihren Anwalt eingeschaltet, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie nicht zu Ihnen zurückkehren wollte. Sie hatte Sehnsucht nach ihrem Sohn.«
»Warum haben Sie mich nicht benachrichtigt?«, fragt Bert Blohm erregt.
»Ich hatte mit Ihrer Mutter schon telefoniert. Aber sie sagte mir, dass Sie augenblicklich nicht erreichbar seien.«
»Aber Sie konnten meine Frau doch nicht einfach gehen lassen, so allein«, sagte Bert Blohm.
»Es passierte eine Panne«, gestand der Chefarzt ein. »Irgendwie gelangte Ihre Frau aus dem Haus und war verschwunden. Sie können mir dennoch keinen Vorwurf machen. Ihre Frau ist gesund. Ich hätte mich strafbar gemacht, sie länger hier festzuhalten, und falls Sie etwas gegen mich unternehmen wollen, muss ich Ihnen sagen, dass ich Gegenmaßnahmen ergreifen werde.«
»Welcher Art?«, fragte Bert Blohm kalt.
»Dass in Ihrem Haus alles getan wurde, um den Geist Ihrer Frau zu verwirren.«
»In meinem Hause? Sind Sie denn auch wahnsinnig? Natürlich, hier muss man das ja werden«, brauste Bert auf.
»Dann wundert es mich, dass Sie Ihre Frau ausgerechnet hierhergebracht haben«, konterte der Chefarzt aggressiv.
»Meiner Mutter war Ihre Klinik bestens empfohlen worden. Ich hatte gerade einen auswärtigen Auftrag zu erfüllen, als meine Frau den Nervenzusammenbruch bekam. Selbstverständlich werde ich Sie zur Verantwortung ziehen, wenn meiner Frau etwas passiert sein sollte! Jeden Schuldigen werde ich zur Verantwortung ziehen«, rief Bert Blohm außer sich vor Erregung.
»Vielleicht fangen Sie dann erst einmal bei Ihrer Mutter an«, erklärte der Chefarzt.
»Bei meiner Mutter? So wollen Sie sich aus der Affäre ziehen? Nun, wir werden es sehen.«
Und dann stürmte er hinaus. Sein Herz schlug wie ein Hammer. Er bekam kaum noch Luft. Er blickte zurück zu dem großen grauen Gebäude, das ihm plötzlich wie ein Gefängnis erschien. Auf die maßlose Erregung folgte jähe Ernüchterung, dann schien sein Blut wie ein glühender Strom durch die Adern zu rinnen. Er wollte zurück, sich auf den Chefarzt stürzen, blind vor Wut. Dies alles bewegte sein Gemüt in Blitzesgeschwindigkeit. Aber dann erwachte die Furcht in ihm, dass wahr sein könnte, was der Arzt gesagt hatte.
Langsam ging Bert Blohm zu seinem Wagen zurück. Natürlich wollte sich der Arzt reinwaschen von einer Schuld, und dazu konnte ihm jedes Mittel recht sein. Aber wie er das gesagt hatte: »Dann fangen Sie erst einmal bei Ihrer Mutter an!«
Ich muss Birgit finden, zuerst muss ich Birgit finden, dachte Bert. Aber wo sollte er sie suchen? Vor drei Tagen hatte sie das Sanatorium verlassen. Schon vor drei Tagen! Und mit dem Auto brauchte er gerade eine Stunde, um nach Hause zu fahren.
Aber Birgit hatte kein Auto. Sie musste den Zug oder den Bus benutzen. Oder sie hatte einen Wagen angehalten. Birgit? Nein, Birgit würde sich nicht zu einem Fremden in den Wagen setzen. Sie war zurückhaltend, fast scheu.
Langsam fuhr er die Strecke. Dort war die Autobushaltestelle. Bestimmt brauchte man zehn Minuten bis dorthin, und mit dem Bus waren es dann sicher nochmals zehn Minuten bis zum Bahnhof. Ob er dort einmal fragte?
Aber er wusste ja nicht einmal, was sie für Kleidung getragen hatte. Ja, was hatte sie eigentlich für Kleider und Mäntel gehabt? War es nicht schlimm, dass er dies nie so genau beachtet hatte? Dass er immer tadellos gekleidet war, dafür Kritik daran übte, dass seine Krawatten zu auffällig seien, dass ein seriöser Mann nur weiße Oberhemden tragen dürfe und dass diese modischen Anzüge unpassend für seine Position seien.
Sicher hatte es gewisse Reibereien zwischen seiner Mutter und Birgit gegeben, aber das rechtfertigte doch nicht solche Anschuldigungen, wie der Chefarzt sie geäußert hatte!
Doch, wohin sollte Birgit gegangen sein, wenn nicht nach Hause zu Toby, zu dem Kleinen, an dem sie mit so abgöttischer Liebe hing?
Birgit hatte sich so sehr mehrere Kinder gewünscht, und als sie dann wieder eines erwartete, bekam Toby die Röteln und steckte Birgit an.
Der Arzt hatte gleich Bedenken geäußert, dass das ungeborene Kind dadurch schwer geschädigt werden könnte. Birgit hatte es nicht glauben wollen. Seine Mutter hatte ihr dann die Bedenken, die schließlich doch kamen, nachdem sie mehrere Ärzte konsuliert hatte, ausgeredet. Und dann war es so gekommen, dass das Kind nur ein paar Stunden lebte, glücklicherweise konnte man da noch sagen, denn es wäre niemals ein normales Kind geworden.
Birgit hatte damals maßlos gelitten, wenn sie es anfangs auch nicht verlauten ließ. Birgit war nicht der Mensch der seinen Schmerz hinausschreien konnte. Sie hatte in früher Jugend schon zu viel Leid erlebt, als sie kurz nacheinander beide Eltern verlor. So richtig fröhlich war sie nie gewesen, aber Bert hatte ihre stille, besinnliche Art geliebt. Auch in seinem Elternhaus war es nicht fröhlich zugegangen. Da hatte immer der »feine Ton« geherrscht. Er ahnte nicht, dass Birgit seine Mutter ganz anders kennengelernt hatte und dass die letzte Erinnerung an sie grauenhaft für sie war und ihr Leben völlig verändern sollte.
*
Jenny Lenz hätte nicht erklären können, warum sie sich etwas davon versprach, dass sich Daniel Norden mit Birgit Blohm unterhielt. Er betrachtete die junge Frau als seinen Schützling, und ein bisschen neugierig war er auch, was hinter Birgits widersprüchlichen Reaktionen stecken mochte.
Jetzt, als er sich an ihrem Bett niederließ und ihr gesagt hatte, dass er sie gefunden und in die Behnisch-Klinik gebracht hätte, zeigte sie eine erschreckende Reaktion.
»Es wäre besser, ich wäre tot und Sie hätten jemand anders gerettet«, sagte sie voller Bitterkeit.
Ja, bitter klang es, aber nicht so, als wäre sie ihrer Sinne nicht mächtig. Im Gegenteil, er gewann den Eindruck, dass sie ihn mit kühlem, sehr klarem Verstand betrachtete.
»Ich weiß nichts von diesem Unglück. Von mir können Sie nichts weiter erfahren«, sagte sie.
»Ich bin Arzt, nicht Polizist«, erwiderte er. »Ich kam rein zufällig im richtigen Augenblick.
»Für mich im falschen«, korrigierte Birgit. »Mir bedeutet das Leben nichts. Anderen hätte es sicher viel bedeutet. Um mich trauert auch niemand.«
»Und Ihr Kind?«, fragte er.
Ihr Gesicht versteinerte. »Was wissen Sie von meinem Kind?«
»Dass es Ihre Gedanken so sehr ausfüllt, dass Sie Ihre Schmerzen darüber vergessen. Sie wollen Ihr Kind doch wiedersehen, Frau Blohm.«
Sie lachte blechern auf, und das tat seinen Ohren weh, denn es passte nicht zu den Augen und zu dem schönen weichen Mund.
»Sie werden dafür sorgen, dass ich mein Kind nicht mehr wiedersehe, Herr Doktor«, kam es mit klirrender Stimme. »Und wahrscheinlich werden Sie mich wieder dorthin zurückbringen, woher ich kam. Aber auch das ist mir jetzt gleichgültig. Nur wäre es besser gewesen, Sie hätten mich sterben lassen.«
»Na, dazu waren Sie aber ein bisschen zu lebendig«, entgegnete er lächelnd. »Frau Blohm, Sie sind eine vernünftige junge Frau, die wahrscheinlich ihre Probleme hat, aber es gibt Menschen, die Ihnen helfen werden, diese Probleme aus der Welt zu räumen.«
Die Kranke schüttelte den Kopf, sah ihn mit traurigem Blick an.
»Ich habe niemanden. Oder glauben Sie, dass mein Mann mir mehr glauben würde als seiner Mutter?«, entfuhr es ihr. Dann presste sie erschrocken die Lippen aufeinander.
»Das kann ich nicht beurteilen«, erwiderte Daniel nach kurzem Zögern. »Ich erfahre in meiner Praxis sehr viel über menschliche Konflikte. Es kommt aber auf den Betroffenen an, sich dagegen zu wehren. Jeder Mensch hat das Recht dazu. Man kann sich natürlich auch in die Dulderrolle drängen lassen und sich damit abfinden. Es kommt darauf an, wie man sich selbst begreift, und in Ihrem Fall scheint es mir darauf anzukommen, wie viel Ihr Kind Ihnen tatsächlich bedeutet. Denken Sie einmal darüber nach. Vielleicht kommen Sie zu der Überzeugung, dass Sie mit einem Menschen Ihre Probleme durchsprechen sollten. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, oder wenn Sie eine Frau vorziehen, wird Dr. Jenny Lenz die richtige Gesprächspartnerin für Sie sein. Aber verstecken Sie sich bitte nicht hinter dem Vorurteil, dass alle Menschen Ihnen feindlich gesinnt sind.«
Er nahm ihre unverletzte Hand und hielt ihren Blick fest. Zuerst schien es, als wollte sie diesem ausweichen, doch dann hielt sie ihm stand. Und Dr. Norden las in ihren Augen die Qualen, die sie litt.
»Ich werde darüber nachdenken, Herr Doktor«, sagte sie verhalten.
»Und Sie bestehen weiterhin darauf, dass niemand benachrichtigt wird?«
»Lassen Sie mir bitte noch einen Tag Zeit. Vielleicht kann ich jetzt alles klar überdenken. Sie haben den Anstoß gegeben.«
»Manchmal wird man zum Kampf herausgefordert, wenn man dazu auch nicht geboren ist. Selbstverteidigung ist auch von Gesetzes wegen erlaubt. Wer einen geistig gesunden Menschen in ein Nervensanatorium sperrt, macht sich strafbar.«
»Können Sie Gedanken lesen?«, fragte Birgit leise.
»Das will ich nicht sagen, aber ich bin schon lange genug Arzt, um die Menschen zu kennen, und im Kombinieren war ich schon immer gut.«
»Und Humor haben Sie. Wenn Bert doch auch nur ein bisschen Humor hätte, aber fast möchte ich glauben, dass in seinem Elternhaus das Lachen verboten war.«
Wie von selbst begann sie zu sprechen, und Daniel Norden erfuhr die Geschichte einer Frau, die durchaus nicht außergewöhnlich war und doch der Dramatik nicht entbehrte.
*
Im Alter von siebzehn Jahren war Birgit Gülden Waise geworden. Als Kapitän eines Handelsschiffs hatte ihr Vater seine Frau und seine Tochter mit auf eine Ostasienreise genommen. Dort waren sie von einer seltenen Viruskrankheit befallen worden, von der Birgit verschont geblieben war. Warum gerade sie, hatte sie sich immer wieder gefragt und sich gewünscht, mit ihren toten Eltern vereint zu sein.
So hatte sie es dann auch drei Jahre später ausgesprochen, als sie in der gleichen Firma wie Bert Blohm als Auslandskorrespondentin tätig war und sich mit dem jungen Abteilungsleiter manchmal unterhalten hatte.
Es war keine Liebe auf den ersten Blick gewesen. Dazu waren sie beide nicht geschaffen. Bert lebte mit seiner verwitweten Mutter zusammen und war gewöhnt, Rücksicht auf sie zu nehmen. Und Gnade fand Birgit auch nur vor ihren Augen, nachdem sich Adelheid Blohm insgeheim nach den Vermögensverhältnissen des Mädchens erkundigt hatte. Das jedoch wussten weder Bert noch Birgit.
Birgits Vater hatte eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen. Er war auch sonst gut situiert gewesen, und Birgit war nach dem tragischen Tod ihrer Eltern anspruchsloser denn je.
Bei den Blohms sah es etwas anders aus, denn Adelheid Blohm führte ein aufwändiges Leben. Ihr Haus war mit Hypotheken überlastet, als ihr Mann starb, der durch Fehlspekulationen an den Rand des Ruins gekommen war. Sie war darauf bedacht, dass ihr Sohn eine gute Partie machte, sonst hätte sie sich wohl gegen jede Heirat gesträubt.
Davon jedoch erfuhr Dr. Norden nichts. Birgit sah alles anders.
Dass Geld eine Rolle bei dieser Heirat gespielt haben könnte, hatte sie anfangs nicht erwogen, aber dann hatte sie es doch bemerkt. Später, nach der Hochzeit …
»Wir freundeten uns an«, erklärte sie das Kennenlernen mit Bert. »Er war so ruhig und besonnen und nicht so wie andere Männer, die nur Vergnügen im Kopf haben. Bert war der erste Mensch, mit dem ich wieder richtig reden konnte seit dem Tode meiner Eltern. Er stellte mich seiner Mutter vor. Sie war sehr reserviert, aber nicht unfreundlich. Eigentlich war sie es, die alles forcierte, und Bert sagte einmal, dass er nie so schnell den Mut gehabt hätte, mir einen Heiratsantrag zu machen, wenn seine Mutter ihn nicht dazu gedrängt hätte. Er freute sich, dass seine Mutter so einverstanden mit seiner Wahl war.«
Sie machte eine lange Pause, und Dr. Norden ließ ihr Zeit, obgleich er langsam in Zeitnot geriet. Aber er ahnte, dass sie nie wieder den Faden finden würde, wenn er sich jetzt verabschiedete. Sie würde nachdenken und meinen, zu viel über sich gesagt zu haben.
»Wir waren eigentlich sehr glücklich, erst recht, als Tobias geboren wurde«, fuhr Birgit fort. »Berts Mutter war viel auf Reisen. Wir lebten in ihrem Haus, hatten aber getrennte Wohnungen. Sie bemängelte schon hin und wieder, dass ich zu viel Geld für Kleidung ausgeben würde, aber das war ja mein Geld. Ich wollte, dass mein Mann immer gut aussah.«
»Und Sie selbst hoffentlich auch«, half Daniel ihr.
»Ach, ich brauchte nicht viel. Ich kaufte mir natürlich hübsche und gute Sachen, aber nicht so, dass es zu viel gewesen wäre. Wir gingen ja auch nur ganz selten aus. Und außerdem hatte ich das meiste Geld …«, sie unterbrach sich und senkte den Blick.
»Was war mit dem Geld?«, fragte Daniel. »Ich will nicht neugierig sein, aber anscheinend hatten Sie doch eine hübsche Mitgift mit in die Ehe gebracht, wenn ich richtig kombiniere.«
»Vati hatte gut vorgesorgt«, sagte Birgit leise, »aber weil doch die Hypothek fällig war, war es selbstverständlich, dass ich es meiner Schwiegermutter gab. Ich dachte auch, dass sie dann nicht immer davon sprechen würde, dass es ihr Haus sei, in dem wir leben.«
Viel zu kombinieren brauchte Daniel nun nicht mehr. Ihm fehlte eigentlich nur noch die Erklärung, warum es dann später zu jenem Eklat gekommen war, der diese junge Frau jedes Lebenswillens beraubt hatte.
Doch diese Erklärung blieb ihm vorenthalten, da nun Dr. Behnisch mit einem fremden Mann das Krankenzimmer betrat.
»Inspektor Grünberg möchte nur ein paar Fragen an Sie stellen, Frau Blohm«, sagte Dr. Behnisch. Daniels fragenden Blick beantwortete er mit einem Achselzucken.
»Ich fühle mich nicht wohl«, sagte Birgit.
Daniel dachte daran, wie viel Patienten er für den Nachmittag bestellt hatte. Molly würde schon wie auf Kohlen sitzen. Und was sollte er hier noch ausrichten? Er hoffte, dass Birgit Blohm sich dieser Situation gewachsen zeigte. Er hoffte, dass sie sich nicht wieder in Schweigen verlor.
Er hoffte dies nicht umsonst.
*
Tobias, vier Jahre alt, stand mit gesenktem Kopf vor seinem Vater, als Bert Blohm zu Hause angekommen war.
»Willst du mir nicht guten Tag sagen, Toby?«, fragte Bert.
»Tag«, stieß der Junge hervor.
»Warum hast du geweint?«, fragte Bert.
»Mami war hier, und Großmama sagt, dass es nicht wahr ist.«
»Er redet Unsinn«, sagte Adelheid Blohm mit schriller Stimme. »Er widerspricht mir überhaupt dauernd. Er ist so richtig im Trotzalter.«
»Sage gar nichts«, erklärte Toby, die Hände auf dem Rücken verschränkend. »Aber Mami war doch da. Habe ihre Stimme gehört, aber Großmama hat mich eingesperrt.«
»Ich weiß nicht, von wem der Junge das hat, aber er ist entsetzlich ungezogen«, sagte Adelheid Blohm. »Es wird Zeit, dass du wieder zu Hause bist und deine Autorität geltend machst.«
Bert sah seine Mutter an. »Die hast du doch wohl mehr als ich, Mutter«, sagte er. »Komm jetzt, Toby. Wir spielen ein bisschen.«
»Er muss essen und dann ins Bett«, sagte Adelheid Blohm streng.
»Um vier Uhr?«, fragte Bert.
»Er hat nachmittags nicht geschlafen.«
»Ich warte, dass Mami wiederkommt«, sagte Toby.
»Darauf warte ich auch«, erklärte Bert. Und wieder sah er seine Mutter an. Sie drehte sich abrupt um und rauschte aus dem Zimmer. Die Tür fiel hart ins Schloss.
»Sie ist wütend«, sagte Toby. »Sie ist immer wütend, wenn ich von Mami rede. Ich mag Großmama überhaupt nicht mehr.«
Bert war wie gelähmt. »Das darfst du nicht sagen«, stieß er hervor.
»Ich darf gar nichts sagen. Habe meinen Mund zu halten. Sagt sie immer, Kinder haben nichts zu sagen. Ich möchte kein Kind mehr sein. Ich will groß sein und Geld haben und meine Mami suchen.«
»Und mich hast du auch nicht mehr lieb, Toby?«, fragte Bert.
»Du machst doch, was Großmama sagt! Außerdem bist du nie zu Hause. Erst recht nicht, wenn Mami kommt und Großmama böse zu ihr redet.«
»Stimmt das? Lügst du auch nicht?«, Berts Stimme zitterte.
»Mami hat gesagt, man darf nicht lügen. Großmama lügt aber, und sie ist kein Kind. Sie ist groß. Ich mache nur, was meine Mami gesagt hat. Meine Mami habe ich lieb, und wenn Großmama sagt, dass sie tot ist und nicht wiederkommt, ist es gemein.«
Vier Jahre war er und redete, dass Bert der Atem stockte. Was ging in diesem Kinderköpfchen nur vor sich?
»Zuerst sagt sie, dass Mami krank ist, und nun sagt sie, dass sie tot ist und dass sie schuld ist, dass mein Schwesterlein auch tot ist. Ich hatte gar kein Schwesterlein, und ich mag euch alle nicht mehr. Ich will zu meiner Mami.«
Für Bert stürzte eine Welt zusammen. War es wohl auch nur eine Scheinwelt, die er um sich aufgebaut hatte, oder die um ihn aufgebaut worden war, aber jetzt lag sie in Trümmern. Sein Sohn stand vor ihm, klein, schmal, mit übergroßen Augen, in denen er nichts als Anklage las.
»Und Mami war doch hier, und nun rede ich überhaupt nichts mehr«, sagte Toby.
»Dann beschäftige dich jetzt«, sagte Bert. »Ich spreche mit Großmama.«
Toby presste die Lippen aufeinander, aber nie im Leben würde Bert diesen Blick vergessen, der auf ihm ruhte und in dem er sogar Verachtung zu lesen glaubte. Und vielleicht war es dieser Blick, der ihn verwandelte, der ihm den Mut gab, den er nun brauchte, als er seiner Mutter gegenübertrat.
»Birgit war also hier«, begann er ohne Umschweife. »Vor drei Tagen hat sie das Sanatorium verlassen, diesen teuflischen Bau, in dem ein Mensch zugrunde gehen muss.«
»Der Aufenthalt kostet dreitausend Mark im Monat«, sagte Adelheid Blohm herrisch.
»Den muss Birgit also auch noch selbst bezahlen, denn du hast doch das Geld nicht dafür«, sagte Bert zornig.
»Wie redest du mit mir?«, fuhr ihn seine Mutter an. »Hast du jeden Respekt vor mir verloren?«
»Erwartest du nur Respekt? Ich erwarte jetzt eine ehrliche Antwort von dir. Birgit hat das Sanatorium verlassen. Sie hat ihren Anwalt eingeschaltet. Man bescheinigt ihr, dass ihr Geist nicht umnachtet ist, wie du es mir einzureden versuchtest. Ja, der Chefarzt ist bereit, dir die Schuld zu geben, dass Birgit überhaupt nach Breitenfeld gebracht worden ist. Nimm dazu doch bitte Stellung, Mutter.«
»Das ist ungeheuerlich«, ächzte sie. »Du wagst es, so mit mir zu reden. Du, mein einziger Sohn.«
»Ich will wissen ob Birgit hier war und wo sie jetzt ist. Und ich werde sofort die Polizei anrufen und eine Vermisstenmeldung aufgeben, wenn du mir keine ausreichende Erklärung gibst.«
»Mein Herz«, ächzte Adelheid Blohm, »oh, mein Herz.« Stöhnend presste sie ihre Hand gegen die Brust.
»Du hast ein sehr gesundes Herz, Mutter. Lenke jetzt bitte nicht ab. Auch wenn du dich nicht wohlfühlst, will ich eine Antwort!«
»Was kann ich dafür, wenn sie gleich wieder weggelaufen ist«, murmelte Adelheid Blohm. »Ich habe ihr gesagt, dass du nicht daheim bist, und gleich war sie wieder weg. Irre hat sie mich angesehen, ganz irre.«
»Sie ist weg, ohne Toby sehen zu wollen? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Du hast es ihr verweigert. Du hast Toby eingesperrt. Er hat es mir gesagt.« Seine Stimme klang hart.
»Es ist ihr Sohn. Er lügt. Sie ist schuld, dass das Baby gestorben ist. Bert, komm doch zur Vernunft. Sie ist wahnsinnig. Der Tod ihrer Eltern hat ihren Geist getrübt. Ich wollte doch nur nicht, dass du es dein Leben lang büßen musst.«
Bert war eiskalt, sein Körper und seine Seele schienen zu gefrieren, doch sein Verstand arbeitete.
»Birgit war so wahnsinnig, dir hunderttausend Mark zu geben, damit du die Hypothek ablösen konntest«, sagte er. »Eine Hypothek, die nur noch fünfzigtausend Mark betrug. Was hast du mit dem übrigen Geld gemacht?«
»Sie hat mir keine hunderttausend Mark gegeben«, begehrte Adelheid Blohm auf. »Das ist gelogen.«
»Ich war auf der Bank. Birgit hat mir nichts gesagt. Als ich von Breitenstein kam, bin ich zur Bank gefahren. Es hat mich etwas dorthin getrieben. Ich wollte wissen, ob sie Geld von ihrem Konto abgehoben hat, auf dem ja nicht mehr viel war, nachdem sie alles in dieses kostspielige Haus hineingebuttert hat. Ich habe allerhand erfahren, worum ich mich bisher leider zu wenig gekümmert habe. Aber ich habe nicht geahnt, dass du so infam bist, Birgit noch übel nachzureden. Vielleicht ist sie jetzt tot, aber wenn es so ist, dann werde ich ihren Tod rächen! Ich gehe jetzt mit Toby fort und werde Birgit suchen. Und wenn ich sie nicht finde oder tot finde, wirst du mich nicht mehr wiedersehen. Ich glaube Toby wirklich mehr als dir.«
»Du bringst mich um. Deine Worte bringen mich um. Womit habe ich das verdient? Habe ich nicht immer für dich gesorgt und gedacht? Warum ist denn deine Tochter gestorben, Bert? Denk doch auch einmal daran.«
»Weil Toby Birgit mit den Röteln angesteckt hatte, und weil du meiner Frau eingeflüstert hast, dass es alles nur Gerede sei, dass es dem Baby schaden könnte. Ich sehe jetzt alles klar. Mein Gott, was muss Birgit durchgemacht haben mit mir, einem Schwächling, der blind und taub war. Jetzt ist Schluss!«, brüllte er. »Jetzt glaube ich fast, dass wir wahnsinnig sind, du und ich. Aber mein Kind, Birgits Kind, bringe ich in Sicherheit, bevor noch mehr geschieht.«
»Ich sterbe, ich sterbe«, ächzte Adelheid Blohm. »Bert, ich bin deine Mutter.«
»Du wirst es überleben«, sagte Bert, »ich nicht, wenn Birgit den Tod gesucht hat. Aber unser Kind bekommst du nicht. Ich nehme Toby mit.«
Er nahm Toby mit, und er war seltsam ruhig, als er am Steuer seines Wagens saß.
»Du hast vielleicht geschimpft«, sagte Toby staunend. »Da wird sich die Großmama aber gewundert haben. Jetzt habe ich dich wieder lieb, Papi. Gell, wir suchen Mami und finden sie.«
»Ich hoffe es, Toby«, sagte Bert leise, aber es war nur das Kind, das ihn zur Vernunft brachte. Er wäre fähig gewesen, an den nächsten Baum zu fahren, wenn Toby nicht so zu ihm gesprochen hätte. Aber wenn Birgit noch lebte, irgendwo lebte, durfte er ihr das Kind nicht nehmen. Wenn sie auch ihn nicht mehr haben wollte, ihren Toby sollte sie behalten.
Er sah sie vor sich, wie sie voller Zärtlichkeit den Jungen in den Armen hielt, wie verklärt ihr Gesicht dabei war. Wie wenig er selbst Birgit bedeutet haben mochte oder bedeutet haben konnte, da er immer zwischen ihr und seiner Mutter stand, Toby war ihr Ein und Alles gewesen. Und jetzt zum ersten Mal begriff er seine Frau und ihre Gefühle, die von ihm nie ganz geweckt worden waren. Erst von dem Kind, das sie geboren hatte. Und er begriff auch, welch entsetzlicher Schmerz es für Birgit gewesen sein musste, das zweite Kind zu verlieren. Aber es war nicht ihre Schuld gewesen. Es war eine schicksalhafte Verkettung, über die er ihr hätte hinweghelfen müssen. Aber er hatte versagt. Restlos versagt hatte er. Immer war er ein Muttersöhnchen geblieben. Immer hatte zuerst gegolten, was seine Mutter sagte.
Wird sie Birgit mögen, hatte er damals gedacht, als ihm dieses Mädchen so gefiel. Er hatte Birgit geliebt, aber er hatte nicht gewagt, ihr seine Liebe zu erklären, bis seine Mutter sagte, dass sie doch die richtige Frau für ihn wäre. Da hatte er dann geglaubt, das alles in Ordnung wäre, dass seine Welt so bestehen würde, wie er sie gewohnt war, dass seine Mutter für immer bleiben würde. Aber er hatte insgeheim auch geglaubt, dass seine Mutter Birgit lieben würde wie eine Tochter. Bis heute hatte er es geglaubt. Bis er erfahren musste, dass nur finanzielle Erwägungen seine Mutter so zugänglich gemacht hatten. Dass sie hunderttausend, statt fünfzigtausend von Birgit genommen hatte, dass sie sich dafür bezahlen ließ, dass sie ihrem Sohn gestattete, eine Frau zu nehmen.
Birgit hatte für das bisschen Glück, das er ihr gab, teuer, zu teuer bezahlt, auch das war Bert bewusst geworden.
Aber plötzlich war er doch wieder hellwach. »Wann meinst du, dass Mami dagewesen ist, Toby?«, fragte er.
»Zweimal habe ich geschlafen, Papi«, erwiderte Toby prompt. »Nicht richtig geschlafen, weil ich immer an Mami denken musste und weil sie ja doch vielleicht wieder an der Tür läuten konnte.«
»Sag mir alles ganz genau, Toby. Woran kannst du dich erinnern?«
»Es hat geläutet. Dann kam Großmama und hat mich eingesperrt. Es wären Leute da, die sie nicht reinlassen will.«
»Und dann, Toby?«
»Dann habe ich gelauscht, weil ich wissen wollte, was das für Leute sind. Mami hat gesagt, dass ich nicht lügen darf, und ich lüge nicht.«
»Nein, du lügst nicht, du sagst die Wahrheit«, erwiderte Bert. »Was hat Großmama gesagt? Hast du es gehört?«
»Ja, ich habe es gehört.« Toby überlegte einen Augenblick. »›Was willst du hier?‹ hat sie gesagt. Und dann hat Mami gesagt: ›Ich komme heim!‹ Ich habe es mir ganz genau gemerkt, Papi.« Wieder dachte der Junge nach. »Mutter hat sie auch gesagt, das weiß ich. Und Großmama hat zu Mami gesagt, dass sie nicht Mutter sagen soll. Ich habe Mami gerufen, aber sie hat es wohl nicht gehört, weil Großmama so geschrien hat, dass das ihr Haus ist. Und sie hat auch gesagt, dass sie die Polizei holt. Dann hat sie noch was gesagt, das ich nicht behalten habe. Aber Mami hat gerufen: ›Wo ist Toby, wo ist Bert?‹ Ich lüge bestimmt nicht, Papi. Großmama war auch so schrecklich böse und hat gesagt, dass ich meine Eisenbahn und meine Tierchen nicht behalten darf, wenn ich noch was sage.«
Wie Toby dachte, wie er redete, nie zuvor war es Bert aufgefallen. Dass er ein besonders gescheites Kind sei, hatte seine Mutter zwar auch behauptet, aber darin geriete er ja ihm nach. War es nicht seltsam, dass ihm nun erst all diese Sticheleien bewusst wurden, die sie verteilt hatte? Das Unbehagen in ihm verstärkte sich. Was mochte seine Mutter wohl alles zu Birgit gesagt haben, wenn er nicht dabei war?
»Darf ich meine Eisenbahn und meine Tierchen behalten, Papi?«, fragte Toby. »Wenigstens die, die Mami mir geschenkt hat?«
»Du darfst alles behalten, mein Junge«, erwiderte Bert mit erstickter Stimme.
»Wohin fahren wir denn eigentlich?«, wollte der Kleine nun wissen.
Das hatte Bert sich noch gar nicht überlegt. Aber jetzt kam ihm blitzartig ein Gedanken. Vielleicht wusste Birgits Anwalt, Dr. Biel, etwas. Der Chefarzt des Sanatoriums hatte doch gesagt, dass sie ihn eingeschaltet hätte.
Es war nun gewiss nicht von Vorteil, dass er Toby bei sich hatte, aber er hatte Angst, den Jungen allein im Wagen zu lassen. Toby trottete neben ihm her, geduldig, widerspruchslos, während Bert schon überlegte, wo sie die Nacht verbringen könnten, denn mit seiner Mutter wollte und konnte er heute nicht mehr zusammentreffen. Es hätte eine noch schlimmere Auseinandersetzung gegeben.
Aber er hatte nichts für den Jungen mitgenommen, auch für sich selbst, nichts. Und morgen musste er an seinen Arbeitsplatz zurück.
Ob er ein paar Tage Urlaub nehmen konnte? Einverstanden damit würde der Chef wohl nicht sein, da ja gerade jetzt große Umstellungen im Gange waren. Und wohin sollte er mit Toby? Ein ganzer Packen von Problemen kam auf ihn zu.
Von Dr. Biel wurde Bert mit so eisiger Zurückhaltung empfangen, dass ihm das Herz noch tiefer sank. Toby hatte sich brav ins Wartezimmer gesetzt und schaute sich Illustrierte an.
Es dauerte einige Zeit, bis Bert den Anwalt einigermaßen überzeugt hatte, dass er auf Birgits Seite stand und nicht etwa eine Scheidung beabsichtigte, aber sagen konnte ihm Dr. Biel auch nicht, wo Birgit sich jetzt aufhielt. Er war entsetzt, als Bert ihm sagte, dass sie heimlich das Sanatorium verlassen hatte.
»Da bin ich auch vom Chefarzt falsch informiert worden«, sagte er. »Aber überlegen wir mal …« Er schlug sich an die Stirn. »Man muss in allen Krankenhäusern nachfragen«, sagte er dann hastig. »Ich will nicht sagen, dass sie sich etwas angetan hat, dazu ist sie nicht der Mensch. Sie ist sehr gläubig, allein das half ihr, den Tod ihrer Eltern zu überwinden. Sie sind sich anscheinend bisher gar nicht bewusst gewesen, welch ein wertvoller Mensch Ihre Frau ist, Herr Blohm.«
»Ich liebe meine Frau«, sagte Bert leise. »Ich gebe zu, dass ich nicht allzu viel über sie nachgedacht habe, solange sie bei mir war. Sie war einfach da, verstehen Sie, und ich liebte sie, wie sie war. Ich wusste auch nicht, wie sehr ich sie liebe.«
»Sie wissen auch nicht, wie sehr sie unter Ihrer despotischen Mutter gelitten hat«, sagte Dr. Biel.
»Ich beginne es zu begreifen. Birgit hat sich nie beklagt.« Es klang wie eine Verteidigung.
»Sie ist nicht der Mensch, der jammert, und was hätte es ihr schon genützt? Ihre Mutter führte doch das Regiment in dem Haus, das durch Birgits Geld erhalten blieb. Ich muss Ihnen jetzt einige bittere Wahrheiten sagen, Herr Blohm. Birgit hätte darüber nie zu Ihnen gesprochen, aber sie war sich durchaus im Klaren, dass nur ihr Geld für Ihre Mutter entscheidend gewesen war. Für ihre Frau war es selbstverständlich, dass alles, was ihr gehörte, auch Ihnen gehören sollte. Sie folgte nicht meinem Rat, sich abzusichern, denn auch das muss ich Ihnen sagen, ich sah schwarz für Ihre Ehe. Ich kannte Birgit schon als Kind. Ich war mit ihrem Vater befreundet. Menschen ohne Fehl und Tadel waren ihre Eltern, ist auch sie. Wenn Birgit etwas geschehen ist, was nicht mehr gutzumachen ist, werde ich keine vornehme Zurückhaltung üben, wie Birgit es getan hat. Ich werde …«
»Bitte, sprechen Sie nicht weiter«, fiel ihm Bert ins Wort. »Ich weiß, was Sie empfinden, und ich empfinde ebenso. Ich bin entsetzt über das Benehmen meiner Mutter, aber bis heute ist mir das alles nicht bewusst gewesen. Und nun stehe ich mit meinem Jungen da und weiß nicht, wohin mit ihm.«
»Sie wollen nicht zu Ihrer Mutter zurück?«, fragte Dr. Biel.
»Nein.« Es klang sehr bestimmt. »Ich könnte es Toby nicht antun.«
Dr. Biel überlegte einen Augenblick und sagte schließlich:
»Toby könnte bei uns bleiben«, er warf Bert einen kurzen Blick zu, »meine Frau betreut oft unsere Enkelchen. Sie versteht es, mit Kindern umzugehen. – Aber nun ist es doch wohl wichtig, dass wir Birgit finden, bevor noch mehr Zeit verstreicht.«
Seine Privatwohnung war im selben Haus, ein Stockwerk höher. Dr. Biel rief seine Frau an. Frau Biel war sofort einverstanden, kam herunter und nahm sich Tobys an.
Der Kleine traf eine schnelle und bedeutsame Entscheidung.
»Wenn ich nur nicht zu Großmama zurück muss«, erklärte er, »sonst ist mir alles egal. Nur meine Mami will ich bald wiederhaben.«
Dr. Biel führte zahllose Telefongespräche, bis er endlich durch ein hörbares Aufatmen verriet, dass er eine Spur gefunden hatte. Bert hatte ihn nicht aus den Augen gelassen. Mit fieberhafter Spannung lauschte er, als Dr. Biel sagte: »Ja, Herr Dr. Behnisch, ich bin der Anwalt von Frau Blohm. Herrgott, bin ich froh, dass sie endlich gefunden ist. Ich werde gleich kommen. Sagen Sie ihr bitte noch nichts von meinem Anruf. Ich möchte erst noch persönlich mit Ihnen sprechen.«
»Sie lebt«, flüsterte Bert erleichtert, als Dr. Biel den Hörer aufgelegt hatte.
»Sie hat Glück gehabt«, erwiderte der Anwalt ernst. »Sie saß in dem Bus, der mit dem Zug zusammengestoßen ist. Sie haben sicher von dem Unglück gehört.«
»O mein Gott«, murmelte Bert und legte die Hände vor sein Gesicht. »Ist sie schwer verletzt?«, fragte er dann stockend.
»Birgit lebt, viel mehr weiß ich bisher nicht. Dr. Behnisch ist anscheinend ein sehr vorsichtiger Mann, mehr hat er am Telefon nicht verraten.«
»Ich möchte zu ihr. Ich muss mit ihr sprechen«, sagte Bert und erhob sich.
»Jetzt wollen wir aber mal hübsch bedächtig vorgehen«, war Dr. Biels Meinung. »Sie können mit mir fahren, aber ich spreche zuerst mit Birgit allein.«
*
Penny Holzmann war an diesem Tag in die Behnisch-Klinik überführt worden. Ihr Mann und Tim waren bei ihr. Ganz still saß der Kleine auf seines Vaters Knie, und sein Herzchen klopfte angstvoll, weil seine Mami noch viel schlimmer aussah, als jene Dame, zu der Dr. Behnisch ihn gebracht hatte. Aber Tim war erst zwei Jahre alt, und sein Verstand war noch nicht so entwickelt wie der von Toby. Seine Welt bestand aus Papi, Mami, Oppi und Ommi, seinem Bärle, Essen, Trinken und Schlafen. An das Unglück hatte er nicht die geringste Erinnerung.
Aber wenn Penny seinen Namen flüsterte, wusste er genau, dass das seine Mami war, obgleich sie von oben bis unten in Verbände gehüllt war.
Tim ahnte nicht, wie viel Lebenswillen seine Anwesenheit seiner Mami einflößte. Er ahnte nicht, wie sehr sein Papi um das Leben der angebeteten Frau bangte.
Dirk Holzmann ließ alle Begebenheiten vor seinem geistigen Auge wie einen Film abrollen, die ihn mit Penny verbanden, seit er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Es war in London gewesen. Er hatte das bezaubernde junge Mädchen im Hyde-Park gesehen, wie es sich bückte und etwas zu suchen schien, und so hatte er sich auch gebückt und einen blanken Penny aufgehoben. »Einen Penny«, hatte er auf deutsch gesagt, und sie hatte spitzbübisch gelacht und gefragt: »Woher wissen Sie, dass ich Penny heiße?« Im besten Deutsch hatte sie es gefragt, und schon in diesem Augenblick hatte ihre Liebe begonnen. Alles liebte er an seiner Penny, die runde Stirn, die sie noch so kindlich wirken ließ und hinter der doch so viel gescheite Ideen entstanden. Das kecke Näschen, mit Sommersprossen bedeckt, das sich krauste, wenn sie nachdachte. Die weichen Lippen, die so gern lachten und dabei Zähne zeigten, von denen niemand glauben wollte, dass sie alle echt wären, so makellos waren sie.
Ihr sonniges Wesen, das alle Herzen gewann und doch nur wenige ganz gewinnen wollte, denn Penny baute sich ihre eigene Welt. Eine Welt, in der es einfach nichts Böses gab, in der noch Frieden herrschte und Verständnis füreinander.
Und wie hatten seine Eltern Penny gleich geliebt, als er sie aus diesem Urlaub mit heimbrachte und sagte, dass nur sie seine Frau werden solle. Und dann das unendliche Glück, als Tim zur Welt kam, mit einem Lachen seiner Mutter geboren.
Nun lag diese Penny still da und konnte kaum sprechen. Ihr süßes Gesicht war von Verbänden verhüllt, ihre Arme, die alle, die sie liebte, so liebevoll umfangen hatten, waren geschient. Ihr geschundener Körper wurde von einer leichten Decke versteckt.
»Ihr seid alle so lieb«, flüsterte Penny. »Ich möchte so gern wieder bei euch sein.«
»Du wirst wieder bei uns sein, mein Liebstes«, sagte Dirk zärtlich.
»Ich möchte leben, Dirk. Wir wollten doch lange miteinander leben.«
»Wir werden lange miteinander leben«, sagte er, obgleich es ihm fast das Herz zerriss, daran denken zu müssen, dass es ein qualvolles Leben für sie werden könnte.
»Die Götter neideten uns das Glück«, murmelte sie.
Auch andere hatten das gesagt, und die Frage, warum es Penny hatte so schlimm treffen müssen, bohrte sich wie ein Stachel in Dirk.
Nun wussten sie wenigstens, dass alles für Penny getan werden würde. Sie konnten bei ihr sein, wann immer sie wollten. Sie konnte Tim sehen, ohne dass eine Mordsaffäre daraus gemacht wurde, das Kind auf die Station zu bringen.
Nur konnte Tim eben nicht begreifen, dass seine Mami nicht mit ihm spielte und lachte.
*
Birgit war nach dem Gespräch mit Dr. Norden nicht mehr eingeschlafen. Sie lauschte in sich hinein, doch von den Ängsten, die sie bewegt hatten, war nichts geblieben. Sie war von ganz unbekannten Regungen erfüllt, die man als Kampfbereitschaft bezeichnen konnte. Jedenfalls gab es keine Resignation mehr. Schließlich keimte sogar Rachegefühl in ihr.
Hatte sie eigentlich Veranlassung, vor ihrer Schwiegermutter zu kuschen? War sie ihr etwas schuldig, nur weil sie die Frau ihres Sohnes geworden war?
Für ein paar Sekunden kam ihr der Gedanke, dass sie sich ihr Glück, oder das, was sie als Glück empfunden hatte, erkauft hatte. Teuer erkauft. Dr. Biel hatte sie eindringlich gewarnt. Er hatte alles so erschreckend nüchtern gesehen. Sollte er denn in allem recht behalten, auch darin, dass Bert sich eines Tages von ihr lösen würde?
Dieser Gedanke bereitete ihr Schmerz, von dem sie für Minuten überwältigt wurde. Aber jetzt ging es nicht um ihre Ehe, es ging um ihr Kind. Sie wollte dieses Kind nicht auch verlieren, sie wollte um Toby kämpfen. Dr. Norden hatte ihr den Gedanken eingegeben, er hatte ihre Kräfte mobilisiert.
Sie wollte nur alles genau überlegen und nichts überstürzen. Sie wollte sich mit Dr. Biel beraten, und diesmal wollte sie auf ihn hören. Ihre Gefühle für Bert durften dabei gar keine Rolle spielen. Niemals würde sie in das Haus zurückkehren, mit seiner Mutter unter einem Dach leben, was immer er ihr auch versprechen würde.
Aber wollte er das denn überhaupt? Würde nicht auch er um Toby kämpfen, unterstützt von seiner Mutter? Musste nicht entsetzlich viel »schmutzige Wäsche« gewaschen werden, die seine Existenz gefährden konnte, wenn sie ihr Ziel erreichen wollte?
Nur nicht wieder weich werden, redete sich Birgit ins Gewissen. Sie ahnte nicht, dass Dr. Biel schon auf dem Wege zur Behnisch-Klinik war und dass Bert ihn begleitete.
*
»Machen Sie doch keinen Ärger, Mann«, hatte Dr. Behnisch zu dem Inspektor gesagt, der hinter Birgit unbedingt einen Kriminalfall sehen wollte. »Lassen Sie der Frau doch Zeit, richtig zu sich zu kommen. Sie wird doch nicht steckbrieflich gesucht, oder?«
Nein, steckbrieflich gesucht wurde sie nicht, aber der überkorrekte Beamte meinte, seine Pflicht erfüllen zu müssen.
Dr. Behnisch konnte recht hemdsärmelig auftreten. Er war halt ein richtiger Bayer, und wenn er gereizt wurde, platzte er schier.
»Was meinen Sie, wie es sich in der Zeitung ausnimmt, wenn man dort lesen kann, dass die Polizei nicht mal die Unfallopfer in Frieden lassen kann, bevor sie den Schock richtig überwunden haben«, sagte er, und damit schlug er den guten Mann denn doch in die Flucht.
Eine halbe Stunde später trafen Dr. Biel und Bert Blohm in der Behnisch-Klinik ein. Nun wurde das Drama dieser Ehe aufgerollt. Dr. Behnisch war objektiv. Er gewann keinen schlechten Eindruck von Bert Blohm. Allerdings teilte er Dr. Biels Ansicht, dass der Anwalt erst allein mit Birgit sprechen sollte.
Er unterhielt sich indessen noch mit Bert. »Ich komme mir jetzt schon vor, als hätte ich ein Verbrechen begangen«, sagte Bert niedergeschlagen. »Ich wollte doch für meine Frau nur das Beste. Sie war entsetzlich mitgenommen durch den Tod unseres zweiten Kindes, aber was wäre erst geworden, wenn es am Leben geblieben wäre. Ich konnte doch nicht ahnen, dass meine Mutter so unfair sein würde.«
Diese Ehe war kein Einzelfall für Dr. Behnisch.
Oft genug hatte er es schon erlebt, dass berufliche Überbeanspruchung des Mannes zu ehelichen Konflikten geführt hatten. Doch Bert war sich solcher Konflikte überhaupt nicht bewusst geworden, und Dr. Behnisch meinte, dass es wohl gut gewesen wäre, wenn seine Frau mal richtig getobt und sich alles von der Seele geschrien hätte.
Eine tobende Birgit konnte Bert sich gar nicht vorstellen. Aber er wäre ganz schön erschrocken gewesen, wenn er sie jetzt gehört hätte, als sie mit Dr. Biel sprach.
Zuerst war sie fassungslos gewesen, als der Anwalt ihr Zimmer betrat, doch Dr. Biel hatte ihr rasch erklärt, wie lange er gebraucht hatte, um sie ausfindig zu machen.
»Mein liebes Kind«, sagte er väterlich, »ich war schön erschrocken, als ich hörte, dass Sie aus dem Sanatorium ausgerissen sind.« Er erwähnte allerdings nicht, dass er dies erst von Bert erfahren hatte. Von Bert sprach er vorerst überhaupt nicht.
»Sie hätten mich dort festgehalten, Schwiegermutter hatte schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich für immer hinter diese Mauern zu verbannen. Sie wollte mich doch wahnsinnig machen.«
Solche Worte hatte Dr. Biel aus Birgits Mund noch nicht gehört. Er war sehr erstaunt, sie in solcher Verfassung zu sehen. Er brauchte schon einige Zeit, um sich auf die kampfeslustige Birgit einzustellen, die ganz präzise ihre Vorstellungen über künftige Maßnahmen äußerte.
»Ich will nichts haben als mein Kind, und Sie müssen mir dazu verhelfen«, sagte sie. »Auf Toby verzichte ich nicht.«
»Und auf Ihren Mann?«, fragte Dr. Biel staunend.
»Er kann sich ja weiterhin mit seiner Mutter zusammentun«, sagte sie trotzig, »aber mir ist jetzt jedes Mittel recht, um sie auszuschalten, wenn es um Toby geht. Notfalls werde ich sie sogar verklagen wegen Betruges.«
»Nun mal langsam, Birgit«, meinte Dr. Biel besänftigend. »So kenne ich Sie ja gar nicht.«
»Dann werden Sie mich eben auch anders kennenlernen«, erklärte sie.
»Aber ich darf darauf hinweisen, dass Sie Ihr Geld Frau Blohm freiwillig gegeben haben. Von Betrug kann gar nicht die Rede sein, mein liebes Kind.«
»Die Hypothek betrug fünfzigtausend Mark. Schulden waren auch noch da, aber das übrige Geld hat sie einfach für sich verbraucht, für ihre Reisen und ihre Ambitionen. Ich kann dazu nicht einfach schweigen«, erklärte Birgit heftig.
»Das sollen Sie auch nicht. Es freut mich, dass Sie endlich aus Ihrem Dornröschenschlaf erwacht sind. Aber wir können nun wirklich nicht von einem Extrem ins andere fallen. Wollen Sie nicht erst einmal mit Ihrem Mann sprechen?«, schlug Dr. Biel vor.
»Bert hat gar nicht den Mut, sich gegen seine Mutter aufzulehnen.«
»Sagen Sie das nicht.« Er kam nicht weiter, denn Birgit schnitt ihm das Wort ab.
»Ich habe zu viel in diesem Hause erlebt«, fuhr sie fort, »wenn ich alles nüchtern überlege, muss ich meinen Mann als jämmerlichen Schwächling bezeichnen. Aber ich habe mich ja auch nie aufgelehnt. Diese Frau hat mich gelähmt. Ich wollte meine Ehe nicht gefährden und wusste doch, dass Bert sich nie von seiner Mutter lösen würde. Sie hat es ihm eingebläut, ihr ewig dafür dankbar sein zu müssen, dass sie ihn geboren hat und dass er alles ihr zu verdanken hätte, was aus ihm geworden ist. Ihr Sohn, ihr Haus, ihr Besitz, ihre Herkunft … Ich habe es zu oft gehört. Ha, es hat mich fast wahnsinnig gemacht.« Sie hielt erschöpft inne.
»Sagen Sie das nicht zu laut, wenn Sie Toby haben wollen«, sagte Dr. Biel beruhigend.
»Sie hat genau gewusst, wie schädlich die Röteln für das Baby sein könnten«, fuhr Birgit leise fort. »O ja, ich habe einmal gesehen, dass sie in einem Ärztebuch las und habe nachgeschaut, wo ihr Buchzeichen lag, aber da war es schon zu spät. Ich habe gebetet, dass das Schicksal uns verschonen und dies alles für mein Baby nicht zutreffen sollte, dass wir einen Schutzengel haben würden. Aber es kam anders. Und meine Schwiegermutter hatte sich schon ausgerechnet, wie sie mich restlos zermürben, wie sie mich endlich loswerden könnte, nachdem sie mir mein Geld schon abgenommen hatte.«
»Dass Sie so hassen können, Birgit«, sagte Dr. Biel erschüttert.
»Ja, ich habe es gelernt. In diesem schrecklichen Haus wurde die Saat in mich hineingelegt. Mit all den Fragen, die man mir stellte. Aber mein Kopf ist klar. Sie brauchen nicht daran zu zweifeln.«
»Ich zweifle nicht daran, ich möchte nur nicht, dass Sie Bert jetzt mitschuldig sprechen.«
Birgits Augenbrauen schoben sich zusammen. »Wieso nehmen Sie ihn jetzt plötzlich in Schutz?«, fragte sie.
»Ich bin überzeugt worden, dass er Sie liebt, dass er bereit ist, sich von seiner Mutter zu trennen und dass er außerdem nicht um Toby kämpfen wird, wenn Sie jetzt diese Ehe nicht mehr aufrechterhalten wollen.«
»Was haben Sie eben gesagt?«, fragte Birgit nach einem längeren Schweigen.
»Bert ist zu mir gekommen. Er hat Toby mitgebracht. Der Junge bleibt vorerst bei uns, und Ihr Mann wartet darauf, mit Ihnen sprechen zu können.«
Birgit starrte ihn sprachlos an. Es verging Minuten, bis sie sagte: »Was ist das nun wieder für ein Manöver? Hat es sich seine Mutter ausgedacht?«, fragte sie misstrauisch.
Wie verbittert sie ist, ging es Dr. Biel durch den Sinn. Wie sich ihr Herz verhärtet hat. Diese Birgit war ihm fremd. Aber er bedachte auch, was sie durchgemacht hatte.
»Wollen Sie nicht mit Bert sprechen, Birgit?«, fragte er leise.
»Nein. Er soll mir erst beweisen, dass er es ernst meint. Er soll mir Toby geben. Ich will mit meinem Jungen irgendwohin gehen, wo ich Ruhe habe. Ich kann nicht mehr einfach glauben, Dr. Biel. Ich muss überzeugt werden. Wenn Bert es ehrlich meint, wird er mich verstehen. Wenn er aber von mir erwartet, dass alles noch einmal von vorn beginnt, wie es gewesen ist, dann lasse ich mich von ihm scheiden.«
Und das musste Dr. Biel Bert dann wohl oder übel erklären, aber dessen Reaktion erschütterte ihn noch mehr, als Birgits Aufbegehren.
»Ich verstehe Birgit«, sagte Bert leise. »Ich weiß jetzt wie sie in der ganzen Zeit unserer Ehe gelitten hat. Alles soll geschehen, wie sie es will, aber scheiden lasse ich mich niemals von ihr. Sie bleibt meine Frau, und ich hoffe, dass sie eines Tages einsehen wird, dass ich sie tief und aufrichtig liebe.«
*
So geschah es denn, dass Frau Biel am nächsten Tag Toby in die Klinik brachte. Mit einem bunten Blumensträußchen in den kleinen Händchen marschierte er neben ihr her, ein bisschen bange, ein bisschen neugierig, weil er noch nie in einer Klinik gewesen war.
»Kommen hier auch Babys auf die Welt?«, fragte er flüsternd.
»Nein, hier nicht«, erwiderte Frau Biel, die Toby mittlerweile »Tante Bertl« nannte.
»Dann können auch keine sterben«, sagte Toby zufrieden. »Dann braucht Mami nicht wieder darum zu weinen, weil unser Baby gestorben ist.«
Für ihn war das nicht so welterschütternd gewesen, aber dann später, als die Mami gar nicht mehr lachte und schließlich sogar von ihm fortging, hatte es ihn doch mächtig aufgeregt, obgleich er nie begriffen hatte, dass eigentlich die Röteln an allem schuld gewesen waren.
Dass er nun mit Tante Bertl und nicht mit dem Papi zur Mami ging, gab ihm auch nicht zu denken, denn Papi musste ja arbeiten.
Am Morgen war schon ein Strauß herrlicher Rosen für Birgit in der Behnisch-Klinik abgegeben worden und eine Karte dazu, auf der geschrieben stand: Ich liebe Dich, Birgit. Gib mir eine Chance, es Dir zu beweisen.
Dein Bert.
Geschrieben hatte er ihr noch nie. Wozu auch, denn sie waren ja immer beisammen gewesen. Wenn Bert einmal geschäftlich auf Reisen gewesen war, hatte er einfach angerufen.
Es wurde ihr ganz eigentümlich ums Herz, als sie seine Schrift sah und diese Worte las. Tränen traten in ihre Augen, als sie die herrlichen Rosen betrachtete. Aber dann tat sich schon die Tür auf, und Toby kam hereinspaziert.
Atemloses Glück erfüllte den Raum und ihre Herzen.
»Mein Mamilein, mein allerbestes Mamilein«, flüsterte Toby. »Nun kann ich dich endlich wieder angucken.«
Er war schon darauf vorbereitet worden, dass Mami einen Verband um den Kopf hatte und dass sie den linken Arm nicht bewegen konnte. Aber er kannte ja ihre Augen und ihre Stimme, und er war nicht mehr so klein und noch so unverständig wie Tim.
»Wird schon alles wieder gut werden, Mami«, sagte Toby tröstend. »Und dann fahren wir erst einmal ganz lange weg, hat Papi gesagt. Ich wohne jetzt bei Tante Bert und Onkel Max, und sie sind sehr lieb zu mir«, erzählte Tobias.
»Und wo wohnt Papi?«, fragte Birgit nebenbei.
»In der Pension nebenan. Da war zum Glück ein Zimmer frei. Großmama wird sich ganz schön ärgern, weil er so mit ihr geschimpft hat, aber ich bin froh, dass sie jetzt nicht mehr mit mir schimpfen kann, wenn Papi wieder arbeiten muss.«
Bert hat es also wahrgemacht, dachte Birgit. Aber wird er es durchhalten? Wird er nicht doch wieder nachgeben, wenn sie ihm die Ohren vollheult?
»Ich habe nämlich zu Papi gesagt, dass du neulich bei uns warst und dass Großmama mich eingesperrt hatte. Ich wollte dich so gerne sehen. Warum ist sie eigentlich so böse, Mami?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Birgit leise und strich ihm zärtlich über das Haar. »Es ist schön, dass du mich besuchst, Toby.«
Der Junge sah sie sinnend an. »Manches verstehe ich nicht, Mamilein«, flüsterte er.
»Bist ja auch noch so klein, mein Liebling.«
»Papi hat gesagt, dass ich mit dir allein wegfahre, wenn du wieder gesund bist. Ich hätte es schon lieber, wenn wir zusammen wegfahren würden, aber Papi kann keinen Urlaub nehmen.«
So also hatte es Bert dem Jungen erklärt. Birgit war überrascht. Sollte Bert es ernst meinen?
»Und Papi muss erst eine Wohnung für uns suchen, weil wir nicht mehr zu Großmama gehen«, erzählte Toby. »Sie darf dich nämlich nicht mehr ärgern.«
*
Um dies zu erörtern, suchte Bert seine Mutter nach Büroschluss auf. Sie tat so, als sei nichts geschehen und begrüßte ihn zufrieden mit den Worten: »Da bist du ja wieder.« Sie schien der ganze Vorfall überhaupt nicht zu beeindrucken. Anscheinend war sie gerade vom Friseur gekommen.
»Wo ist Toby?«, fragte sie.
»Bei Bekannten«, erwiderte Bert.
Ihre Augen verengten sich. »Du setzt dich Peinlichkeiten aus. Ist das nötig?«
»Ja, es ist unvermeidlich. Ich werde auch nicht hierbleiben. Ich will nur einiges mit dir besprechen.« Berts Stimme klang fest.
Hektische rote Flecken zeichneten sich auf ihren Wangen ab.
»Ich bin bereit, die Meinungsverschiedenheiten beizulegen«, sagte sie rasch. »Mir sollst du nicht vorwerfen, dass ich nachtragend bin.«
»Es handelt sich nicht darum, wer wem was nachträgt, sondern darum, dass ich meine Ehe in Ordnung bringen und dann künftig in Frieden mit Birgit leben möchte, ohne die Angst, dass sie in diesem Hause seelisch zermürbt wird.«
»Das ist ein starkes Stück«, brauste sie auf. »Ich habe euch den größten Teil meines Hauses überlassen und muss mir jetzt solche Vorwürfe anhören.«
»Birgit hat reichlich dafür gezahlt. Mit hunderttausend Mark, wenn ich dich daran erinnern darf.«
»Sie hat es mir doch buchstäblich aufgedrängt – und hat sie denn dafür nicht alle Annehmlichkeiten genommen, davon abgesehen, dass sie dich zum Mann bekommen hat?«
Bert wurde noch blasser. »Ich habe Birgit nicht ihres Geldes wegen geheiratet, Mutter«, sagte er scharf.
»Aber bevor sie ins Haus kam, war bei uns alles in bester Ordnung«, begehrte Adelheid Blohm auf. »Wir hatten niemals Differenzen.«
»Ich war ja auch immer ein folgsamer Sohn«, erwiderte Bert ruhig. »Um es kurz zu machen: Ich werde uns eine Wohnung suchen und du kannst einen Teil dieses Hauses vermieten, um die Hypothekenzinsen zu begleichen.«
»Welche Hypothekenzinsen?«, fragte sie schrill.
»Du wirst eine neue Hypothek aufnehmen und Birgit wenigstens einen Teil ihres Geldes zurückzahlen, da du ja darauf beharrst, dass dies allein dein Haus ist.«
»Das ist ja unglaublich. Wie behandelst du mich? Bin ich eine Diebin?«
»Es könnte ja sein, dass Birgit die Absicht hat sich von mir zu trennen, was ich ihr nicht verdenken könnte. Dann wird sie ihren Lebensunterhalt allein bestreiten wollen. Ihr Anwalt wird jedenfalls ihre Ansprüche durchsetzen, und es wird sicher zur Sprache kommen, wo ihr Erbe geblieben ist.«
Seine Mutter starrte ihn konsterniert an. »Aber du wirst doch nicht in eine Scheidung einwilligen, Bert, schon Tobys wegen nicht. Er ist dein Sohn.«
»Es ist auch Birgits Sohn! Und wenn aufgerollt wird, was mit Birgit gemacht worden ist, wie übel man ihr mitgespielt hat, wird sie jeden Richter auf ihrer Seite haben.«
»Oder man weist nach, dass sie nicht richtig im Kopf ist«, sagte Frau Blohm hart.
Bert wunderte sich, dass er ruhig bleiben konnte, dass er nichts mehr fühlen konnte und auch nicht die kleinste Entschuldigung mehr für seine Mutter fand.
»Es wird dir nicht gelingen«, sagte er kalt. »Du täuschst dich, wenn du meinst, ich würde mich gegen Birgit entscheiden. Ich kann mir nicht verzeihen, dass ich in all den Jahren blind und taub gewesen bin, aber wie hätte ich meiner Mutter zutrauen können, dass sie so gefühllos und böse ist.«
Nun begann sie wieder mit ihren Anklagen, aber Bert drehte ihr den Rücken zu. »Werde nicht hysterisch, es wirkt nicht mehr«, sagte er. »Vielleicht gehst zur Abwechslung du einmal in ein Sanatorium. Ich bedaure sehr, dass mit dir nicht vernünftig zu reden ist. Ich werde jetzt meine und Tobys Sachen packen.«
Sie verstummte, blieb aber im Wohnzimmer zurück. Sie hatte schon wieder ganz Besitz ergriffen gehabt von dem Haus, obgleich sie oben doch ihre eigenen Räume hatte.
Alles habe ich falsch gemacht, dachte Bert. Es war schon eine Zumutung für Birgit, die Küche mit Mutter teilen zu müssen. Wann hatten sie abends schon mal eine gemütliche Stunde für sich allein gehabt? Nur, wenn seine Mutter mal im Theater oder wenn sie verreist war. Doch was geschehen war, war jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn Birgit ihm eine Chance gab, sollte alles anders werden.
Er hatte zwei Koffer gepackt und war nun dabei, Birgits Sachen auszusortieren, als seine Mutter erschien.
»Lass doch diesen Unsinn«, sagte sie. »Die paar Jahre, die ich noch zu leben habe, werdet ihr wohl noch abwarten können. Dann gehört dir ja sowieso alles.«
Nun musste er doch beinahe lachen. Seine Mutter war zweiundfünzig Jahre alt und bei bester Gesundheit.
»Vielleicht wäre es besser, du würdest wieder heiraten«, erwiderte er ironisch. »Das hattest du doch einmal in Betracht gezogen, wenn ich mich recht erinnere.«
»Ich habe deinetwegen auf alles verzichtet«, sagte sie theatralisch. »Und nun sehe ich ja, was ich davon habe.«
»Ich hätte doch nie etwas dagegen gehabt. Aber streiten wir nicht. Du bist noch jung genug, um dir dein Leben nach deinem Geschmack einzurichten, und ich bin erwachsen genug, um das zu tun, was ich für richtig halte.«
»Hättest du Karla geheiratet, wäre es niemals zu solchen Entwicklungen gekommen«, warf sie ihm vor.
»Warum fragst du Karla nicht, weshalb sie mir damals den Laufpass gegeben hat? Sie stellte mich nämlich vor die Alternative, entweder du oder sie. Sie hätte sich niemals von dir bevormunden lassen. Und damals war ich ein dummer Junge. Karla weinte mir gewiss keine Träne nach und ich ihr auch nicht.«
Adelheid Blohm schnappte nach Luft. Sie hatte nun so viele Wahrheiten zu hören bekommen, dass es ihr doch die Stimme verschlug, aber aus ihrer Haut in eine andere schlüpfen konnte sie nicht.
Rechthaberisch und egoistisch wie sie immer gewesen war, zog sie sich nun tief gekränkt, aber uneinsichtig wie eh und je zurück. Außerdem war sie von einem alten Verehrer zu einem Opernbesuch eingeladen worden, den sie sich nicht entgehen lassen wollte. Sie hatte dann wenigstens jemanden, dem sie ihr Herz ausschütten konnte.
*
Vier Tage waren seit dem Unglück vergangen. Die Toten war beerdigt worden, die Schlagzeilen wurden von anderen verdrängt. Morde, Entführungen, tödliche Unfälle gehörten fast schon zur Tagesordnung und lieferten den Zeitungsleuten Stoff genug.
Lenchen ließ sich anklagend darüber aus, dass die Welt ein einziges Sündenbabel geworden sei. Obgleich die Ereignisse sich überstürzten, kam Daniel die Woche ohne Fee unendlich lang vor. Nun wurde sie auch von den Patienten vermisst, die anfangs doch die schöne junge Frau Doktor so skeptisch betrachtet hatten.
Molly musste immer wieder die Frage beantworten, ob das Baby gar schon da sei. Und es blieb nicht aus, dass Daniel sich manches Mal Gedanken machte, Fee könne ihn so überraschen und ihr Kind vorzeitig auf der Insel zur Welt bringen. Er sehnte das Wochenende herbei, an dem sie wieder heimkehren würde.
Immer wieder ertappte er sich dabei, dass es ihn in das Gästezimmer zog, das sie nun als Kinderzimmer eingerichtet hatten, dass er die kleinen Sachen in die Hand nahm, die Fee liebevoll für ihr Kind hergerichtet hatte. In vier Wochen würde dort ein kleines Wesen in der Wiege liegen, Fee und sein Kind. Es war ein wunderliches Gefühl.
Er war richtig froh, als das Telefon läutete. Und er wünschte sich für diesen Abend noch viele Hausbesuche, aber ausgerechnet jetzt schien man ihn schonen zu wollen.
Dieter Behnisch war am Telefon. Er fragte, ob Daniel nicht Lust auf einen kleinen Plausch hätte. Der Schorsch käme auch zu ihm.
Es war schon sehr selten, dass die drei alten Freunde einmal gleichzeitig frei waren. Dr. Georg Leitner, der Chefarzt der Gynäkologischen Klinik, die Dr. Behnisch eingerichtet hatte, war wie Dieter noch immer Junggeselle. Er war ein ausgezeichneter Arzt, aber als Mann hatte er sich immer mit Konflikten und Hemmungen herumschlagen müssen. Er hatte lange mit seiner Mutter zusammengelebt, und wenn man Frau Leitner auch nicht mit Frau Blohm vergleichen konnte, so hatte das enge Mutter-Sohn-Verhältnis auf Schorsch seine Rückwirkungen gehabt.
Jetzt hatte er in der Frauenklinik eine gemütliche kleine Junggesellenwohnung, und seine Mutter hatte in ihrem Haus vier junge Mädchen aufgenommen, die die nahe gelegene Pädagogische Hochschule besuchten. Schorsch wusste zu berichten, dass sie sich dabei sehr wohlfühlte.
»Und was macht Fee?«, fragte er. »Sie wird es mir doch nicht antun und das Baby auf der Insel zur Welt bringen?«
»Na, das würde ich unserm Sprössling ganz schön übelnehmen«, sagte Daniel. »Schließlich will ich ihn gleich begutachten. Aber es war schon besser, dass Fee diese Woche nicht hier verbringt.«
Von seinen beiden unterschiedlichen Patientinnen konnte Dr. Behnisch recht zuversichtlich berichten. Penny Holzmanns Zustand hatte sich merklich gebessert. »Es ist doch auch rührend, wie jeder bemüht ist, ihr Freude zu bereiten«, sagte er gedankenvoll. »Ein so inniges Verhältnis zwischen Schwiegereltern und -tochter habe ich noch nie erlebt. Sie muss ja ein ganz bezauberndes Geschöpf gewesen sein.«
»Gewesen?«, fragte Daniel erschrocken.
»Sie wird viele Narben zurückbehalten«, sagte Dieter. »Mir ist ziemlich bange davor, was unter den Verbänden hervorkommt.«
»Heutzutage kann man vieles korrigieren«, meinte Daniel zuversichtlich. »Und was tut sich bei Frau Blohm?«
»Sie macht eine psychische Wandlung durch, aber ich habe die Hoffnung, dass diese sich nicht negativ auswirken wird, da der kleine Toby ein ganz schlauer Bursche ist. Er hat seiner Mami heute angekündigt, dass der Papi am Wochenende bestimmt Zeit haben würde, sie auch zu besuchen, und sie wird hoffentlich so vernünftig sein, den armen Mann nicht vor den Kopf zu stoßen.«
»Als Ehemann scheint er sich aber bisher nicht bewährt zu haben«, warf Daniel ein.
»Was heißt da bewährt? Frag doch mal Schorsch, wie es ist, wenn man ständig mit seiner Mutter zusammenlebt. Das kann man nicht einfach wegwischen. Bert Blohm ist ein gutmütiger Mensch. Er ist entschlossen gutzumachen, was er versäumt hat. Schöner wäre es für die junge Frau Blohm wohl gewesen, wenn sie eine Schwiegermutter wie Frau Holzmann bekommen hätte.«
»Meine Mutter beweist jetzt jedenfalls, dass sie sehr gut ohne mich zurechtkommt«, erklärte Schorsch Leitner.
»Und das behagt dir wohl auch wieder nicht?«, fragte Daniel neckend.
»Alles hat zwei Seiten«, gab der andere zu. »Aber zu einer Erkenntnis bin ich gekommen. Als Einzelkind aufzuwachsen ist nie gut. Merk dir das, Daniel.«
»Gegenbeweis ist Dirk Holzmann«, erklärte Dieter. »Er ist auch ein Einzelkind. Es kommt auf die Einstellung der Eltern an, wenn’s ans Heiraten geht. Ob sie sich nun auf den Standpunkt stellen, dass ihr Kind ihnen genommen wird, oder aber auf den, dass sie eines dazubekommen.«
»Ich glaube nicht, dass Fee sich mit einem Kind zufriedengibt«, sagte Daniel gedankenverloren, »aber ich bin froh, wenn erst mal das eine da ist.«
»Siehst schon ganz mitgenommen aus«, meinte Schorsch anzüglich. »Aber beneidenswert bist du. Wenn ich uns Einzelgänger so betrachte, könnte ich trübsinnig werden.«
»Meine lieben Freunde, es liegt nur an euch, dem abzuhelfen. Ich hoffe, dass es wenigstens Dieter jetzt mal packt, oder meinst du, dass du eine bessere Frau findest als Jenny, alter Junge?«
»Wir haben ja keine Zeit zum Heiraten«, brummte Dieter. »Immer wenn wir einen Anlauf nehmen, schleppst du uns die schwersten Fälle ins Haus.«
»Also bleibt es wieder an mir hängen. Na, dann werde ich die schweren Fälle künftig in andere Kliniken verlegen.«
»Vielleicht ins Kreiskrankenhaus?«, fragte Dieter ironisch. »Übrigens wird Dr. Dahm bei mir anfangen, und dann habe ich vielleicht auch mal mit Jenny gemeinsam einen freien Tag, an dem wir zum Standesamt eilen können.«
»Und was wird aus mir?«, fragt Schorsch.
»Ja, was machen wir mit diesem lahmen Burschen?«, fragte Dieter. »Er kann doch nicht für alle Zeiten nur immer fremden Kindern ins Leben verhelfen.«
»Ich bin sowieso schon zu alt, um noch Vater zu werden«, knurrte Schorsch. Aber da antwortete ihm schallendes Gelächter.
*
Am Freitag ging es in Dr. Nordens Praxis wieder hoch her.
»Das Wochenende steht bevor«, stöhnte Molly. »Man merkt es.«
Aber schuld war wieder einmal eine Zeitungsmeldung. Irgendwo waren ein paar Typhusfälle bekannt geworden und nun kam jeder, der Magenbeschwerden hatte, ängstlich angelaufen, vor allem diejenigen, die in einem Lokal Kartoffelsalat gegessen hatten.
Einfach darüber hinweggehen konnte man nicht, denn immerhin war es im Einzelfall doch mal möglich, dass eine Ansteckung vorliegen konnte. Daniel schickte Stoßgebete zum Himmel, dass nicht ausgerechnet ihm solch ein Fall unter die Hände käme. Das hätte ihm jetzt gerade noch gefehlt, da Fee doch morgen zurückkam.
Er hatte zu ihrem Empfang noch etwas besonders Hübsches kaufen wollen, aber er war dazu nicht mehr gekommen, und dann sollte ihm der Abend dafür noch etwas bescheren, womit er überhaupt nicht gerechnet hatte.
Er bekam den Hilferuf einer Patientin, die schon mehrere Jahre zu ihm kam. Diesmal brauchte sie ihn nicht selbst, sondern rief ihn zu einer alten Nachbarin, die einen schweren Herzanfall erlitten hatte.
Daniel fuhr sofort hin. Das Haus kannte er. Er brauchte es nicht erst zu suchen. Seine Patientin, Frau Mahler, stand schon in einer Wohnungstür.
Er fragte nicht viel, Sekunden später stand er schon am Bett der alten Dame. Es war kein Herzanfall, sondern ein akutes Kreislaufversagen, das durch eine Injektion schon nach zehn Minuten merklich gebessert wurde.
Während er die Wirkung der Spritze abwartete und die Patientin beobachtete, erzählte ihm Frau Mahler, dass sie sich ein bisschen um die alte Dame, die Charlotte von Dehlen hieß, kümmere.
»Sie wollte ja keinen Arzt, weil sie nicht versichert ist«, flüsterte Frau Mahler, die nicht viel jünger war als Frau von Dehlen. »Aber ich dachte mir, dass man mit Ihnen reden kann, Herr Doktor. Sie sind ja nicht so, dass Sie gleich einen Krankenschein haben wollen.«
Daniel legte den Finger auf den Mund, denn er sah, dass Frau von Dehlen nun wieder zu sich kam. Sein Blick ruhte unentwegt auf dem feinen, faltigen Gesicht.
Die Kranke sprach mit sich selbst, auch das merkte er bald.
»Nur ein paar hundert Mark sind doch zu wenig«, flüsterte sie. »Für mein Begräbnis sollte es schon reichen, Herr Simmer.«
Daniel schob Frau Mahler in das Nebenzimmer, das mit schönen alten Möbeln ausgestattet war.
»Wissen Sie, was Frau von Dehlen meint?«, fragte er.
Frau Mahler nickte. »Der Simmer war hier. Ein Halsabschneider. Er luchst ihr die schönsten Stücke für ein Butterbrot ab, aber sie muss ja leben. Ihr Meißner Service wollte sie verkaufen. Fünfhundert Mark wollte er ihr geben, und darüber hat sie sich aufgeregt. Sie hat ja nicht viel Ahnung, was das heute wert ist, und ich mag nichts sagen, damit sie nicht meint, ich wollte was von ihr haben. Sie will mir doch schon dauernd etwas schenken.«
»Hat sie keine Angehörigen?«, fragte Daniel.
»Gar keine mehr. Sie hat schrecklich viel durchgemacht. Muss mal sehr reich gewesen sein. Aber so sieht es dann aus, wenn man alt geworden ist und nicht mal eine Rente bekommt. Ihren ganzen Schmuck hat sie schon verkauft, aber dabei hat man sie bestimmt auch übers Ohr gehauen.«
»Ich muss wieder zu ihr«, sagte Daniel. »Später, Frau Mahler.«
Er setzte sich zu Frau von Dehlen ans Bett, ergriff ihre feine, abgemagerte Hand und blickte in zwei Augen, die alles Leid der Welt in sich bargen.
»Ich bin Dr. Norden«, sagte er. »Geht es Ihnen wieder besser, Frau von Dehlen?«
»Ich kann keinen Arzt bezahlen«, flüsterte sie.
»Pssst«, machte er, »davon reden wir nicht. Wie fühlen Sie sich?«
»Müde.«
»Dann werden Sie jetzt wunderbar schlafen«, sagte er. »Morgen komme ich wieder.«
»Vielleicht wache ich nicht mehr auf. Es wäre wohl das Beste, aber schuldig bin ich noch nie etwas geblieben. Würden Sie bitte diesen Leuchter als Honorar nehmen?«
Daniel blickte auf den herrlichen silbernen Leuchter, der dreiarmig auf dem niederen Tisch stand.
»Er ist ein Vermögen wert«, sagte er.
»Herr Simmer sagt, dass man heute nichts mehr dafür bekommt«, flüsterte die Kranke.
Dieser Herr Simmer schien ein ganz gemeiner Ausbeuter zu sein, der eine alte, kranke Frau schamlos betrog.
»Sie sollten mit Herrn Simmer keine Geschäfte machen, gnädige Frau«, sagte Daniel, weil er meinte, dass ihr diese Anrede wohl zustünde und man ihr helfen müsse.
»Aber ich kenne niemanden, der mir etwas abkauft«, murmelte sie. »Ich kann doch nicht hausieren gehen. Wissen Sie, wie es ist, wenn man der Welt entwachsen ist, in der man alt wurde. Ich kenne und verstehe diese Welt nicht mehr. Der einzige Mensch, der gut zu mir ist, ist Frau Mahler, und sie will nie etwas annehmen. Von diesen Dingen, die einmal so selbstverständlich zu meinem Leben gehörten, kann ich nichts mitnehmen. Aber solange es mir von Gott bestimmt ist, muss ich leben. Es soll niemand sagen, dass eine Dehlen unwürdig gestorben ist.«
Stolz war sie und vornehm. Nein, sie passte gewiss nicht in diese raue Welt, in der man sich behaupten musste, um nicht unterzugehen. Aber man konnte nicht teilnahmslos zusehen, wie sie ausgeplündert wurde.
»Für diesen Leuchter hätten Sie hundert Krankenbesuche gut, Frau von Dehlen«, sagte Daniel. »Aber wir können uns auch einigen. Sie verkaufen mir den Leuchter zu dem Preis, zu dem er von einem Sachverständigen geschätzt wird. Meine Frau liebt diese antiken Stücke.«
Sie sah ihn lange an. »Sie wollen mir helfen«, flüsterte sie. »Ich lese es in Ihrem Gesicht. Aber einem Menschen, der mir in der Not beisteht, kann ich nichts verkaufen.«
»Und ich kann nichts annehmen, was so wertvoll ist«, sagte Daniel. »Sie haben mich nicht gerufen, und ich werde kein Honorar verlangen.«
»Herr Simmer hätte mir fünfzig Mark für den Leuchter gegeben, aber nur, wenn ich ihm das Service verkaufe«, sagte sie.
»Ich bin zwar kein Sachverständiger, aber ich meine, dass der Leuchter allein mindestens tausend Mark wert ist und ein Meißner Service hat heute Liebhaberwert. Darf ich Ihnen jemanden schicken, der Ihnen einen angemessenen Preis bezahlen würde?«
»Herr Simmer sagt doch aber, dass die Leute heute lieber Häuser und Grundstücke kaufen als den alten Plunder, wie er es nennt.«
»Dann ist Herr Simmer nicht nur ein Lügner, sondern ein Betrüger. Sie tun gut daran, ihn nicht mehr in Ihre Wohnung zu lassen, gnädige Frau. Wenn Sie den Leuchter verkaufen wollen, nehme ich ihn gern, bevor Herr Simmer ihn mir wegschnappt. Aber ich zahle das, was er wert ist.«
»Sie sind meinetwegen so spät abends gekommen«, sagte Frau von Dehlen. »Ich war einmal bei einem Arzt vor ein paar Monaten. Er hat hundert Mark für die Konsultation verlangt und mir nicht geholfen. Sie haben mir geholfen und sind zu mir gekommen. Und Sie sprechen mit mir, als würden wir uns schon lange kennen.«
Daniel hielt die feine Hand. Sicher waren sie einmal reiche, mächtige Leute, dachte er. Nicht von jener Art, die ihr Geld zur Schau stellten, sonst könnte man sie nicht so gemein betrügen. Diesem Herrn Simmer müsste man eigentlich auf die Finger klopfen.
Wie lange wird sie noch leben, überlegte er. Sie denkt ja schon an ihren Tod und daran, dass eine von Dehlen nicht unwürdig sterben sollte. Musste man nicht etwas tun, dass sie noch eine kurze Zeit friedlich leben und dann auch sterben konnte, ohne den Gedanken mitzunehmen, dass diese Welt nichts Schönes mehr hatte?
»Ich möchte Ihnen einen Tausch vorschlagen, gnädige Frau«, sagte Daniel. »Sie werden sich ein paar Wochen auf der Insel der Hoffnung erholen und dafür schenken Sie mir den Leuchter, weil Sie ja anscheinend so gern schenken.« Es gelang ihm sogar, dies humorvoll zu sagen.
»Insel der Hoffnung, wie schön das klingt«, flüsterte sie. »Was ist das?«
Er erzählte ihr von der Insel, und ihr feines Gesicht verklärte sich immer mehr.
»Es wäre schön, wenn ich so etwas noch kennenlernen dürfte. Wirklichen Frieden nach all den schlimmen Jahren. Aber ich habe mir nie etwas schenken lassen, Herr Dr. Norden. Wenn sich ein Käufer für das Service findet, der einen Preis zahlt, mit dem ich wiederum dann den Aufenthalt auf der Insel der Hoffnung bezahlen kann, würde ich gern dorthin gehen.«
»Ich werde Ihnen diesen Käufer morgen bringen, gnädige Frau, und übermorgen wird mein Schwiegervater Sie zur Insel mitnehmen, wenn Sie wollen.«
»Vollbringen Sie Wunder?«, fragte sie mit einem feinen Lächeln. »Ich meinte eben noch, sterben zu müssen, und fühle mich jetzt wohl, wie schon lange nicht mehr. Ja, ich wollte sterben und jetzt möchte ich leben, um diese Insel der Hoffnung zu sehen. So viel Bitternis hat sich in mir angesammelt und ist nun wie weggeblasen. Aber wenn Sie jetzt nicht sofort den Leuchter mitnehmen und Ihrer jungen Frau dann zum Willkommen auf den Tisch stellen, will ich Sie nie wieder hier sehen und Herr Simmer soll mich nur ruhig weiterhin um meinen letzten Besitz betrügen.«
Daniel zog die feine Hand an seine Lippen. »Das klingt gut, Frau von Dehlen«, sagte er lächelnd. »Ich beuge mich dem stärkeren Willen.«
»Sie sind wie mein Amadeus«, sagte sie leise. »Mein Sohn, mein geliebter Sohn. Er zog hinaus in den Krieg in dem Glauben, dass die Gerechtigkeit und die Menschlichkeit siegen müssen. Es ist gut, dass er nicht erfahren musste, wie unmenschlich diese Welt sein kann. Und für mich ist es gut, dass ich noch erfahren durfte, dass es noch Güte und Verstehen gibt.«
»Schlafen Sie jetzt, Frau von Dehlen«, sagte Daniel erschüttert.
»Erst, wenn Sie mit dem Leuchter die Wohnung verlassen haben«, erwiderte sie. »Gestatten Sie doch einer alten Frau das letzte Wort.«
Daniel hoffte, dass es nicht ihr letztes Wort sein möge.
»Sie müssen den Leuchter mitnehmen«, raunte ihm Frau Mahler zu. »Sie ist doch so stolz. Sie könnte nicht schlafen, wenn der Leuchter auf dem Tisch stehenblieb. So gut kenne ich sie schon, wenn sie auch nie so mit mir geredet hat, wie mit Ihnen, Herr Doktor.«
»Sie hat ein starkes Herz, Frau Mahler«, sagte Daniel.
»Ja, deswegen habe ich mich gewundert, dass sie zusammengeklappt ist. Aber der Simmer hat ja keinen Anstand. Er weiß nicht, wie man mit einer Dame redet. Und sie kann nicht feilschen. Es ist schon ein Jammer, Herr Doktor. Aber ich danke Ihnen auch sehr, dass Sie gekommen sind. Wie gut es ihr tut, wenn jemand so mit ihr spricht, wie es ihr zusteht.«
»Wie gut, dass sie eine Nachbarin hat, die sich um sie kümmert.«
»Meistens bin ich doch auch allein. Viel Zeit haben die Kinder nicht für ihre alte Mutter, aber ich will mich nicht beschweren. Als wir jung waren, war es nicht anders.«
Verlegen betrachtete Daniel den Leuchter in seiner Hand, aber Frau Mahler schien zu ahnen, was er dachte.
»Sie verstehen wenigstens wirklich was davon und wissen so was zu schätzen, und Frau von Dehlen wird nun richtig schlafen können.«
»Ich werde morgen am frühen Vormittag nach ihr sehen«, versprach er nochmals.
*
In der Praxis hörte er noch den automatischen Anrufbeantworter ab, aber es lag nichts mehr vor, abgesehen davon, dass Dieter Holzmann ihn bat, morgen früh anzurufen.
Wäre es sehr wichtig, hätte er um sofortigen Rückruf gebeten. Also konnte Daniel jetzt beruhigt zu Bett gehen. Er betrachtete noch ein paar Minuten den Leuchter, die wundervolle handwerkliche und künstlerische Ziselierung.
Wieder einmal war ihm ein Mensch begegnet, der Liebe und Verehrung verdiente und doch einsam war und schwach, und dessen Schwäche von einem skrupellosen Menschen schamlos ausgenutzt wurde.
Nein, von der alten Frau Mahler konnte man auch keine Initiative mehr erwarten. Sie war diesem Herrn Simmer gewiss auch nicht gewachsen, aber in Daniel war längst der Entschluss gereift, sich diesen Mann einmal ganz genau anzuschauen. Er ahnte nicht, dass sich dazu schon am nächsten Morgen Gelegenheit bieten würde.
Er war schon gegen neun Uhr bei Frau von Dehlen, denn er wollte wieder daheim sein, wenn Fee kam.
Schon als er die Treppe zu der Wohnung der alten Dame emporstieg, hörte er Frau Mahlers erregte Stimme.
»Nein, Sie können nicht zu ihr. Sie ist krank. Was pressiert es Ihnen denn überhaupt, wenn die Sachen doch gar nichts wert sind?«
»Mischen Sie sich da nicht ein. Ich habe meine Abmachungen mit Frau von Dehlen.«
»Aber jetzt ist sie krank, und da kommt ja auch schon Dr. Norden«, sagte Frau Mahler mit einem erleichterten Aufatmen.
»Ja, da ist er«, sagte Dr. Norden sarkastisch. Den Herrn Simmer hatte er sich allerdings ganz anders vorgestellt. Er war ein noch recht jugendlicher Mann, sehr elegant gekleidert, auf den ersten Blick auch recht annehmbar aussehend, wenn man nicht von dem tückischen Blick und dem zynischen Mund gewarnt wurde. Aalglatt war er und begrüßte Dr. Norden, als sei er sein bester Freund.
Einem Wortschwall konnte Daniel entnehmen, dass Herr Simmer und Frau von Dehlen die allerbesten Freunde seien und dass Herr Simmer nur aus purem Entgegenkommen einige Wertsachen der alten Dame in Kommission nehmen würde, um ihr über eine wirtschaftliche Notlage hinwegzuhelfen.
Ein raffinierter Bursche, dachte Daniel. Aber dass auch Herr Simmer anscheinend sehr wachsam und auf der Hut war und den Arzt wohl auch richtig einzuschätzen vermochte, wurde schnell deutlich.
»Ich war gestern wegen eines Services hier«, sagte Herr Simmer. »Und es wird Frau von Dehlen sicher ermuntern, wenn ich ihr berichten kann, dass ich einen Interessenten habe, der sogar tausend Mark dafür zahlen würde.«
Daniel musterte ihn mit einem verächtlichen Blick. »Es wird Sie in Erstaunen setzen, wenn ich Ihnen sage, dass ich Frau von Dehlen einen Interessenten bringe, der bereit ist, ihr fünftausend Mark zu zahlen«, sagte er eisig.
Herr Simmer schnappte nach Luft. »Was soll das? Ich war Frau von Dehlen immer gefällig und …«
»Halten Sie die Luft an«, sagte Daniel barsch. »Ich weiß mittlerweile, wie ›gefällig‹ Sie der alten Dame waren. Ich empfehle Ihnen zu verschwinden und sich hier nicht mehr blicken zu lassen. Ich habe Frau von Dehlen schon darüber aufgeklärt, wie sie von Ihnen übers Ohr gehauen worden ist. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?«
»Sie sind bestimmt falsch infomiert. Die alte Dame ist ja nicht mehr richtig bei Verstand«, sagte Herr Simmer frech.
»Sie ist zu anständig für diese Welt«, sagte Daniel, »und nun verschwinden Sie.«
Herr Simmer trat den Rückzug an. Frau Mahler warf Dr. Norden einen dankbaren und bewundernden Blick zu.
»Als Frau ist man da machtlos«, murmelte sie. »Er hat mich bald über den Haufen gerannt. Aber nun ist er ja fort«, fügte sie erleichtert hinzu.
»Wie geht es Frau von Dehlen?«, fragte Daniel.
»Ganz gut. Sie hat durchgeschlafen. Sie sieht wirklich viel besser aus. Dass Sie dem Simmer das mit den fünftausend Mark gesagt haben, hat ihn aber schön geschockt. Ich möchte ja zu gern mal wissen, für wie viel Geld er all die Sachen verkauft hat, die er Frau von Dehlen abgeschwatzt hat.«
»Das möchte ich auch wissen. Aber wahrscheinlich hat sie nicht mal Belege. Nun will ich mich um sie kümmern und schauen, ob sie kräftig genug ist, morgen die Reise anzutreten.«
»Das haben Sie nicht bloß so gesagt, Herr Doktor?«
»Sie kennen mich doch wohl schon ganz gut, Frau Mahler. Ich sage nicht etwas nur so. Das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, ist, falsche Hoffnungen in ihm zu erwecken.«
»Auf Sie kann man sich halt verlassen, ich weiß es«, sagte Frau Mahler ernst.
Sie betraten die Wohnung, und Daniel fand Frau von Dehlen angekleidet in ihrem Lehnsessel sitzend, der auch eine Kostbarkeit war. Sie sah zerbrechlich aus in ihrem dunkelblauen Kleid und ließ doch eine Ahnung aufkommen, wie anmutig sie in ihrer Jugend gewesen sein musste, denn etwas war auch jetzt noch davon erhalten.
»Mein junger Freund«, sagte sie mit ihrer sanften Stimme. Daniel küsste ihr die feine Hand.
»Es freut mich, dass es Ihnen bessergeht«, sagte er voller Wärme.
»Sie haben mir Hoffnung eingeflößt. Es stimmt doch, dass Sie von der Insel der Hoffnung gesprochen haben? Ich habe es nicht nur geträumt?«
»Nein, Sie haben es nicht geträumt. Morgen kann die Reise losgehen.«
»Ich kann es nicht glauben«, flüsterte sie.
»Sie werden es erleben«, sagte Daniel.
»In meinem Alter weiß man nie, ob man den nächsten Tag erlebt«, sagte Frau von Dehlen gedankenverloren. »Aber es ist schön, wenn man sich auf etwas freuen kann. So ein bisschen träumen, nicht nur ins Blaue hinein. Nun lächeln Sie ruhig über die sentimentale alte Frau.«
»Dazu besteht keine Veranlassung. Ich habe nicht geahnt, dass Sie sich so sehr freuen. Sie haben sicher viel von der Welt gesehen, gnädige Frau.«
»O Gott, es ist schon so lange her und es war eine ganz andere Welt. Aber Sie sollen nicht zu viel von Ihrer kostbaren Zeit opfern, um mein Geschwätz anzuhören. Doch noch eins, Herr Doktor. Meinen Sie wirklich, dass Sie mein Service zu einem Preis verkaufen können, der meine Unkosten deckt?«
»Mehr als diese, Frau von Dehlen. Aber davon reden wir jetzt gar nicht. Ich bin vorerst tief in Ihrer Schuld.«
»Inwiefern?«
»Für den herrlichen Leuchter, über den meine Frau sich sehr freuen wird. Sie kommt heute von der Insel zurück.« Unwillkürlich blickte er auf die Uhr.
»Dann beeilen Sie sich, dass Sie heimkommen«, sagte Frau von Dehlen. »Frau Mahler hat mir erzählt, dass Ihre Frau ein Baby erwartet.«
»Ja, bald«, erwiderte Daniel, und hoffentlich übersteht sie die Fahrt diesmal auch gut, dachte er für sich und wurde nun doch ein bisschen nervös. »Morgen gegen fünf Uhr holen wir Sie ab, ist es recht so?«
»Ich weiß noch immer nicht, was ich sagen soll.« Und so ganz schien sie es auch noch nicht zu glauben.
Über diesen Besuch und in der Eile, nun schnell heimzukommen, hatte Daniel ganz vergessen, Dieter Behnisch anzurufen. Es fiel ihm unterwegs ein, aber jetzt wollte er wirklich schnellstens nach Hause, denn er nahm an, dass die Insulaner, wie er die Familie scherzhaft nannte, ziemlich früh kommen würden, denn Anne wollte sicher noch einige Einkäufe tätigen. Und so war es dann auch, obgleich er den Wagen seines Schwiegervaters weder vor dem Haus noch in der Tiefgarage entdecken konnte.
Aber Fee kam ihm schon an der Tür entgegen. Sie sank in seine Arme, bedeckte sein Gesicht mit zärtlichen Küssen und sagte eine ganze Weile gar nichts. Sie war einfach glücklich.
Dann aber sprudelte es doch über ihre Lippen und er war glücklich, ihre frohe, geliebte Stimme zu hören.
»Du, was machst du für Sachen?«, fragte sie schelmisch. »Wie kannst du so viel Geld ausgeben, wo wir doch jetzt planen müssen.«
»Wofür Geld?«, fragte er irritiert, denn an den Leuchter dachte er im Augenblick gar nicht.
»Hast du denn etwas geschenkt bekommen?«, fragte sie neckend. »Ein herrliches Stück, aber doch ein Vermögen wert.«
»Was schätzt du wohl?«, fragte er verschmitzt.
»Eigentlich ist so was doch gar nicht mehr zu bezahlen. Dan, wir müssen das Geld zusammenhalten.«
»Bis jetzt hat er mich einen Krankenbesuch gekostet«, sagte Daniel.
Erschrocken, ja, vorwurfsvoll sah Fee ihn an. »Das hast du angenommen? Damit bin ich bestimmt nicht einverstanden.«
»Ich war es auch nicht, Liebling, aber Frau von Dehlen hat ihn mir buchstäblich aufgedrängt. Dafür habe ich ihr versprochen, dass sie die Insel kennenlernen soll. Ich denke doch, dass Paps damit einverstanden ist und sie morgen mitnehmen wird. Wo sind die beiden überhaupt?«
»Schon in die Stadt gefahren. Die Geschäfte sind ja nur bis mittags geöffnet. Anne will einiges besorgen. Also, die Geschichte mit der Patientin und dem Leuchter musst du mir noch genau erzählen, aber vorerst darf ich nicht vergessen, dass Dieter angerufen hat. Er hat auch eine Patientin, die er auf die Insel schicken möchte. Deinen Schützling!«
»Frau Blohm? Will sie sich schon wieder von ihrem Kind trennen?«, fragte er nachdenklich.
»Nein, sie möchte das Kind mitnehmen. Ich weiß im Augenblick wirklich nicht, wie wir gleich zwei unterbringen könnten, aber Paps wird das schon irgendwie deichseln. Er kann dir ja nichts abschlagen.« Sie lachte ihn verschmitzt an.
»Frau von Dehlen kann ich nicht vertrösten. Sie ist eine alte Dame, sehr vornehm, sehr feinsinnig, sehr bescheiden. Sie hat in ihrem Leben genug Enttäuschungen erfahren müssen.«
»Arm kann sie aber nicht sein, wenn sie so kostbare Gegenstände so einfach weggibt.«
»Das ist es gerade. Sie hat nur noch ein paar kostbare Stücke. Um vieles hat sie dieser Simmer schon gebracht. Und nun …«
Er kam nicht weiter. Fee fiel ihm ins Wort. »Simmer? Der teure Jakob?«
»Wieso teurer Jakob?«
»Weil er Jakob heißt und wahnsinnig teuer ist. Er hat doch diesen ganz tollen Laden in der City. So ein aalglatter Zuhältertyp?«
»Aus dieser Sicht habe ich ihn nicht betrachtet. Du, hör mal, in welchen Kreisen bewegst du dich eigentlich?«
»Meine Güte, man schaut sich um. Isabel hat mich da mal hingeschleppt. Er hat schöne Stücke, aber sündhaft teuer. Lebt auf ganz großem Fuß. Isabel hat schon gesagt, dass er nicht ganz stubenrein ist.«
»Er muss Frau von Dehlen herrliche Stücke für ein Butterbrot abgeluchst haben«, sagte Daniel. »Für ein Meißner Service wollte er ihr fünfhundert Mark zahlen.«
»Das darf nicht wahr sein! In seinem Laden habe ich eins gesehen für fünfzehntausend.«
»Fünfzehntausend?«, wiederholte Daniel gedehnt. »Das ist ja Wahnsinn.«
»Denke ich auch. Ich würde gar nicht wagen, ein Stück in die Hand zu nehmen aus Angst, es könnte entzwei gehen. Na, dreitausend hätte er für den Leuchter auch mindestens verlangt.«
»Ich habe ja keine Ahnung, wie diese Sachen gehandelt werden«, sagte Daniel.
»Und Frau von Dehlen scheint noch weniger zu haben«, stellte Fee sachlich fest.
»Sie passt nicht in diese Welt, Fee. Sie denkt nichts Böses. Sie muss ihr Leben fristen und sitzt in ein paar schönen Sachen, die ihr geblieben sind, wie eine Nippfigur aus einem anderen Jahrhundert.«
»Und dieser abgebrühte Geschäftemacher ist irgendwie an sie geraten und nutzt es schamlos aus. Aber hat sie denn niemanden, der sie beraten könnte? Wie bist du überhaupt zu ihr gekommen?«
»Durch Frau Mahler. Sie wohnt im gleichen Haus. Frau von Dehlen hatte einen Kreislaufkollaps, aber wie es scheint, hat der sie davor gerettet, auch das letzte wertvolle Stück loszuwerden. Ich muss jetzt nur schleunigst jemanden finden, der einen guten Preis für das Service zahlt, denn schenken lassen will sie sich nichts.«
»Man kann ihr doch auch anders helfen, ohne ihr noch etwas wegzunehmen. Mir geht so was so ganz gegen den Strich.«
»Mir auch, Feelein, aber versuch du mal, ihr das ein- oder auszureden. Was kann man denn tun, wenn sie so eigensinnig ist? Sie trägt die Ehrbegriffe einer traditionsreichen Familie in sich und lebt mit ihren Gedanken in der Vergangenheit. Es wäre sogar möglich, dass sie berechtigte Ansprüche an den Staat stellen könnte, aber das wäre für sie schon wie ein Bittgang. Dazu ist sie nicht fähig. Ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht weiß, was in der Welt so vor sich geht. Sie ist der Ewigkeit schon näher als dieser Welt.«
»Die doch auch wunderschön ist«, sagte Fee leise und warf Daniel einen zärtlichen Blick zu.
»Wenn man liebt und geliebt wird, wenn man nicht einsam ist. Deshalb möchte ich, dass sie noch ein paar schöne Wochen erlebt. Sie ist so rührend hilflos und doch so stolz. Sie will niemandem zur Last fallen. Sie will nicht nehmen, stets nur geben. Es ist so unendlich traurig, wenn gerade solch ein Mensch in die Hände eines skrupellosen Ausbeuters fällt.«
»Dem Simmer werde ich schon eins auswischen«, sagte Fee, »da muss ich mal mit Isabel reden. Ich muss nur erst wissen, was er Frau von Dehlen alles abgehandelt hat.«
»Du denkst jetzt mal hübsch an unser Baby und mischst dich da nicht ein, mein Liebes. Der Bursche ist viel zu raffiniert, als dass man ihm beikommen könnte«, wehrte Daniel ab.
»Das werden wir ja sehen.«
»Nicht aufregen, Schätzchen. Du kennst doch Frau von Dehlen noch gar nicht.«
»Mir genügt es, wenn du jemanden magst.«
»Mein Liebstes«, sagte er zärtlich. »Ich habe dich so sehr vermisst.«
»Eine Woche, und was ist alles geschehen«, flüsterte sie.
»Und wie schnell gerät es bei denen in Vergessenheit, die nicht direkt beteiligt sind. Es ist kein Wunder, dass sich eine Frau wie Frau von Dehlen in dieser Welt nicht zurechtfindet.«
»Wie geht es der jungen Frau Holzmann? Ich habe vergessen, mich bei Dieter zu erkundigen.«
»Nun, es geht aufwärts, und mehr kann man im Augenblick nicht erwarten. Sie lebt, und dafür sind ihre Angehörigen dankbar.«
»Es ist alles sehr schlimm. Sich vorzustellen, dass man einen geliebten Menschen so schnell verlieren kann, von einer Stunde zur andern.«
»Ich bin froh, dass du wieder bei mir bist, Fee.«
»Du wolltest, dass ich auf der Insel bleibe«, erinnerte sie ihn.
»Ja, ich wollte es, und ich war auch froh, dass du nicht dabei warst, aber als es dann hier wieder ruhiger wurde, spürte ich, wie allein ich ohne dich bin. Mich hat es immer ins Kinderzimmer gezogen, und ich habe immer wieder all die kleinen Sächelchen betrachtet. Wird unser Baby zuerst wirklich so winzig sein, Fee?«
»Noch winziger, hoffe ich, denn Schorsch hat mir genaue Anweisungen gegeben, dass es möglichst nicht mehr als sechs Pfund wiegen soll, und ich denke, dass wir das schaffen.«
»Ich glaube, dass ich mich sehr dumm anstellen werde als Vater.«
»Du hast doch schon Kindern auf die Welt geholfen«, sagte Fee, »und dabei hast du dich auch nicht dumm angestellt.«
»Aber das war nicht dein und mein Kind. Willst du, dass ich bei der Geburt dabei bin, Fee?«
»Gott bewahre mich, nein. Du machst mich nur nervös. Du hast ja jetzt schon Angst, Dan. Es geht mir bestens, und du wirst sehen, dass es ganz pünktlich kommt.«
Dr. Cornelius und Anne kamen erst am späten Nachmittag zurück. Sie waren noch im Haus der Kunst gewesen, wo ein Gemäldeaustellung veranstaltet wurde, und nun waren sie restlos erschöpft.
Sie gönnten ihnen Ruhe, bevor sie mit ihrem Anliegen herausrückten.
»Kinder, das wird ein bisschen schwierig«, sagte Dr. Cornelius.
»Aber irgendwie werden wir das schon einrichten«, warf Anne rasch ein. »Allerdings können wir drei Personen nicht mitnehmen. Wir haben den Wagen vollgepackt.«
»Frau Blohm wird auch erst Mitte der Woche aus der Klinik entlassen«, sagte Fee.
»Na, dann ist ja alles in Ordnung«, entgegnete ihr Vater. »Wisst ihr, Kinder, es ist wunderschön, mit euch beisammen zu sein, aber die Stadt kostet mich die letzten Nerven. Wie die Menschen das nur aushalten. Ich würde eingehen wie eine Primel.«
»Apropos Primel, Paps«, warf Daniel ein, »wie kann man eine Primelallergie bekämpfen? Ich meine wirksam bekämpfen?«
»Indem man Primeln aus dem Wege geht, mein Lieber, sonst überhaupt nicht, oder nur in den seltensten Fällen und durch gewisse Abwehrstoffe, die der Betroffene selbst bildet. Ich machte dir da überhaupt keine Illusionen mehr. Diese Allergieteste sind eine Plagerei und führen ganz selten zu einem Erfolg. Aber das weißt du ja selbst.«
»Daniel ärgert sich nur immer schrecklich, wenn man so läppischen Dingen nicht auf die Spur kommt«, sagte Fee.
»Dann soll er sich damit trösten, dass Allergiker nachweislich am immunsten gegen Krebs sind.«
»Bist du davon wirklich überzeugt, Paps?«, fragte Daniel. Früher hatte er seinen Schwiegervater immer mit seinem Vornamen angeredet, aber seit sie das Baby erwarteten, hatte er sich daran gewöhnt, ihn Paps zu nennen.
»Kinder, müssen wir denn dauernd über Krankheiten reden?«, fragte Anne seufzend. »Wir haben jetzt auch erst ein paar Fälle gehabt, die mich traurig gestimmt haben.«
»Reden wir also von Katja und David«, sagte Daniel. »Was treiben die beiden?«
Katja, Annes Tochter aus erster Ehe, und der junge Pianist David Delorme wollten in absehbarer Zeit heiraten. David schwirrte zur Zeit aber noch in der Welt umher, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Katja war nicht mit nach München gekommen, um nur ja nicht einen etwaigen Anruf von ihm zu versäumen.
»David gib heute ein Konzert in New York und übermorgen eins in San Franzisko. Wie er das durchsteht, ist mir ein Rätsel«, erklärte Anne.
»Und Katja wandelt traumverloren durch den Inselalltag«, sagte Dr. Cornelius. »Aber heiraten wollen sie ohnehin erst, wenn euer Baby reisefähig ist.«
»Sie sind beide noch so jung«, sagte Anne. »Ich habe große Befürchtungen, dass Katja das Herumzigeunern durchhält.«
»Eines Tages nimmt David eine Professur an und wird ein ganz gemütlicher Beamter«, meinte Daniel lachend.
»Das würde mich beruhigen«, erwiderte Anne hoffnungsvoll. »Gib mir bitte noch ein Glas Wein, Hannes.«
»Dir fallen ja schon die Augen zu«, lächelte Johannes Cornelius.
»Meine Beine sind so schwer, als hätten wir heute den Mont Blanc bestiegen«, antwortete sie gähnend, »aber ich bin nicht mehr die Jüngste.«
*
Dass sie nicht mehr die Jüngste sei und man doch wohl Rücksicht verlangen könne, hatte auch Adelheid Blohm zu ihrem Sohn gesagt, allerdings in einem ganz anderen Ton als Anne Cornelius.
Bert war am Vormittag mit Toby im Tierpark gewesen, um den Jungen abzulenken, der dauernd drängte, die Mami zu besuchen. Aber Bert brachte einfach nicht den Mut auf, zu Birgit zu gehen, bevor nicht Dr. Biel mit ihr gesprochen hatte. Das wollte der Anwalt an diesem Vormittag tun, er hatte es Bert fest versprochen.
Toby konnte der Tierpark anscheinend heute nicht so recht gefallen, so gern er sonst auch dort war.
»Warum besuchen wir nicht lieber Mami?«, fragte er seinen Vater. »Sie ist doch so viel allein.«
»Wir können sie heute erst nachmittags besuchen«, redete sich Bert heraus. »Es ist Samstag.«
»Aber sonst durfte ich doch schon vormittags zu Mami«, beharrte Toby. »In der Klinik sind sie sehr nett. Der kleine Timmi kommt auch jeden Tag. Seiner Mami geht es viel schlechter als unserer.«
»Mami wird nun bald wieder aus der Klinik herauskommen«, erklärte Bert stockend. »Und dann verreist ihr. Dr. Behnisch und Dr. Biel sprechen heute mit ihr darüber.«
»Warum kommst du nicht mit, Papi?«, fragte Toby mit kritischer Miene.
»Weil ich arbeiten muss, und dann will ich eine Wohnung für uns suchen.«
»Erlaubt das die Großmama?«, fragte Toby.
Bert gab es einen Stich. Selbst für seinen Sohn schien allein die Großmama maßgeblich zu sein, wenn es um Entscheidungen ging.
»Das können wir doch selbst entscheiden. Ist es dir nicht lieber, wenn wir eine Wohnung ganz für uns haben?«
»Ein Haus mit Garten wäre mir schon lieber«, erwiderte Toby ehrlich. »Kannst du nicht lieber eine Wohnung für Großmama suchen? Ich bin doch an das Haus und den Garten so gewöhnt.«
Sein kindlicher Egoismus regte sich, aber er hatte ja keine Ahnung, mit welchen Sorgen sich sein Vater plagte.
»Vielleicht finde ich auch ein Haus mit Garten«, meinte Bert. »Vielleicht werde ich auch versetzt.«
Gerade in diesem Augenblick war ihm der rettende Gedanke gekommen, seinen Chef zu bitten, ihn an eine Zweigstelle des Werkes zu versetzen. Man hatte ihn doch ohnehin an verschiedenen Stellen des Werkes eingesetzt gehabt.
»Was ist versetzt?«, fragte Toby.
»Dass wir in eine andere Stadt ziehen.«
»Mir ist das egal, wenn nur Mami bei uns ist«, sagte Toby. »Fahren wir nun endlich in die Klinik?«
Bert musste erst Dr. Biel anrufen. Er fürchtete sich davor, denn wenn der Anwalt ihm erklären würde, dass Birgit ihn nicht sehen wollte, wusste er nicht, was er seinem Sohn sagen sollte.
Ihm fiel ein zentnerschwerer Stein von der Seele, als er von Dr. Biel vernahm, dass Birgit auf seinen Besuch eingestellt sei. Eine vage Hoffnung erfüllte ihn.
»Jetzt fahren wir zu Mami«, verkündete er, »aber erst kaufen wir noch Blumen.«
Das war gar nicht so einfach, denn inzwischen hatten die Geschäfte schon geschlossen. Aus einem Automaten zog er dann noch alle Blumen heraus, die er enthielt, und es wurde ein hübscher bunter Strauß. Toby gefiel er jedenfalls.
»Ich hätte ja gesagt, dass wir Mami noch was zum Lesen mitnehmen müssen, aber wenn die Geschäfte schon alle zu sind, geht das ja nicht mehr«, meinte er.
»Mami kann doch kein Buch halten«, erinnerte Bert.
»Da hast du auch wieder recht, Papi. Ist aber auch blöd, dass der Arm in Gips ist. Wie lange muss das denn noch sein?«
»Sicher noch ein paar Wochen.«
»Dann kann sie aber nicht baden. Fahren wir diesmal nicht ans Meer?«
»Mami wird dir sagen, wohin ihr fahrt«, erwiderte Bert diplomatisch.
»Du bist komisch. Du hast es doch sonst immer ausgesucht.«
»Diesmal soll Mami aussuchen, wohin sie mit dir fahren will.«
»Aber nicht so weit, dass du uns nicht besuchen kannst«, meinte Toby nachdenklich. »Das Meer ist sehr weit weg.«
Birgit wird ihm auch manche Erklärung geben müssen, dachte Bert. Was immer auch geschehen war, konnte
sie dem Kind zuliebe nicht Zugeständnisse machen? Musste Tim denn auch noch in Konflikte gebracht werden?
Während er nun mit dem Jungen zur Klinik fuhr, drehte sich in seinen Gedanken die Zeit um eine Woche zurück.
Wenn nun das Unglück nicht geschehen wäre, wo wäre Birgit dann? Was alles hätte man Toby dann erklären müssen?
Es schmerzte ihn unsagbar, das Kind so bedenkenlos seiner Großmutter überlassen zu haben. Würde die böse Saat, die sie in ihn hineingelegt hatte, nicht erst später aufgehen? Wie war es überhaupt möglich, dass Toby niemals von ihr sprach? Sie hatte ihn doch fast drei Wochen ganz allein versorgt. Eine Frage zu stellen, wagte Bert nicht. Er wollte nichts in Toby aufrühren.
Er musste nun allerdings die Straße fahren, die auch zu seinem Elternhaus führte, da durch Bauarbeiten die Ausweichstraße gesperrt war.
Toby war sofort hellwach. »Wir fahren doch nicht zu Großmama?«, fragte er aufgeregt.
»Nein, wir fahren zur Klinik. Aber willst du denn Großmama gar nicht guten Tag sagen? Vermisst du sie gar nicht?«, fragte Bert gepresst.
»Muss ich sie vermissen?«, fragte Toby. »Tante Bertl ist viel netter. Sie schimpft nicht gleich, wenn ich mal vergesse, meine Hände zu waschen, und sie schreit auch nicht, wenn das Handtuch schmutzig wird. Und Spinat brauche ich bei ihr auch nicht zu essen. Sie sagt, so gut ist Spinat auch wieder nicht, aber Großmama behauptet, dass Kinder Spinat essen müssen, dann werden sie gescheiter. Hast du viel Spinat gegessen, Papi?«
»Nicht gern«, erwiderte Bert. »Und so gescheit bin ich ja auch nicht.«
»Wenn man nämlich was nicht mag, bekommt es einem auch nicht, meint Tante Bertl, und Mami hat das auch gesagt, aber da hat sie dann von Großmama immer was zu hören bekommen. Wenn du versetzt wirst, Papi, dann aber ganz weit weg von Großmama, gell?«
Kindermund, und doch so viel zum Nachdenken dahinter. Kein Falsch, keinen Beschönigung.
»Warum hast du mir eigentlich nie erzählt, wenn du dich über Großmama geärgert hast, Toby?«, fragte er.
»Weil Mami gesagt hat, dass du dich nicht auch noch ärgern musst. Du hast schon genug Ärger im Geschäft. Aber wenn Mami geweint hat, war ich manchmal schon sehr wütend auf Großmama. Mir ist das nämlich egal, dass wir kein Baby bekommen haben, dir nicht auch, Papi?«
»Mami war traurig«, antwortete Bert. »Sie dachte auch, dass du dich freuen würdest.«
»Warum? Dann hätte Mami sich immer um das Baby gekümmert, und Großmama wollte das. Sie hat es mir gesagt. Sie hat gesagt, dass Mami das Baby dann viel lieber haben würde als mich und dass ich dann auch mit ihr verreisen sollte. Mit Großmama, verstehst du das, Papi?«
»Das kann sie doch nicht gesagt haben«, murmelte Bert fassungslos.
»Hat sie aber gesagt. Ich bin doch nicht dumm, oder denkst du, dass ich dumm bin?«
»Nein, du bist sogar sehr gescheit, Toby.«
»Mami hat mir auch viel erzählt. Sie hat mir auch gesagt, wie Babys wachsen, aber das hat Großmama erst recht geärgert, weil sie gesagt hat, dass Babys vom Storch gebracht werden. Ich finde es aber viel schöner, wenn Babys bei der Mami wachsen. Aber wir brauchen kein Baby mehr. Wir könnten uns ja ein Hündchen anschaffen, meinst du nicht? Ich will nicht, dass meine Mami wieder krank wird.«
»Das will ich auch nicht, Toby«, sagte Bert leise.
Als sie vom Parkplatz zur Klinik gingen, blickte Toby zu seinem Vater empor.
»Mami glaubt es gar nicht richtig, dass du auch nicht mehr bei Großmama wohnst«, sagte er leise. »Sagst du ihr, dass es stimmt?«
Bert nickte.
*
In der Halle trafen sie mit Dirk Holzmann zusammen, der Tim eben sein Schokoladenmündchen abwischte.
Der Kleine riss sich von seinem Papi los und rannte auf Toby zu.
»Toby, Toby«, rief er. »Ist Tim auch da.«
»Das ist Timmi, Papi«, stellte Toby vor.
Dirk kam näher. »Und wir sind Leidensgenossen, Herr Blohm. Ihren Sohn treffen wir ja jeden Tag.«
»Wie geht es Ihrer Frau?«, fragte Bert verlegen.
»So langsam besser, aber wir wollen dankbar sein«, entgegnete er.
Dr. Jenny Lenz kam ihnen entgegen, als sie aus dem Lift stiegen. Die beiden Buben begrüßten sie jauchzend.
»Wie wär’s denn, wenn ihr zwei mir ein bisschen Gesellschaft leisten würdet?«, fragte sie. »Ich habe auch etwas für euch.«
Nichts in ihrem Mienenspiel verriet, dass sie von Bert Blohms Kommen verständigt worden war und ihn erwartet hatte, um Toby vorerst zu beschäftigen, doch Dirk war ihr ebenso dankbar, dass sie ihm seinen lebhaften kleinen Sohn abnahm, wie Bert.
Was Tante Jenny für sie hatte, wollten beide gern wissen, da spielte der Altersunterschied von zwei Jahren keine Rolle.
Dirk ging zu seiner Frau und Bert zu Birgits Zimmer. Sein Herz klopfte bis zum Halse. Er stand sekundenlang still vor der Tür, bis er wagte, die Klinke herabzudrücken.
Birgit hatte geglaubt, dass er mit Toby kommen würde und sich vorgenommen, sich dann erst mit dem Jungen zu beschäftigen. Nun kam Bert allein, und beide waren so befangen, dass sie kein Wort über die Lippen brachten.
Bert legte die Blumen auf den Tisch. »Gitti«, flüsterte er, »vielen Dank, dass ich dich besuchen darf.« Die Stimme wollte ihm kaum gehorchen.
Da war es mit dem Trotz und der Auflehnung bei Birgit schon wieder vorbei. Forsch waren sie beide nie gewesen und fast war es jetzt so wie damals, als sie sich kennenlernten, obgleich sie schon mehr als fünf Jahre verheiratet waren.
Als Bert behutsam ihre Hände ergriff, dachte sie daran, dass sie die Feindseligkeit seiner Mutter nur deshalb ertragen hatte, weil sie Bert liebte und ihn nicht verlieren wollte.
»Wo ist Toby?«, fragte sie.
»Er hat hier schon einen kleinen Freund gefunden, Tim. Frau Dr. Lenz beschäftigt sich mit beiden.«
Es war sicher gut, dass Toby bei diesem Wiedersehen nicht zugegen war, denn er hätte sich wohl doch gewundert, dass seine Eltern sich so benahmen, als müssten sie sich erst kennenlernen. Ungefähr war das auch so, denn sie fühlten beide, dass sie sich verändert hatten und dass vieles anders geworden war.
»Es klingt dumm, wenn ich sage, wie leid mir alles tut«, begann Bert stockend. »Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, und du sollst es nicht als Vorwurf auffassen, aber warum hast du mir nie gesagt, was es zwischen dir und Mutter so gab?«
»Weil ich nicht ahnte, dass sie so weit gehen würde«, erwiderte Birgit ruhig. »Eine Zeit lang war ich auch zu keiner Entscheidung fähig, doch nun möchte ich sagen, dass es sicher gut für mich gewesen ist, dass es so gekommen ist. Gut auch für Toby.«
»Und auch für mich, Gitti. Bitte, gib mir eine Chance«, sagte Bert und sah sie bittend an.
Dann hatten sie ihre Hemmungen überwunden, und als Toby hereinspaziert kam, konnte ihm kein betrüblicher Gedanken mehr kommen, dass zwischen Mami und Papi etwas nicht stimmen könne.
Er freute sich, dass sie die Mami schon am Sonntagvormittag besuchen wollten und dass sie dann schon ein bisschen aufstehen könne, und als Behnisch ihn zu Biels zurückgebracht hatte, war er ganz zufrieden. Bert aber fuhr zu seiner Mutter, da es doch noch einiges zu klären gab. Jetzt, nachdem er sich mit Birgit endlich ausgesprochen hatte, fühlte er sich bedeutend wohler.
Adelheid Blohm spielte weiterhin die tief Gekränkte, aber sie versuchte es heute noch einmal mit ihrem herrischen Ton.
»Ich denke, dass es an der Zeit ist, dass du dich deiner Verpflichtungen deiner Mutter gegenüber erinnerst, Bert«, begann sie. »Es ist unbegreiflich, dass du mich solchen Peinlichkeiten aussetzt.«
»Welchen Peinlichkeiten?«, fragte er ruhig.
»Meinst du, die Leute klatschen nicht über uns? Ich wage mich kaum noch auf die Straße.«
»Mich interessiert der Klatsch nicht. Und darüber will ich mich mit dir auch gar nicht unterhalten. Ich werde meine Versetzung ins Zweigwerk beantragen und wollte dich davon informieren, damit du dich später nicht darüber beklagst, vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein.«
»Und welche Entscheidung hat Birgit getroffen?«, fragte sie lauernd. »Wird sie sich scheiden lassen?«
»Nein, sie wird ein paar Wochen mit Toby verreisen, bis ich alles geregelt und einen Wohnsitz für uns gefunden habe.«
»Wohin fahren sie denn?«, fragte seine Mutter neugierig.
»Das dürfte für dich kaum von Interesse sein. Ich möchte dich sehr ernsthaft ersuchen, keinen Versuch zu unternehmen, Birgit umzustimmen. Erstens wäre das zwecklos und würde unsere Entscheidungen nicht beeinflussen, zum andern wird Birgit ohnehin noch Zeit brauchen, um alles zu überwinden, was ihr zugefügt worden ist.«
»Man kann natürlich auch alles aufbauschen«, sagte Adelheid Blohm herausfordernd, »aber du hast mich ja schon zum alleinigen Sündenbock gestempelt.«
»Wenn du doch nur ein bisschen einsichtig wärst«, erwiderte Bert. »Mir wäre es hundertmal lieber, wir hätten harmonisch unter einem Dach leben können, aber das war eine Illusion. Bei anderen Familien ist es doch auch möglich.«
»Da werden die Jungen die Eltern auch respektieren«, meinte sie aggressiv.
»Respekt und noch mal Respekt, Verpflichtung, Ehrfurcht vor dem Alter, das habe ich zu oft zu hören bekommen. Du bist noch nicht alt, Mutter. Andere Frauen in deinen Jahren sind noch berufstätig, stehen mitten im Leben, zeigen Liebe und Verständnis für ihre Kinder, aber du verlangst nur Respekt.«
»Und du verlangst anscheinend von mir, dass ich mir noch eine Stellung suche«, brauste sie auf.
Er stöhnte in sich hinein. Sie konnte einem tatsächlich immer das Wort im Munde verdrehen.
»Das habe ich mein Leben lang nicht nötig gehabt«, sagte sie herablassend. »Ich bin gespannt, was du mir noch alles vorhalten wirst.«
»Gar nichts«, antwortete Bert müde. »Es ist doch vergeblich, dir klarzumachen, dass deine Einstellung zu meiner Frau ein Zusammenleben unmöglich macht. Ich hatte nur die Hoffnung, dass du inzwischen zur Einsicht gekommen sein würdest, damit wir nicht im Groll auseinandergehen.«
»Ich habe dich nicht aus dem Hause getrieben, du bist von selbst gegangen«, warf sie ihm vor.
»Du weißt genau, warum ich das getan habe. Wir haben jetzt noch einige finanzielle Dinge zu regeln, Mutter, oder ziehst du es vor, sie über den Anwalt abzuwickeln?«
Es folgte eine schlimme Stunde für Bert, die ihm erschreckend klarmachte, wie besessen seine Mutter von ihrem Egoismus und ihrer Überheblichkeit war.
Als sie ihm dann aber auch noch vorwarf, wie viel Zeit und Kraft sie für Toby vergeudet hätte, langte es ihm.
»Ich gehe jetzt«, sagte er. »Aber ich möchte dir noch sagen, dass ich dir gewisse Peinlichkeiten, wie du es zu bezeichnen pflegst, nicht ersparen werde.« Und dann ging er auch sofort.
*
So ganz anders ging es bei den Holzmanns zu. Da überlegten die Eltern schon, welche Spezialisten man hinzuziehen könnte, um Penny zu viel Mühsal zu ersparen.
Dirk zeigte sich jetzt jedoch schon zuversichtlich.
»Dr. Behnisch sagt, dass Penny ein Stehaufmädchen ist, und ich habe volles Vertrauen zu ihm. Warten wir die nächsten drei Wochen ab. Am Montag wird der Kopfverband gewechselt.«
Renate Holzmanns Gesicht überschattete sich. Dirk legte seinen Arm um sie.
»Ich liebe Penny als Ganzes, Mutti, ihr Wesen, nicht ihr Gesicht, und in ihrem Wesen hat sie sich nicht verändert. Sie ist so tapfer, da werden wir doch nicht verzagen.«
Frau Holzmann wollte bleiben, um Tim zu betreuen. Walter Holzmann musste allerdings mit Beginn der Woche wieder in sein Büro zurück. Für ihn war es das erste Mal in seiner langen Ehe, dass er sich allein zurechtfinden sollte. Ein bisschen mulmig wurde es ihm schon bei dem Gedanken, aber Penny sollte ihren Tim ja täglich sehen, sonst hätten sie ihn einfach mitgenommen.
Aber auch in dieser Beziehung zeigte Penny, wie tapfer und vernünftig sie war, denn sie wollte gar nichts davon wissen, dass ihr Schwiegervater allein blieb. Als beim Sonntagsbesuch die Rede darauf kam, schüttelte sie leicht den Kopf.
»Es wäre doch besser, wenn ihr Tim mitnehmen würdet«, sagte sie. »Die reine Freude ist es nicht für ihn, hier an meinem Bett zu sitzen. Bei euch ist er gut aufgehoben, das weiß ich.« Und zu Dirk sagte sie später leise: »Wer weiß, wie ich unter den Verbänden aussehe. Tim soll doch keine Angst vor mir bekommen.«
»Aber Liebes«, murmelte Dirk bewegt und küsste sie zärtlich.
»Ich mache mir keine Illusionen, Dirk. Ich habe auch Angst.«
»Ich liebe dich. Ich habe keine Angst. Es wird halt ein bisschen dauern, bis das Haar wieder gewachsen ist.«
Ja, wenn es nur um das schöne Haar gegangen wäre, das ihr keckes Gesichtchen so anmutig umschmiegt hatte, aber seine kleine Penny würde noch viele, viele Wochen brauchen, um wieder auf eigenen Füßen stehen und gehen zu können, darüber machte er sich wahrhaftig auch keine Illusionen.
Sie trafen dann die Entscheidung, dass Tim mit seinen Großeltern fahren und eine Woche dort bleiben sollte. Dann wollte Renate mit ihrem Enkel wieder in der nächsten Woche nach München kommen und dort bleiben.
»Mami dann kein Wehweh mehr hat?«, fragte Tim.
Ihm war das unbegreiflich, dass sie so lange im Bett liegen musste. Er hatte ja noch nie erlebt, dass seine Mami auch nur einen Tag krank gewesen wäre. Und Penny hatte früher immer gesagt, dass es das Schlimmste für sie wäre, durch eine Krankheit ans Bett gefesselt zu sein. Nun lernte sie es und ertrug es mit bewundernswerter Geduld, um deretwillen sie von allen Schwestern geliebt wurde.
In der Behnisch-Klinik herrschte Sonntagsstimmung. Alle Patienten hatten Besuch, keiner klagte über irgendwelche Beschwerden. Jenny und Dieter hatten Zeit für ein gemütliches Kaffeestündchen.
»Am fünfzehnten Juli fängt Dr. Dahm an«, sagte Dieter plötzlich, in seinem Kaffee rührend.
»Seit wann nimmst du drei Stück Zucker?«, fragte Jenny.
»Wieso?«, fragte er irritiert zurück.
»Weil du drei genommen hast«, erwiderte sie neckend.
»Erste Anzeichen fortschreitender Verkalkung«, erwiderte er spottend.
»Liebe Güte, da müssen wir aber gleich was unternehmen«, entgegnete Jenny.
»Werden wir auch. Dahm fängt am fünfzehnten Juli an.«
»Das hast du eben schon gesagt«, fiel sie ihm ins Wort.
»Würdest du mich bitte nicht dauernd unterbrechen. Du bringst mich ganz aus dem Konzept. Vierzehn Tage kann er sich einarbeiten und dann wird geheiratet.«
Jenny hob die Augenbrauen. »Kann er nicht vorher heiraten?«, fragte sie.
»Ich rede nicht von Dahm, ich rede von uns. Mama mia, tu doch nicht so, als wärst du schwer von Begriff. Wir müssen doch etwas gegen meine fortschreitende Verkalkung tun.«
»Du spinnst ganz schön«, sagte Jenny, »aber du bist lieb.«
»Dann bist du einverstanden?«, fragte Dieter.
»Wollen wir nicht erst den Juli abwarten?«, fragte sie lachend.
»Wir müssen das Aufgebot bestellen.«
»Vierzehn Tage vorher«, entgegnete sie nebenbei.
Er hielt ihre Hand fest und zog sie zu sich heran. »Wir haben so wenig Zeit füreinander, Jenny«, sagte er jetzt leise.
»Das wird sich auch nicht ändern, wenn wir verheiratet sind, Dieter.«
»Wir wollen uns doch Kinder anschaffen, und dann wirst du auch nur noch Ehefrau und Mutter sein wie Fee.«
»Wir wollen mal nicht zu weit in die Zukunft denken. Arztfrau bleibe ich dann doch, genau wie Fee, und wie deren Los aussieht, wissen wir ja.«
»Aber jede Stunde, die wir für uns haben, werden wir genießen. Es wird immer etwas Besonderes sein.«
Jenny küsste ihn auf die Stirn. »Das ist doch jetzt auch schon so«, sagte sie weich, und dann fanden sich ihre Lippen zu einem langen Kuss.
*
Lenchen stellte fünf Gedecke auf den Kaffeetisch.
»Sechs«, sagte Fee und holte noch eines.
»Wieso sechs?«, fragte Lenchen.
»Wir bekommen Besuch, hab ich das nicht schon gesagt?«
»Zwei Personen?«, fragte Lenchen.
»Nein, nur Frau von Dehlen.«
»Dann stimmt es doch«, meinte Lenchen.
»Und dich zählst du nicht mit?«, fragte Fee, die nun schon wusste, worauf es mal wieder hinausging.
»Wenn Besuch kommt, setze ich mich nicht an den Tisch«, sagte Lenchen. »Und wenn eine Frau ›von‹, dann schon gar nicht.«
»Mach nicht immer solche Sperenzchen«, sagte Fee lächelnd.
Sie hatte doch Frau von Dehlen so gern kennenlernen wollen, bevor diese mit zur Insel fuhr, und deshalb hatte sie Daniel gebeten, die alte Dame schon etwas früher abzuholen, damit sie noch mit ihnen Kaffee trinken könne. Sie meinte auch, dass es so besser wäre.
Lenchen hatte ihre Marotten. Sie war Fremden gegenüber immer misstrauisch, aber Fee hatte ihre eigene Methode, Lenchen nachgiebig zu stimmen.
»Wenn du nicht mit uns Kaffee trinkst, gehe ich heute abend mit Daniel aus und dann essen wir auch außerhalb«, erklärte sie.
Und das, wo sie doch genau wusste, dass Lenchen Hühnerbrüstchen vorbereitet hatte, die Fee besonders gern mochte mit der köstlichen Soße, die nur Lenchen zubereiten konnte.
Nun, Lenchen hatte Hemmungen, aber Frau von Dehlen nicht weniger, doch bei beiden legten sich diese bei dem herzlichen Ton, der in der Kaffeerunde herrschte.
Auf dem Tisch stand der silberne Leuchter. Fee hatte zwar überlegt, ob sie ihn so in den Blickpunkt rücken solle, aber sie war dann einer inneren Stimme gefolgt. Und sie hatte recht daran getan, denn als der Aufbruch kam, sagte Frau von Dehlen mit einem Blick auf den Leuchter: »Wie schön ist es, wenn man weiß, dass die Dinge, die man liebte, geschätzt werden und den richtigen Platz finden.«
»Er ist wunderschön, Frau von Dehlen«, erwiderte Fee.
»Für mich ist es wunderschön, glückliche Menschen kennenzulernen und auch die Insel der Hoffnung. Ich danke Ihnen allen von Herzen.«
Eine Überraschung erlebten sie noch, als Frau von Dehlens Gepäck aus Daniels in Dr. Cornelius’ Wagen umgeladen wurde. Ein bisschen hatte sich Daniel ja gewundert, dass die alte Dame gleich drei Koffer mitnahm, aber er hatte sich gedacht, dass sie sich wohl von einigen Stücken einfach nicht trennen wollte.
Nun sagte sie zu ihm, dass er den großen Metallkoffer doch bitte an sich nehmen und für seine Frau aufheben sollte. Es sei nur etwas für das Kindchen darin.
Daniel war sprachlos, aber ein Widerspruch hatte ihm gar nichts genützt. Frau von Dehlen stieg schon in den anderen Wagen ein. Und da stand er nun neben diesem gewichtigen Koffer und blickte dem davonfahrenden Wagen nach.
Währenddessen hatte Lenchen Fee gegenüber schon erklärt, welch eine vornehme Dame Frau von Dehlen sei.
»Aber erst meckern«, wurde sie von Fee geneckt.
»Das ist kein Meckern. Ich habe meine Grundsätze«, erklärte Lenchen.
»Die bei gegebenem Anlass ruhig mal umgestoßen werden können«, meinte Fee, aber als Daniel dann den Koffer hereinschleppte und ihr erklärte, wofür Frau von Dehlen ihn bestimmt hätte, schüttelte sie den Kopf.
»Was mag sie sich dabei nur denken«, sagte sie verwirrt.
»Weiß der Himmel«, seufzte Daniel. »Sie ist so sanft und hilflos, und in solchen Dingen kommt man nicht gegen sie an. Was sollte ich denn machen, Fee? Sie stieg ein, winkte mir zu, und weg waren sie schon. Und ich habe schon wunder gedacht, was sie da auf die Insel mitschleppen will und wie wir den Riesenkoffer in dem Wagen verstauen könnten, wo Anne doch die halbe Stadt ausgeplündert hat. Ich möchte nur wissen, was sie alles eingekauft hat.«
»Vielleicht die Aussteuer für Katja«, meinte Fee.
»Liebe Güte, sie werden doch wohl nicht mal mit dem Wohnwagen herumziehen.«
»Weiß man es? Hoffentlich sitzt Frau von Dehlen bequem.«
»Sei besorgt, die Unbequemlichkeit auf dem Rücksitz hat Anne selbst in Kauf genommen. Da hat sie auch keinen Widerspruch geduldet … Was soll ich nun mit dem Koffer machen, Fee?«
»Ins Kinderzimmer stellen. Es wird sich ja hoffentlich eine Gelegenheit ergeben, noch mal ein ernstes Wörtchen mit Frau von Dehlen zu sprechen. Sie ist rührend, und man kann sich doch sehr gut vorstellen, wie sie einmal Honneurs gemacht hat, eine große Dame in hochherrschaftlicher Umgebung. Schau mich nicht so an, ich meine das keineswegs ironisch. Ich kann sie mir sehr gut vorstellen.«
Diese Zeit lag aber schon so lange zurück, dass sich Charlotte von Dehlen selbst nicht mehr richtig daran erinnern konnte, auch nicht erinnen wollte. Sie fuhr jetzt, wie ein beschenktes Kind neben Dr. Cornelius sitzend, der Insel entgegen, die sich ihnen in traumhaft abendlicher Stimmung darbot.
Ein bisschen Freude hatte Daniel Norden ihr noch bereiten wollen, um das auszugleichen, was andere ihr Übles zugefügt hatten. Er ahnte nicht, wie viel Glück er dieser alten Dame gab, und wie viel Glück sie selbst dadurch empfangen sollten, nach der uralten Weisheit: »Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.«
*
In der Behnisch-Klinik begann der erste Tag der Woche damit, dass Birgits Kopfverband abgenommen und Pennys gewechselt wurde.
Birgits Platzwunden waren gut verheilt. Was geblieben war, wurde von dem herabfallenden Haar verdeckt.
Wenn es bei Penny nur auch so sein würde, doch an sie ging Jenny mit Zittern und Zagen heran. Und dennoch war es nicht so schlimm, wie sie gefürchtet hatte. Ihr Seufzer klang so erleichtert, dass Penny sie mit großen Augen anschaute.
»Geht es eingermaßen?«, fragte sie, und ihre Stimme bebte nur ein ganz klein bisschen. »Ist alles noch an seinem Platz?«
Jenny nahm Zuflucht zum Humor. »Sie sehen aus wie ein kleiner Junge, der eben eine Rauferei hinter sich hat«, sagte sie.
»Darf ich mal in den Spiegel schauen?«, fragte Penny.
Jenny zögerte einen Augenblick.
»Bitte, Frau Dr. Lenz«, bat Penny. »Eitel bin ich nicht, nie gewesen. Und ich sage mir immer wieder, dass ich noch ganz gut davongekommen bin. Für meinen Mann ist das auch das Wichtigste.«
Ja, davon war Jenny Lenz überzeugt. Dirk Holzmann hatte das längst unter Beweis gestellt.
»Dann schauen Penny und Jenny mal gemeinsam in den Spiegel«, antwortete sie.
»Sie heißen Jenny, das ist lustig«, sagte Penny, und allein das Lächeln, das ihre wunderschönen Zähne entblößte, verwischte das andere, was nicht so erfreulich war.
Penny zeigte sich sehr gefasst, als sie in den Spiegel blickte. »Bei Männern sind Schmisse ja interessant«, meinte sie skeptisch.
»Das wird noch korrigiert«, erklärte Jenny schnell. »Man kann heutzutage auf diesem Gebiet wahre Wunder vollbringen.«
»Ich möchte aber die Penny bleiben, die Dirk mag«, entgegnete sie leise. »Ich müsste wohl richtiger sagen, ich möchte sie wieder werden.«
»Sie sind sie geblieben, Penny Holzmann«, sagte Jenny mit fast mütterlicher Zärtlichkeit. »Optimistisch und tapfer.«
»Timmy wird schon ein bisschen kritisch schauen«, bemerkte Penny nachdenklich.
»Kinder reagieren ganz anders, als man allgemein annimmt. Tim war der Verband fremd, aber die paar kleinen Narben wird er übersehen, wenn Sie mit ihm lachen.«
»Sie verstehen es zu trösten«, murmelte Penny leise. »Aber wie wird es ausschauen, wenn die Gipsverbände herunter sind, Jenny Lenz?«
»Ein bisschen dünn, glaube ich«, erwiderte Jenny im gleichen Ton. »Aber das werden Sie auch schnell aufholen. Sie haben gesundes Blut, das haben wir nachgewiesen.«
»Und ein dickes baltisches Fell. Mein Vater war nämlich Balte. Das ist ein robuster Menschenschlag.« Penny lächelte zaghaft.
Sie macht sich selber Mut, dachte Jenny. Wie gut das ist. Wer sich aufgibt, ist schon halb verloren. Penny Holzmann gibt bestimmt nicht auf. Sie wird aus jedem Dilemma einen Weg finden. Vor genau acht Tagen hatte man ihr kaum noch eine Chance gegeben, und nun zeigte sie schon wieder Humor. Dabei konnte man sie wahrhaftig nicht robust nennen und von einem dicken Fell konnte schon gar nicht die Rede sein, aber viel innere Kraft und sehr viel Glauben steckten in dieser kleinen Frau.
»Ich würde mich ja viel wohler fühlen, wenn ich mal richtig baden könnte«, meinte Penny jetzt. »Das Schlimmste ist, dass ich so gar nichts selbst tun kann.«
Ja, das war für das früher so quicklebendige Geschöpf eine harte Geduldsprobe, und da konnte eine Woche schon unendlich lang werden, besonders jetzt, da ihr Geist schon wieder so rege war.
Aber beim Gesicht konnte man mit der Heilbehandlung schon anfangen. Dabei verging nicht nur die Zeit, sondern es war auch belebend und wohltuend. Danach war Penny entspannt und so richtig schön müde geworden, und sie schlief, bis Dirk kam, so fest, dass sie gar nicht hörte, dass er eintrat!
Ganz leise ließ er sich an ihrem Bett nieder, betrachtete ihr kleines Gesicht, von dem man nun schon ein bisschen mehr sehen konnte.
Seine geliebte kleine Penny, immer vergnügt war sie gewesen, niemals launisch. Was hatten sie nur für Spaß miteinander gehabt. Sie konnte sich über alles freuen wie ein Kind. Und wenn er sich manchmal tagsüber noch so ärgern musste, wenn er heimkam, war das vorbei. Sie zauberte alle Sorgen einfach weg. Wie sehr sehnte er sich danach, sie in seine Arme nehmen zu können.
Plötzlich schlug sie die Augen auf, diese großen, klaren grauen Augen, die keine Gefühlsregung verbergen konnten.
»Liebster Dirk«, flüsterte sie, »wie kann ich nur schlafen, wenn du bei mir bist?«
»Ich bin gerade erst gekommen, mein Allerliebstes.« Er küsste sie zärtlich auf die Nasenspitze, dann auf die weichen Lippen. »Siehst ja schon ganz manierlich aus, mein Spatz.«
»Na, weißt du, begeistert bin ich nicht gerade«, meinte sie.
»In einer Woche wird es noch viel besser aussehen.«
»Wenn eine Woche doch nicht so endlos lang wäre«, klagte sie gedankenvoll. »Früher ist uns die Zeit immer so schnell vergangen.«
Früher! Als wäre es schon ewig her. Dirk musste sich höllisch zusammennehmen, um seinen Kummer nicht zu zeigen.
»Dr. Behnisch sagt, dass du ein Naturwunder bist. Also wirst du auch viel schneller wieder heimkommen, als jeder annimmt.«
»Wirst du mich noch so mögen wie früher?«, fragte Penny.
»Kannst du daran überhaupt zweifeln, mein Kleines? Ich liebe dich, Penny. Ich habe dich vom ersten Augenblick an geliebt, aber erst jetzt weiß ich, wie sehr ich die liebe. Unser Haus ist so leer ohne dich.« Und wie leer wäre erst mein Leben ohne sie, dachte er.
»Was macht Tim?«, fragte Penny.
»Dem geht es gut. Er wird natürlich sträflich verwöhnt.«
»Er würde mich nicht vermissen«, sagte Penny leise.
»Das darfst du nicht sagen, Liebling.«
»Warum nicht. Es liegt in der Natur eines Kindes. Je jünger es ist, desto weniger bleibt in der Erinnerung haften. Wenn man so daliegen muss und nichts tun kann, denkt man über vieles nach, worüber man sich früher überhaupt keine Gedanken gemacht hat.«
»Ich denke bestimmt auch viel nach, Penny. Ich frage mich, warum das eigentlich sein musste. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich damals nicht den Umweg gemacht habe.«
»Das darfst du nicht. Es war mein Wille, dass wir mit dem Zug fuhren. Es war mir so bestimmt, Dirk. Es war alles zu heiter. Ich wäre wohl übermütig geworden. Das war ich schon.«
»Da muss ich aber widersprechen. Du bist mit den Füßen immer auf dem Boden geblieben.
»Aber mit den Gedanken schwebte ich in himmlischen Gefilden. Ich habe nie daran gedacht, dass uns etwas trennen könnte.«
»Uns wird nie etwas trennen, Penny«, sagte Dirk zärtlich.
»Wenn ich nun nicht mehr leben würde …«, aber sie konnte nicht weitersprechen. Seine Lippen legten sich ganz fest auf ihren Mund.
»Du sollst es nicht denken und nicht sagen, mein Liebstes«, flüsterte er heiser.
»Aber mit den Realitäten wirst du dich auch abfinden müssen, Dirk«, sagte Penny ernsthaft. »Vielleicht kann ich nicht mehr gehen, was wird dann?«
»Dann werde ich dich tragen. Schluss jetzt mit solchen Überlegungen. Dr. Behnisch hat gesagt, dass du die Tapferkeitsmedaille verdienst und dass du zäh bis wie eine Katze.«
»Na ja«, sagte Penny mit einem Lächeln, »eigentlich habe ich mir mein Gesicht auch schlimmer vorgestellt. Die Sommersprossen sind mir auch geblieben.«
»Gott sei Dank. Deine freche kleine Nase wäre sonst nur halb so hübsch.«
»Es wäre überhaupt viel schlimmer, wenn Timmi etwas geschehen wäre. Es wird mir nur ewig unbegreiflich bleiben, dass wir nicht beisammen waren, aber es ist wohl von der Vorsehung so bestimmt gewesen.«
Bis heute wusste Penny noch nicht, welche Ängste sie um Tim ausgestanden und wie lange sie ihn gesucht hatten, bis sie ihn hier lebend gefunden hatten. Und auch ihnen würde es ewig ein Rätsel bleiben, wieso er in der Nähe von Birgit Blohm gelegen hatte, die doch im Bus gefahren war und nicht im Zug.
*
Birgit machte an diesem Nachmittag schon einen kurzen Spaziergang mit Toby im Klinikpark. Sie fühlte sich zwar noch ein bisschen schwach, aber das rührte nicht von den Verletzungen her, sondern war noch eine Folge der schweren Wochen, die dem Unglück vorangegangen waren.
In ein paar Tagen sollte sie nun wieder in ein Sanatorium gehen, aber diesmal konnte sie ihren Jungen mitnehmen. Und was Dr. Behnisch ihr von der Insel der Hoffnung erzählt hatte, konnte keine angstvollen Gedanken in ihr wecken.
Frei von Depressionen war sie noch immer nicht. Insgeheim fürchtete sie, dass ihre Schwiegermutter irgendwann in der Tür stehen könnte, und deshalb wollte sie weg, so schnell und so weit wie nur möglich.
Würde die Insel der Hoffnung weit genug entfernt sein von hier, damit sie eine Begegnung mit Dirks Mutter nicht zu fürchten brauchte?
Unwillkürlich umklammerte sie Tobys Hand so fest, dass der Junge sie ganz bestürzt ansah.
»Was hast du denn, Mami?«, fragte er. »Ich laufe doch nicht weg.«
»Wir werden uns nie mehr trennen, Toby«, flüsterte sie.
»Wir fahren doch zusammen weg und ziehen dann in eine ganz andere Stadt, ganz weit weg von hier. Da kann Großmama nicht einfach hinkommen.«
»Warst du wieder mal bei ihr, Toby?«, fragte Birgit.
»Nein, will ich auch nicht, aber Papi will’s auch nicht. In unserm Haus wäre ich aber ganz gern geblieben. Wer weiß, ob wir wieder so einen schönen Garten bekommen. Wir hatten doch so viel Blümchen gepflanzt, Mami. Du und ich, und nun gießt Großmama sie nicht mal.«
»Wir werden einen Garten bekommen und viele Blumen anpflanzen, Toby«, sagte Birgit. »Noch viel mehr als früher. Du bist nun ein großer Junge und hilfst mir, ja?«
»Jetzt verstehe ich es auch schon besser«, nickte er. »Aber wenn wir nun nur eine Wohnung bekommen und bloß einen Balkon?«
Wie viel Geld ist mir noch geblieben, überlegte Birgit. Sie wusste es nicht genau. Sie hatte darüber mit Dr. Biel noch nicht gesprochen, weil es für sie beschlossen gewesen war, dass der Rest von ihrem Erbe für Toby bleiben sollte und die anderen Kinder, die sie sich noch gewünscht hatte.
Toby wünschte sich ein Haus mit einem Garten, und sie wünschte sich jetzt keine weiteren Kinder mehr. Der Gedanke, nochmals eine solche Zeit mitzumachen, sich umsonst zu freuen, peinigte sie.
»Wir werden bestimmt ein Haus mit einem Garten bekommen, Toby«, sagte sie zuversichtlich.
»Aber unsere Möbel nehmen wir mit. Die lassen wir der Großmama nicht da«, sagte er eifrig. »Was macht sie dann mit den leeren Zimmern?«
Ein Frösteln kroch durch Birgits Körper. »Ich weiß es nicht, Toby. Ich will es auch gar nicht wissen«, erwiderte sie.
»Ich eigentlich auch nicht«, sagte er, »aber dass Papi nicht mit uns kommt, gefällt mir doch nicht.«
Vielleicht wird Bert doch rückfällig, dachte Birgit. Wir brauchen eine Bewährungszeit. Es muss jetzt sein, auch wenn es mir weh tut.
Ja, es tat ihr weh. Ihre Liebe zu Bert war unverändert, wenngleich diese Wandlung in ihrem Gefühlsleben sich vollzogen hatte. Er war der einzige Mann in ihrem Leben, er würde der einzige bleiben. Das hatte sie mit Penny Holzmann gemeinsam, so unterschiedlich ihre Charaktere auch waren.
Zwei junge Frauen, die sich nie in ihrem Leben begegnet waren, die nichts verband, als dass sie zur gleichen Stunde vom gleichen Unglück betroffen wurden, obgleich die eine in dem Bus, die andere im Zug saß, zwei junge Mütter, zwei Ehen, die keinerlei Parallelen aufwiesen. Zehn Tage hatten Penny Holzmann und Birgit Blohm nur durch ein paar Zimmer getrennt in der Behnisch-Klinik gelegen, als Birgit diese mit sehr zwiespältigen Empfindungen am Arm ihres Mannes verließ.
Für sie war der Klinikaufenthalt kurz gewesen, aber ihre Leidenszeit währte schon länger als die von Penny, wenn es auch eine seelische Leidenszeit war.
Toby hatte sich von Dr. Jenny Lenz und den Schwestern verabschiedet. Für ihn war der Tag ohne Schatten.
Es war ein warmer, sonniger Tag und auf der Insel der Hoffnung blühten die Rosen in zahlloser Fülle. Auf einer Bank saß Frau von Dehlen, und zu ihren Füßen spielte Mario mit einem Feuerwehrauto, das er von einem Patienten geschenkt bekommen hatte.
»Da ist ja noch ein Kind, Mami!«, rief Toby aus, als sie aus dem Wagen stiegen. »Es sind nicht nur erwachsene Leute hier.« Für ihn war die Welt ganz in Ordnung, und Mario ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass auch er sich über den neuen Spielgefährten freute.
»Du hast doch Kinder gern, Tante Charlotte?«, erkundigte er sich aber doch vorsichtshalber bei der alten Dame.
»Sehr gern, Mario.«
»Dann macht es dir nichts aus, dass noch ein Junge kommt? Er heißt Toby, das haben Mami und Papi mir schon gesagt.«
Mami und Papi, er sagte es mit einer Selbstverständlichkeit ohnegleichen, und für Charlotte von Dehlen gehörte es zu einem der vielen Wunder auf der Insel der Hoffnung, dass dieser kleine Waisenjunge in Dr. Cornelius und seiner Frau Anne Eltern gefunden hatte, wie sie liebevoller nicht sein konnten. Ihr Herz, das so viel gelitten hatte in langen schweren Jahren, war weit offen für all das Glück, das sie nun hier erleben durfte, das Kinderlachen einschloss, das sie so sehr vermisst hatte.
*
»Wäre ich doch damals hierhergekommen, Bert«, sagte Birgit sinnend, als sie ihren Rundgang um die Insel beendet hatten. Toby saß indessen schon mit Mario bei Kakao und Kuchen.
»Manches Paradies entdeckt man leider zu spät«, sagte Bert.
»Nicht zu spät«, flüsterte sie. »Nein, noch ist es nicht zu spät, Bert. Mir ist es, als wäre ich aus einem langen schweren Traum erwacht.«
Er blieb stehen und legte seine Arme um sie. »Und es wäre wunderschön, wenn du dich eines Tages nicht mehr an diesen langen schweren Traum erinnern würdest, Gitti.«
»Es wäre schön, wenn du hierbleiben könntest«, sagte sie gedankenvoll.
Glück durchströmte ihn, als ihre Arme sich um seinen Hals legten.
»In Gedanken werde ich immer bei euch sein, Gitti«, sagte er voller Zärtlichkeit. »Ich muss ein neues Heim für uns suchen, denn wir wollen uns doch eine Welt schaffen, die uns ganz allein gehört.«
»Toby möchte ein Haus mit einem Garten«, sagte Birgit. »Dr. Biel hat mir gesagt, dass noch vierzigtausend Mark auf meinem Konto sind. Es sollte ja für unsere Kinder bleiben, Bert, aber wenn es helfen kann, dass Tobys sehnlichster Wunsch erfüllt wird.« Sie machte eine kleine Pause. »Meinst du, ob es reichen würde für ein kleines Haus als Anzahlung?«
Er umschloss ihr Gesicht mit seinen Händen. »Ihr werdet ein Haus mit einem Garten bekommen, Gitti. Und wir werden viele, viele Blumen darin anpflanzen. Wenn wir beisammen bleiben, werden wir alles schaffen. Außerdem wird Mutter vorerst die Hälfte des Geldes zurückzahlen, das du ihr geliehen hast«, sagte Bert mit fester Stimme.
Das Blut stieg Birgit ins Gesicht. »Ich habe es nicht geliehen. Ich habe es ihr gegeben, weil wir doch auch in ihrem Hause wohnten.«
»Wir wollen einmal ganz offen darüber sprechen, Gitti. Es hat uns genug eingebrockt, dass wir schamhaft diesem Thema ausgewichen sind. Die Hälfte des Hauses gehört mir nach Recht und Gesetz, genauso, wie ich auch die Schulden mit übernehmen musste, die Vater hinterlassen hat. Was abgesehen von den Hypotheken zu begleichen war, habe ich inzwischen getan. Aber das war nur möglich, weil du immer mit deinem Geld geholfen hast, großzügig geholfen hast.«
»Wenn man verheiratet ist, gibt es kein mein oder dein«, widersprach Birgit. »Es geht jetzt auch nur darum, dass Toby nicht einen Garten vermissen muss.«
»Er wird ihn nicht zu vermissen brauchen, Gitti. Du hast mir viel zu vergeben.«
»Du mir auch. Ich war so verbittert, als mich deine Mutter von der Schwelle wies. Da hat es einen ganz großen Knacks bei mir gegeben, und nun bin ich eine andere geworden. Wenn du mich so auch jetzt noch liebhast, wird alles gut werden.«
»Ich weiß doch jetzt erst, wie sehr ich dich liebe und brauche, Gitti, das habe ich dir schon gesagt. Wir gehören zusammen, du, Toby und ich.« Sie versanken in einer langen, innigen Umarmung, sie küssten sich, wie sie sich lange nicht mehr geküsst hatten. Liebe konnte den Weg zum Himmel öffnen, eine Ehe ohne Liebe war die Hölle, aber es war ihnen auch bewusst geworden, dass Schweigen, auch wenn es dem andern zuliebe gewahrt wurde, eine Kluft erzeugen konnte.
*
Die folgenden Tage vergingen wie im Fluge. Toby und Mario waren bereits ein Herz und eine Seele, und durch die beiden Buben hatten auch Frau von Dehlen und Birgit sich angefreundet. Sie machten lange Spaziergänge, und es war erstaunlich, wie gut zu Fuß die alte Dame sich zeigte.
»Ja, wenn so die Großmama wäre«, meinte Toby nachdenklich, »dann würden wir gern mit ihr in einem Hause wohnen, gell, Mami?«
»Jeder Mensch hat seine Eigenheiten, Toby«, erwiderte Birgit darauf.
Sie wollte sich von den bösen Erinnerungen lösen, sie wollte keinen Hass in ihrem Innern wachsen lassen, sie wollte nichts zurückbehalten, was ihre Liebe zu Bert unnötig belasten könnte. Die Wand, die sie und ihre Schwiegermutter trennte, war ohnehin immer höher und unüberwindlich geworden.
Wie ein Keulenschlag traf es Bert indessen, wie voll Hass seine Mutter in ihrem Rachedurst war. Er machte sich überdies schreckliche Gedanken, weil seinem Gesuch auf Versetzung nun doch nicht stattgegeben worden war. Der Generaldirektor hatte ihm im Stammwerk eine leitende Stellung geboten, die so große finanzielle Vorteile mit sich brachte, dass er sie in der jetzigen Situation gar nicht ablehnen konnte. Nirgendwo hätte er einen gleichwertigen Posten bekommen, abgesehen davon, hätte er eine Ablehnung mit seinen familiären Konflikten begründen müssen, was ihm doch zu peinlich war.
An seinem Arbeitsplatz erreichte ihn daher eines Tages eine Vorladung zum Vormundschaftsgericht, für die er keine Erklärung hatte. Umso härter traf es ihn, als er dort erfuhr, dass seine Mutter den Antrag gestellt hatte, den Geisteszustand ihrer Schwiegertochter zu überprüfen. Dazu hatte sie Angaben gemacht, für die man bei aller Toleranz keine Entschuldigung finden konnte, so auch dass er, der Ehemann, erpresserisch unter Druck gesetzt würde.
Arglos hatte er auf der Behörde zuerst zugegeben, dass sich seine Frau in einem Sanatorium befände und Toby bei ihr sei.
Anscheinend besaß seine Mutter mehr Überzeugungskraft als er, denn als er erklärte, ob es nicht besser sei, sie von einem Psychiater untersuchen zu lassen, bekam er zu hören, dass es wohl der Wahrheit entspräche, dass er und seine Frau es darauf anlegten, seine Mutter auch noch um das Haus zu bringen.
Diesmal suchte Bert allerdings keine Aussprache. Er wandte sich an Dr. Biel. Er war jetzt nicht mehr bereit, Rücksicht zu nehmen. Aber er war nicht fähig, Birgit und Toby zu besuchen, wie er es versprochen hatte. Er machte die schlimmste Zeit seines Lebens durch. Er konnte nur Dr. Cornelius bitten, Birgit unter seinen Schutz zu nehmen. Bert aber fürchtete, dass alles, was nun wieder so schön zu keimen begonnen hatte, erneut zerstört würde.
Toby war bekümmert, dass sein Papi nicht kam, obgleich Birgit ihn damit tröstete, dass er mit der Haussuche sehr beschäftigt sei.
Aber auch sie wurde durch ein beklemmendes Gefühl bedrückt. Berts Stimme hatte so eigenartig deprimiert
geklungen, als er mit ihr telefonierte. Toby vergaß im Spiel mit Mario seinen Kummer schnell, Birgit dagegen hatte wieder einmal einen schweigsamen melancholischen Tag.
Wieder einmal überfiel sie die Angst, dass ihre Schwiegermutter hier auftauchen könnte, um sie zu demütigen.
Warum hatte sie vor dieser Frau eigentlich so viel Angst? Warum hatte sie nie gewagt, ihr die Stirn zu bieten? Nur, weil sie Berts Mutter war? Nur, weil sie sich immer wieder sagte, dass sie den Mann geboren hatte, den sie liebte und dessen Frau sie geworden war?
Und warum hatte sie jetzt noch immer Angst, obgleich sie sich doch mit Bert ausgesprochen hatte?
Plötzlich wusste sie es, als sie Toby betrachtete, ihren Sohn, den sie so sehr liebte. Die Bindung zwischen Mutter und Kind war die stärkste, die es überhaupt gab. Und was immer auch geschehen war, Bert war der Sohn seiner Mutter.
Solange sie lebte, würde sie zwischen ihnen stehen und sei es nur als Schatten. Aber damit würde sie sich nicht zufriedengeben. O nein, sie würde sich bestimmt immer wieder in Erinnerung bringen. Kinder waren gesetzlich dazu verpflichtet, für ihre Eltern zu sorgen, das wusste Birgit und daran erinnerte sie sich jetzt. Adelheid Blohm würde bestimmt einen Weg finden, ihren Sohn zu zwingen, für sie zu sorgen. Sie konnte ja nicht wissen, dass sie viel Schlimmeres im Schilde führte.
Doch der Volksmund sagte: »Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.« Adelheid Blohm begann es zu spüren.
Das sehr amtliche Schreiben von Dr. Biel mit Strafandrohnung wegen Verleumdung war nur der Anfang. Dann blieb die Zugehfrau weg mit der Erklärung, dass sie nur der jungen Frau zuliebe gekommen sei und gehofft habe, dass sie nun zurückkommen würde. Da der junge Herr jetzt aber auch ausgezogen sei, habe sie sich eine andere Stellung gesucht.
Die Nachbarn mieden sie schon seit einiger Zeit, aber jetzt trat es immer deutlicher zutage. Der Klatsch, den sie selbst erzeugt hatte, kam als Bumerang zurück. Und wie!
Schließlich wohnten sie zwanzig Jahre in diesem Viertel, und jeder kannte jeden. Dass Frau Blohm Haare auf den Zähnen hatte, wusste man ja längst, aber dass sie sich ihrer netten Schwiegertochter gegenüber so gemein benahm, war erst in letzter Zeit durchgesickert. Dafür hatte allerdings auch Frau Biel ein bisschen gesorgt. Wer wollte es ihr verübeln? Das Böse sollte nicht siegen.
Adelheid Blohm sah sich isoliert, aber die Schuld suchte sie bei den anderen. Und so sah sich Bert eines Abends seiner Mutter gegenüber. Sie hatte vor der Fabrik auf ihn gewartet. Neben seinem Wagen. Sie hatte lange ausgeharrt, denn er hatte an diesem Abend Überstunden gemacht.
»Du hast anscheinend vergessen, dass du eine Mutter hast, Bert«, begann sie. »Also muss ich dich wohl daran erinnern.«
Er sah sie mit einen Blick an, der sie erblassen ließ. »Du sorgst schon dafür, dass ich dich nicht vergesse, aber auch, dass ich mich sehr ungern daran erinnere«, erwiderte er.
»Du veranstaltest ein Kesseltreiben gegen mich«, warf sie ihm vor.
»Ich gegen dich?«, fragte er mit kühler Stimme. »Du verdrehst die Tatsachen. Du wirst es nicht verhindern, dass ich meine Frau verteidige. Ich bin nicht mehr der kleine Junge, der vor dir kuscht – und Respekt habe ich schon lange keinen mehr vor dir. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?«, fragte er zornig.
»Es ist dir hoffentlich klar, dass du mich ins Elend treibst, mich, deine Mutter.«
»Ins Elend? Du hast das Haus und deine Pension. Von Elend kann man da nicht reden. Wenn du doch endlich einsehen würdest, dass du alles selbst verschuldet hast.«
»Und wenn ich dich bitte, diese Differenzen beizulegen, Bert? Ich habe dich doch nicht aus dem Hause getrieben. Ich habe immer das Beste für dich gewollt, warum siehst du das nicht ein?«
»Das Beste in meinem Leben ist meine Frau, und ich werde ihr ewig dankbar sein, dass sie trotz allem, was sie durchmachen musste, zu mir hält. Was du getan hast, ist nicht mehr gutzumachen. Ich kann nichts anderes sagen, und ich werde nie etwas anderes denken. Birgit will das Geld nicht zurückhaben. Wir werden auch so zurechtkommen. Aber das Mindeste, was ich erwarten kann, ist doch wohl, dass du sie künftig in Ruhe lässt. Die ärztlichen Zeugnisse liegen dem Gericht vor. Sie sprechen gegen dich und vieles andere auch.«
»Bert, unsere Nachbarn behandeln mich wie eine Aussätzige. Ich kann dort nicht mehr leben«, jammerte sie.
»Dann musst du dir etwas anderes suchen. Ich könnte in diesem Haus auch nicht mehr leben. Ich kann dir nur den Vorschlag machen, dass es verkauft wird und dass du in eine Gegend ziehst, in der dich niemand kennt. Und nun sag bitte nicht wieder, dass man so mit seiner Mutter nicht spricht. Mit der Tatsache, ein Kind geboren zu haben, erwirbt man sich nicht für ein ganzes Leben das Recht, seinen Lebensweg zu bestimmen. Ich weiß jetzt, welchen Weg ich gehen muss, und ich kann nur hoffen, dass du auch einen findest, der dich von ungerechtem Hass entfernt.«
Sie sah ihn mit einem Blick an, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Welten trennten sie. Es gab keine Verständigung mehr. Er war nicht mehr der gehorsame Sohn und so auch für sie ein Fremder. Aber wie es schien, konnte sie sich auch darüber hinwegsetzen.
»Vielleicht wirst du mich einmal brauchen«, sagte sie, »aber dann werde ich auch vor dir meine Tür verschließen. Ich werde dir beweisen, dass ich dich nicht brauche.«
Er sah, wie sie in ihrem Wagen davonfuhr. Er brauchte ein paar Minuten, bevor er den Zündschlüssel umdrehte und sich ebenfalls auf den Weg machte.
Nun war er in ihren Augen also der undankbare Sohn. Konnte er mit diesem belastenden Gedanken mit Birgit glücklich sein?
Wahre Liebe bedeutet, dass man keine Dankbarkeit erwartet und nicht um Verzeihung bitten muss. Liebe war Zuneigung, keine Forderung. Es war keine aufrichtige Liebe zwischen Mutter und Kind, wenn man sich gegenseitig Verpflichtungen auferlegte.
Bert atmete auf, er fühlte sich plötzlich frei. Er sah auf die Armbanduhr. Gleich sieben, du liebe Güte! Er hatte mit einem Makler einen Termin vereinbart, um ein Haus anzusehen. Ein Haus für Birgit und Toby, mit einem Garten, in dem sie viele Blumen pflanzen konnten. Vielleicht fand er heute das Haus, das alle seine Erwartungen erfüllte.
*
Für Dr. Daniel Norden hatte eine aufregende Zeit begonnen. Alles was sonst in seiner Praxis bisher geschehen war und noch geschah, war nichts gegen das, was er nun mitmachte, obgleich man gewiss nicht sagen konnte, dass Fee ihn in Atem hielt. Eher war es umgekehrt, denn fast jede Stunde rief er aus der Praxis in der Wohnung an, um sich zu erkundigen, wie es ihr ginge. Sie wagte sich schon fast nicht mehr vom Telefon fort, weil er gleich aus dem Häuschen geriet, wenn sie nicht mindestens nach dem zweiten Läuten den Hörer abnahm.
Fee meinte, dass es eigentlich besser wäre, sie würde in der Praxis sein, aber das wollte er nun auch wieder nicht, weil er Angst hatte, sie könne sich irgendeine Infektion zuziehen.
Fee hatte es nicht leicht mit ihrem Mann, aber sie nahm es mit Humor. Auf die Straße durfte sie sich auch nicht mehr wagen, aber sie genoss das schöne Sommerwetter auf der Dachterrasse.
Die letzte Woche bis zum Geburtstermin war angebrochen. Jede Stunde brachte sie nun diesem großen, für sie so wunderbaren Ereignis näher.
Vor zwei Tagen hatte Daniel sie zur letzten Kontrolluntersuchung zu Dr. Leitner gebracht, der alles in Ordnung befunden hatte. Es war nicht zu übersehen, dass auch Schorsch voller Spannung war, denn das Kind seiner Freunde war schon etwas ganz Besonderes.
Für Fee war es ein beruhigender Gedanke, dass sie in der Klinik das Kind tagsüber bei sich im Zimmer behalten konnte. Allerdings nur, wenn sich die Besuche nicht häuften, das hatte Schorsch Leitner zur Bedingung gemacht. Und ihre Nachtruhe sollte wenigstens während der ersten acht Tage nicht gestört werden, hatte er energisch erklärt. Das würde später noch oft genug der Fall sein.
Wie würde es Daniel wohl hinnehmen, wenn das Kind nachts schrie? Er brauchte seine Nachtruhe schließlich. O ja, es würde schon eine gewaltige Umstellung für ihn werden.
Fee träumte in den blauen Himmel hinein, dann schlief sie ganz plötzlich ein und träumte weiter, bis das Telefon wieder läutete, aber das hörte sie erst bei fünften Mal, und dann richtete sie sich ein bisschen zu schnell auf.
Ein ganz seltsamer, unbekannter Schmerz durchzuckte sie. Der Arm, der sich mechanisch nach dem Telefon ausgestreckt hatte, sank hinab.
»Also, jetzt fahre ich mal schnell rauf in die Wohnung«, sagte Daniel unten in der Praxis zu Molly und war schon aus der Tür.
Sie lächelte nachsichtig und beruhigte einen Patienten, der sich besorgt erkundigte, ob der Herr Doktor länger fortbleiben würde.
Daniel stürmte indessen in die Wohnung und an Lenchen vorbei und rief nach Fee. Sie lehnte blass an der Terrassentür.
»Es geht jetzt doch nicht mehr so schnell«, sagte sie entschuldigend. »Reg dich doch nicht gleich immer so auf, Daniel.«
»Dir fehlt doch etwas, du bist so blass«, sagte er besorgt.
»Ich bin auf der Terrasse eingeschlafen, und dann war mir einfach ein bisschen schwummerig.«
»Hast du etwa in der Sonne gelegen?«, fragte er.
»I wo.« Es klang ziemlich gepresst und wieder durchzuckte sie das seltsame Gefühl.
»Es werden die Senkwehen sein«, sagte sie mit einem flüchtigen, gequälten Lächeln.
»Ich bringe dich in die Klinik«, erklärte Daniel.
»Schorsch lacht uns ja aus«, widersprach Fee.
»Das tut er nicht. Besser ist besser.« Er fasste nach ihrer Stirn. »Das ist ganz kalter Schweiß, Feelein. Komm, mein Liebes, sei brav.«
»Ich habe wohl bloß eine ungeschickte Bewegung gemacht«, versuchte sie Daniel zu beruhigen.
Sie konnte sagen, was sie wollte, es war zwecklos. In der Praxis mussten sie noch ziemlich lange auf den Doktor warten. Daniel ließ es sich nicht ausreden, seine Frau in die Klinik zu bringen, und das war gut so.
Schorsch kannte seinen Freund Daniel und sagte nur, dass er Fee auf jeden Fall erst mal in der Klinik lassen sollte, damit sie nochmals eine Ultraschalluntersuchung machen könnten.
»Du hast ja sicher noch Patienten in der Sprechstunde, Dan«, meinte er. »Ich rufe dich an, wenn du Fee wieder abholen kannst.«
Daniel sah seine Frau unglücklich an. »Du bist immer noch so blass, Liebling«, stellte er besorgt fest.
»Das Autofahren bekommt mir halt nicht mehr«, redete sich Fee heraus. »Lass die Patienten nicht warten, Liebster. Ich habe hier meinen Arzt.«
Er ging ungern, aber was blieb ihm übrig. Fee war ja in bester Obhut.
Dr. Leitner atmete auf, als Daniel draußen war. »Sag mal, Fee, wann sind die ersten Wehen gekommen?«, fragte er.
»Wehen? Das sind doch keine Wehen. Mach mir so was nicht weis, Schorsch.«
Er untersuchte sie sorgfältig. »Meine liebe Fee, nach meiner Schätzung wirst du spätestens in einer Stunde Mutter sein«, sagte er.
»Waaas? Mach mich nicht schwach, Schorsch.«
»Ich will dich stark machen dafür«, sagte er lächelnd, aber doch mit leicht erregter Stimme. »Du musst doch schon etwas gemerkt haben.«
»Das habe ich wohl verschlafen«, erklärte Fee. »Komisch.« Sie kicherte ein bisschen, aber es ging in leises Ächzen über. Aber nach ein paar Sekunden sprach sie lebhaft weiter. »Da hat man nun selbst Medizin studiert und weiß nicht mal, wie Wehen sind. Hoffentlich beeilt sich der Burschen, damit er da ist, wenn sein geplagter Papi kommt. Daniel regt sich so schrecklich auf.«
»Er weiß halt zu gut, dass man bei dir vor Überraschungen nicht sicher ist. Nun leg dich mal hin und renn nicht dauernd herum.«
»Aber Bewegung ist gut«, widersprach sie.
»Jetzt nicht mehr. Muss ich energisch werden?«
»Mit euch Männern hat man seine liebe Not«, sagte Fee. »Hast du nichts weiter zu tun, als bei mir Händchen zu halten?«
»Was meinst du, was ich von Daniel zu hören bekomme, wenn ich dich jetzt allein ließe.«
»Oje, oje!«, rief Fee plötzlich aus, und dann legte sie sich doch wieder nieder.
*
Daniel hatte gerade zum Telefon greifen wollen, um in der Frauenklinik anzurufen, als eine junge Mutter ihm ihren kleinen Buben brachte, der fürchterliches Nasenbluten hatte. Man konnte ihn nicht warten lassen.
»Rufen Sie doch mal an, Molly«, bat er.
»Wen?«, fragte sie, da sie es im Augenblick wirklich nicht wusste.
»Die Klinik«, erwiderte Daniel kurz.
»Lieber Gott, mein Bub muss doch nicht etwa in die Klinik?«, jammerte die junge Mutter.
»Nein, das kriegen wir schon wieder hin«, erwiderte Daniel tröstend.
Nach fünf Minuten war die Prozedur überstanden. Mutter und Sohn konnten wieder heimfahren. Molly saß mit verstörter Miene an ihrem Schreibtisch und hatte den Telefonhörer noch immer in der Hand.
»Was ist?«, fragte Daniel hastig.
»Die Geburt ist im Gange«, stammelte Molly.
»Waaas?«, rief er, genauso überrascht und gedehnt, wie Fee vorher, als Schorsch ihr die Eröffnung gemacht hatte. Ganz blass war er geworden! Und da sollte er seine Sprechstunde noch zu Ende führen?
Zum Glück waren nur noch zwei Patienten da, und solche, mit denen man sich nicht lange aufzuhalten brauchte, wenngleich sie beide sehr befremdet waren, in aller Eile abgefertigt zu werden. Daniel erklärte, dass er einen ganz dringenden Besuch machen müsse, und das entsprach ja auch der Wahrheit. Er konnte gar nicht schnell genug in die Klinik kommen. Es war genau siebzehn Uhr dreißig, und er ging im Eilschritt direkt auf den Kreißsaal zu, aber da kam die Hebammenschwester Rosi aus der Tür. Ein verschmitztes Lächeln glitt über ihr Gesicht.
»Erst den Kittel anziehen, Herr Doktor«, sagte sie rigoros.
»Wie weit ist es?«, fragt Daniel erregt.
»Das werden Sie schon sehen. Hier müssen Sie die Anordnungen auch befolgen. Bazillen dürfen nicht eingeschleppt werden.«
Das war eigentlich selbstverständlich, aber wenn man so aufgeregt war wie Daniel Norden, vergaß man auch das Selbstverständlichste.
Und als er dann alle Anordnungen der Schwester befolgt hatte und durch eine Schiebetür trat, vernahm er schon ein kräftiges Gebrüll.
Benommen blieb er stehen, hielt den Atem an und presste seine Hände aneinander.
»Herzlichen Glückwunsch zum Stammhalter, Dan«, hörte er Schorsch sagen, bevor er ihn überhaupt wahrgenommen hatte. Er sah nur, leicht verschwommen, Fees Gesicht, ein glückliches Gesicht, und er hörte ihr leises Lachen. Und dann kniete er auch schon an ihrem Bett nieder und bedeckte ihr Gesicht mit zärtlichen Küssen.
Sagen konnte er nichts. Kein Wort konnte ausdrücken, was er fühlte, als Schorsch ihn dann sacht zur Seite schob und Fee das Baby in den Arm legte. Ein winziges Köpfchen, bedeckt mit schwarzen flaumigen Haaren, sah er, und da er eben erst einen Dreijährigen versorgt hatte, kam ihm dieses Baby noch winziger vor, als es war.
Sein Kind, sein Sohn, der nicht etwa die Augen zusammengekniffen hatte, sondern weit aufriss.
Konnte man solch ein winziges Händchen überhaupt berühren? Fee tat es. Sie hatte ihr Kind im Arm, und die winzigen Finger des Kindes umschlossen schon ihren Zeigefinger.
Endlich fand Daniel die Sprache wieder. »Er hat sich die schönste Mutter der Welt ausgesucht«, sagte er innig. »Er konnte es nicht mehr erwarten, sie anzuschauen, wie mir scheint.«
»Er schaut dich an«, sagte Fee mit einem kleinen glucksenden Lachen. »Friedrich Johannes Daniel Norden, das ist dein Vater.«
»Nicht Daniel«, sagte er, »Felix.«
»Ich möchte zuerst meinen Danny haben«, erklärte Fee. »Als Ausgleich dafür, dass sein Papi so wenig Zeit für uns hat.«
»Hoffentlich wirst du überhaupt noch Zeit für mich haben, Feelein. Aber was rede ich. Wie geht es dir? Wie ist das so schnell gekommen?«
»Es war halt höchste Zeit, aber als rücksichtsvoller Sohn hat Danny sich sehr beeilt und gar keine Umstände gemacht.«
»Du hast eine Frau, Dan«, sagte Schorsch bewundernd.
»Ich weiß es zu schätzen. Aber jetzt sollte Fee wohl doch ein bisschen Ruhe haben.«
»Jetzt bekommt die tapfere Mami erst einmal ein Glas Sekt.«
»Und ihr trinkt dann die Flasche aus, wie ich euch kenne«, lächelte Fee.
»Und der Sohn kommt ins Bettchen«, warf Schwester Rosi ein, »sonst denkt er, dass er immer in Mamis Arm schlafen darf.«
Das schien dem kleinen Danny schon sehr viel besser gefallen zu haben, als nun ins Bettchen gelegt zu werden. Er begann sogleich zu protestieren. Aber ebenso schnell beruhigte er sich auch wieder.
Bevor der Sekt eingeschenkt wurde, nahm Daniel seine Fee noch einmal ganz zärtlich in die Arme. Jetzt hinderte ihn das Baby nicht daran.
»Du bist eine wunderbare Frau, Fee«, sagte er innig. »Ich hoffe, dass unser Sohn dir sehr ähnlich wird.«
»Ich hoffe, dass er dir sehr ähnlich wird«, lächelte sie zurück.
Und dann machte sich Schorsch mit einem diskreten Räuspern und einem leisen Gläserklingen bemerkbar.
»Ich möchte noch auf euer Wohl trinken, meine Lieben, dann muss ich wieder an die Arbeit, und ich ahne, dass die Geburt nicht so heiter verläuft.«
Fee lächelte.
»Ich habe unseren Sohn auch immer ermahnt, seinen Papi ja nicht zu lange in Atem zu halten, und wer wagt nun noch daran zu zweifeln, dass er ein braves Kind ist?«
Das stand außer Zweifel. Eine halbe Stunde später konnte Daniel seinen Blick zwischen seiner schlafenden Fee und einem schlafenden Sohn hin und her schweifen lassen, erfüllt von tiefem Glück und Dankbarkeit. So erfüllt, dass er fast vergessen hätte, die Freudenbotschaft zur Insel weiterzugeben und Molly und Lenchen zu verständigen.
*
Auch für Penny Holzmann war es ein ereignisreicher Tag gewesen, der sie in der Hoffnung bestärkte, früher in ihr Heim zurückkehren zu dürfen, als anzunehmen gewesen war. Die Arme, sie konnte sich schon für kurze Zeit im Bett aufsetzen.
Die Gesichtsbehandlung wirkte Wunder. Dr. Behnisch meinte allerdings auch, dass es ihr gesundes Blut sei, und im Übrigen hatten sie Penny ja nun schon als ein Energiebündel kennengelernt, der der eiserne Lebenswille mehr half, als alle ärztliche Kunst. Die wäre nur eine Unterstützung, äußerte sich Jenny Lenz zu Dirk Holzmann.
Aber es war auch seine Liebe, seine unermüdliche Geduld, die Penny half. Jede freie Minute verbrachte er an ihrem Bett.
So viel Geduld brachte der kleine Tim nicht auf, aber er hatte ja seine Großeltern, bei denen es ihm nicht langweilig wurde. Es war schon ein großer Trost für Penny, ihn in so guter Hut zu wissen. Tim entwickelte sich schnell. Er redete jetzt schon wie ein Buch. Er beschwerte sich auch, dass Tobys Mami schon so lange aus der Klinik entlassen worden war und seine immer noch hierbleiben musste.
Sosehr er sich mit Jenny Lenz und Dr. Behnisch angefreundet hatte, das machte er ihnen doch zum Vorwurf, aber niemals erfuhr er, wie sehr sie um das Leben seiner Mami gebangt hatten und wie glücklich sie waren, dass es für Penny ein Weiterleben gab.
Für Bert und Birgit Blohm hatte an dem Tage, als der kleine Daniel Norden geboren wurde, das neue Leben schon begonnen. Bert holte seine Frau und seinen Sohn von der Insel ab, und das Abschiednehmen hatte sich so lange hingezogen, dass sie gerade noch die Nachricht von der glücklichen Geburt erfuhren.
Tränen der Freude traten in Frau von Dehlens Augen, doch Toby schob diese auf den Abschiedsschmerz.
»Brauchst nicht weinen, Tante Charlotte«, sagte er. »Wir vergessen dich nicht und besuchen dich oft, und du besuchst uns auch, gell?«
Frau von Dehlen hatte hier herrliche Wochen verlebt, aber sie wusste tief in ihrem Innern sehr genau, dass sie nicht noch auf glückliche Jahre hoffen konnte. Diese Wochen waren ein kostbares Geschenk gewesen, doch Pläne für die Zukunft schmieden wie diese drei Menschen, die nun winkend davonfuhren, konnte sie nicht mehr.
Mit einem stillen, gedankenverlorenen Lächeln ging sie an Annes Seite ins Haus zurück.
»Sie werden sicher bald nach München fahren, um sich den kleinen Erdenbürger anzuschauen«, sagte sie leise. »Nehmen Sie bitte meine Grüße und Wünsche mit.«
»In vier Wochen werden Sie den Kleinen kennenlernen. Er wird hier getauft werden, Frau von Dehlen«, sagte Anne.
»In vier Wochen«, wiederholte die alte Dame, und ihr Blick wanderte zum Himmel empor. Anne wurde ganz eigenartig zumute. »Darf ich denn bleiben?«, fragte Frau von Dehlen.
»Solange Sie wollen«, erwiderte Anne herzlich.
*
Bert hielt vor einem hübschen Einfamilienhaus, das außerhalb der Stadt, inmitten eines Gartens, lag, in dem jetzt auch die Rosen blühten wie auf der Insel.
»Wie schön«, sagte Birgit.
»Toll, Papi«, echote Toby. »Das hast du fein gemacht.«
»Wenn es euch nur gefällt«, meinte Bert und nahm beide in die Arme. »Den letzten Schliff braucht es noch, aber du sollst ja alles so einrichten, wie du es dir wünschst, Gitti.«
Sie sah ihn lange an. Er wirkte älter und seine Züge härter, aber das verwischte sich mit dem Lächeln, mit dem er ihrem Blick begegnete.
Toby musste sich gleich den Garten anschauen. Birgit und Bert waren allein.
»Was macht jetzt deine Mutter, Bert?«, fragte Birgit leise.
»Das Haus wird verkauft. Sie will sich im Schwarzwald niederlassen«, erwiderte er knapp. »Sie ließ es mir durch den Anwalt mitteilen.«
»Verkehrt ihr nur noch über den Anwalt?«, fragte Birgit beklommen.
»Es gibt keinen anderen Weg, mein Liebes. Vielleicht kommt sie eines Tages zur Einsicht, wenn sie dazu nicht doch schon zu alt ist, aber eines ist ihr inzwischen doch klar geworden. Uns kann sie nicht auseinanderbringen, Gitti. Ich danke dir, dass wir nun unser neues Leben gemeinsam beginnen können.«
Sie schmiegte sich in seine Arme. Und vielleicht wird Toby doch nicht allein aufwachsen müssen, dachte sie. Auch diese Hoffnung wuchs in ihrem Herzen.
Jetzt wusste sie, dass sie sich liebten und darum würde ihnen auch dieser Schatten nichts anhaben.
»Es ist ein schöner Garten«, jauchzte Toby. »Da können wir noch ganz viele Blümchen pflanzen. Es ist auch ein ganz wunderschönes Haus, Papi, und wir bleiben jetzt immer beisammen, gell?«
Es war ein mühsamer Weg zu diesem Glück gewesen, doch sie wollten es bewahren.
Mühsam war auch der Weg, den Penny Holzmann gehen musste, bis zu ihrer Gesundung. Schritt für Schritt, umgeben und getragen von Liebe, fand sie zurück in das Leben, das sie so geliebt hatte, und das ihr zum zweiten Mal geschenkt worden war. Die Wunden verheilten, ein paar Narben würden bleiben und sie daran erinnern, wie grausam das Schicksal zuschlagen konnte. So unbeschwert wie früher konnte sie nicht mehr sein, aber lachen konnte sie jetzt schon wieder. Dafür sorgte Tim, der alles vergessen hatte, seit seine Mami wieder daheim war und jederzeit für ihn erreichbar.
Ein kleiner Wermutstropfen war auf Fees und Daniels Glück gefallen. Die gute Frau von Dehlen hatte vierzehn Tage nach Dannys Geburt ihre lieben Augen für immer geschlossen. Sanft war sie am Abend auf der Insel der Hoffnung eingeschlafen, und am Morgen war sie nicht mehr erwacht. Glücklich hätte sie ausgesehen, hatte Dr. Cornelius gesagt. Fee und Daniel hatten ihr gerade noch für das kostbare Geschenk danken können, das sie ihrem Kind gemacht hatte. Das Meißner Service stand jetzt in Fees Biedermeiervitrine. Danny wusste es noch nicht zu würdigen, und viele Jahre würden sie es verschlossen halten müssen, damit seine Kinderhändchen nichts zerbrachen.
Danny war prächtig gediehen und in der Zwischenzeit von der Familie und allen Freunden hinreichend bewundert worden.
Das schwerhörige Lenchen, das mit dem Hörgerät immer auf dem Kriegsfuß gestanden hatte, hatte damit plötzlich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Bei dem leisesten Ton flitzte sie schon ins Kinderzimmer, sodass Fee manchmal doch ihre trüben Betrachtungen anstellte, dass der Kleine maßlos verwöhnt werden würde. Auch von seinem Vater!
Für Fee war es das größte Erlebnis, als Daniel ganz von selbst verlangte, seinen Sohn auch einmal baden und wickeln zu dürfen. Sie war sprachlos gewesen, als er ihr das Kind einfach aus dem Arm nahm und sagte: »Heute bin ich mal an der Reihe.«
Ganz weit riss Danny seine Augen auf und vergaß sogar das Strampeln. Dafür stieß er drollige kleine Laute hervor.
»Na, siehst du, mein Sohn, jetzt können wir uns schon unterhalten«, sagte Daniel, und zu Fee gewandt fuhr er mit einem stolzen Lächeln fort: »Er akzeptiert mich.«
Alles Glück der Welt leuchtete in Fees Augen, und ihre Arme umfingen innig ihren Mann und ihr Kind.
– E N D E –