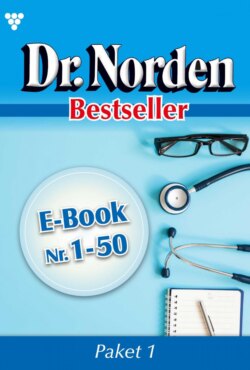Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 1 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDr. Daniel Norden war nicht abergläubisch, aber diesen Freitag, den Dreizehnten, würde er nicht so schnell vergessen.
Um fünf Uhr morgens hatte das Telefon ihn aus dem Schlaf gerissen. Eine aufgeregte Männerstimme redete auf ihn ein: »Herr Doktor, schnell, meine Frau, sie verblutet, o mein Gott, und das Kind …«
»Ihr Name«, sagte Dr. Norden, »so sagen Sie doch Ihren Namen, Mann.«
»Fichte, Lohenstraße sieben, ich war schon bei Ihnen.«
»Ich komme«, sagte Daniel Norden, und bevor seine Frau noch richtig begriffen hatte, war er schon in seinem Anzug und an der Tür.
»Fichte, Lohenstraße sieben«, rief er ihr zu. »Verständige die Klinik, Fee, für alle Fälle.«
Felicitas Norden war sofort hellwach. Bei einem Notfall konnte Daniel keine langen Erklärungen abgeben. Während sie sein Auto wegfahren hörte, rief sie schon die Behnisch-Klinik an.
Fichte, dachte Dr. Norden indessen. Lohenstraße. Ja, das war der Neubau, der vor vier Wochen bezogen worden war. Beim Einzug war einem jungen Mann die Hand gequetscht worden. Joachim Fichte hieß er. Jetzt konnte Dr. Norden sich erinnern.
Cellist war er, und eine gequetschte Hand konnte für ihn den Verlust der Existenz bedeuten. Nun, sie hatten die Hand wieder schön in Ordnung gebracht. Es war nicht so schlimm gewesen, wie es ausgesehen hatte. Was an diesem Morgen geschehen war, schien bedeutend schlimmer zu sein.
Dr. Norden war schnell am Ziel. Er läutete Sturm, stürzte in den Lift, dann durch eine offenstehende Tür, sah eine junge Frau im Bett in einer Blutlache liegen und darin ein noch nicht abgenabeltes Kind.
Die Frage zu stellen, warum Joachim Fichte nicht sofort die Ambulanz angerufen hatte, war müßig. Der Mann zitterte am ganzen Körper. Er war eines vernünftigen Gedankens wohl gar nicht fähig gewesen.
»Es ging alles so schnell«, stotterte er nur hilflos.
Zu schnell, zu unerwartet war die Geburt gekommen, aber das Kind lebte. Es gab klägliche Laute von sich. Dr. Norden nabelte es ab.
»Ein Handtuch«, sagte er im Befehlston. »Nerven behalten, Mann.« Er hüllte das Kind ein und legte es dem Mann in die Arme. »Halten Sie den Kopf nach unten. Tut mir leid, aber Sie müssen helfen.«
Jetzt ging es um das Leben der jungen Mutter, und Daniel konnte nur hoffen, dass Fee richtig begriffen und alles veranlasst hatte.
Er hörte schon eine Sirene und atmete auf. Auf Fee war Verlass. Im Unterbewusstsein empfand er Stolz. Seine Frau, ja, hundertprozentig konnte man auf sie bauen.
Bis die Sanitäter mit der Tragbahre kamen, hatte er der jungen Frau eine Injektion verabreicht. Ihr Puls ging schwach, aber solange ein Herz schlug, durfte, musste man hoffen. Dies hatte sich Dr. Norden zum Leitwort gemacht.
Die junge Frau wurde vorsichtig auf die Trage gelegt, das Baby daneben. Dr. Norden deckte beide warm zu.
»Sie können mit mir fahren, Herr Fichte«, sagte er, und es gelang ihm sogar, seiner Stimme einen beruhigenden Klang zu verleihen.
Der Chefarzt Dr. Leitner war eine Minute früher dagewesen. Auch auf ihn war Verlass. Dr. Norden war schon lange mit ihm befreundet, wie auch mit Dr. Behnisch, dem auch diese Gynäkologische Klinik gehörte. Er kam ebenfalls, weil Fee ihm ja nicht genau hatte erklären können, worum es ging, nur eben, dass es ein äußerster Notfall sei.
Auch jetzt war keine Zeit für lange Erklärungen, das sahen die anderen beiden Ärzte auch.
Herr Fichte musste sich selbst überlassen bleiben.
Dr. Leitner und Dr. Behnisch verschwanden mit der jungen Frau im Operationssaal, Dr. Norden nahm sich unter der Assistenz von Schwester Hildegard des Babys an.
Selbst Schwester Hilde, in Ehren ergraut und jenseits von Gut und Böse, konnte sich der Ausstrahlung nicht entziehen, die von Dr. Norden ausging. Seine Ruhe, seine Sicherheit teilte sich ihr mit. Es faszinierte sie, seine schlanken Hände zu beobachten, die das Kind drehten und wendeten, nachdem sie es schnell gewaschen hatte.
»Ein strammer Bursche«, sagte er. »Er ist gut davongekommen. Hat es ein bißchen zu eilig gehabt.«
»Ja, manchmal sind die Mütter auch recht sorglos«, sagte Schwester Hildegard.
»Ich weiß nicht, wie es zu dieser Sturzgeburt kam«, stellte er ruhig fest. »Hoffen wir, dass ihm seine Mutter erhalten bleibt.«
Das Baby schlief längst in einem weißen Bettchen, als seine Mutter aus dem Operationssaal gefahren wurde. Joachim Fichte hatte kein Ohr dafür gehabt, dass sein Sohn gesund und kräftig genug war, um die dramatische Geburt zu überstehen. Er zitterte noch immer, obgleich ihm Schwester Hildegard Beruhigungstropfen gebracht hatte.
Dr. Norden konnte ihm sagen, dass seine Frau nicht mehr in akuter Lebensgefahr schwebte.
Joachim Fichtes Erregung löste sich in Tränen, die ihm unaufhaltsam über die Wangen rannen. Dr. Norden ließ ihm Zeit, sich zu beruhigen. Er hatte volles Verständnis für ihn. Er selbst war auch ein werdender Vater. Er war durchaus nicht so ruhig, wie er sich gab, wenn er an Fee und ihr Baby dachte, und heute war er wieder einmal in eine Situation geraten, die ihn zutiefst beunruhigte.
Er war Arzt mit Leib und Seele und auch dazu berufen. Er fragte sich in solchen dramatischen Augenblicken, wie solche Gefahren verhindert werden, wie man das Leben von Mutter und Kind besser schützen könnte.
Er war kein Frauenarzt, aber wie sein Vater schon, hatte auch er sich mit jedem Gebiet der Medizin beschäftigt.
Wenn man ein richtiger Arzt sein wolle, hatte sein Vater gesagt, dann dürfe man sich nicht abgrenzen. Natürlich müsse es Spezialisten geben, aber bevor man sich für ein Spezialgebiet entscheide, musste man sehr viel gelernt haben, sodass einem jeder Teil des menschlichen Körpers vertraut wäre.
Dr. Friedrich Norden war das Ideal seines Sohnes gewesen. Immer, wenn Daniel in Zweifel geriet, überlegte er, wie sein Vater wohl entschieden und gehandelt hätte.
»Nur nie zögern, mein Junge«, hatte sein Vater gesagt. »Handeln gilt es, wenn ein Menschenleben auf dem Spiel steht. Minuten können entscheidend sein.«
So war es auch bei Margret Fichte gewesen. Nun aber wollte Dr. Norden von Joachim Fichte doch mehr erfahren.
»Wenn Sie sich beruhigt haben, Herr Fichte, erzählen Sie mir bitte, wie es zu dieser schnellen Geburt kam«, sagte er behutsam.
Der Mann krächzte nur. Er brachte kein Wort mehr hervor.
»Können wir Tee oder Kaffee haben?«, fragte Daniel die nette Schwester Nuno, eine junge Indonesierin.
»Okay, Herr Doktor«, sagte sie in ihrem lustigen Deutsch.
»Ich kann Ihnen doch nicht noch mehr Zeit rauben«, flüsterte Joachim Fichte, nachdem er ein paar Schlucke hastig getrunken hatte. »Sie waren meine einzige Rettung. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf stand.«
»Aber Sie wussten doch ungefähr den Termin der Geburt«, sagte Dr. Norden nachdenklich.
»Freilich. Übermorgen sollte es sein. Wir hatten auch schon alles vorbereitet. Margret war doch in der Universitätsklinik angemeldet. Wir haben in der Nähe gewohnt, bevor wir hierherzogen. Die Wohnung sollte schon vor drei Monaten fertig sein. Wir können nichts dafür, dass es sich mit dem Bau so hinzog. Es waren ein bisschen viel der Aufregungen, aber Margret hat sich wohlgefühlt. Gestern abend hat sie noch gar nichts gespürt. Sie hat mich immer ausgelacht, weil ich so ängstlich war. Kinderkriegen ist keine Krankheit, hat sie gesagt. Und dann das. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie erschrocken ich war, als sie mitten in der Nacht aufstand und sagte, dass wir nun wohl doch fahren müssten, und dann kamen wir nicht mal bis zur Tür.« Er schlug die Hände vor sein Gesicht. »Es war einfach schrecklich. Nie wieder möchte ich das erleben. Hilf mir doch, hat Margret gesagt, und da habe ich Sie angerufen. Ich habe doch keine Ahnung, was man da tun kann. Ich hatte nur noch Angst.«
Man müsste den Vätern wenigstens sagen, was im Notfall zu tun ist, dachte Daniel Norden.
»Ich danke Ihnen, dass Sie so schnell gekommen sind«, murmelte Joachim Fichte. »Ich weiß, dass wir es nur Ihnen zu verdanken haben, wenn meine Frau und unser Baby am Leben bleiben.«
»Übertreiben wir es mal nicht«, sagte Daniel Norden mit einem flüchtigen Lächeln. »Gesunde Babys sind zäher als man denkt, und ein Arzt kann auch keine Wunder verbringen, wenn das Glück nicht auf seiner Seite ist.« Er legte seine Hand auf Joachim Fichtes Schulter. »Jedenfalls war es richtig, dass Sie mich anriefen. Viel Zeit durfte nicht verstreichen. Jetzt ist Ihre Frau bei Dr. Leitner in guten Händen, und ich werde mich darum kümmern, wie es ihr geht. – Was macht Ihre Hand?«, lenkte er dann ab. »Geht es mit dem Spielen?«
»Gut. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, in der heutigen Zeit ist man gleich weg vom Fenster, wenn es nicht mehr so geht. Vielleicht darf ich Ihnen mal eine Freikarte schicken, Herr Doktor.«
»Wenn schon, dann zwei«, erwiderte Daniel lächelnd. »Meine Frau und ich lieben klassische Musik. Nun schauen Sie sich aber wenigstens mal Ihren Stammhalter richtig an. Er sieht sehr manierlich aus. Wie soll er denn heißen?«
»Eigentlich hatten wir uns auf eine Tochter vorbereitet, aber wenn Sie nichts dagegen haben, nennen wir ihn Daniel.«
Auch ein Zeichen der Dankbarkeit. Daniel fand es nett.
»Drüben ist eine Imbissstube«, sagte er zu Joachim Fichte. »Stärken Sie sich, damit Ihre Frau sich nicht noch um Sie Sorgen machen muss. Frauen sind da nämlich ganz komisch. Ihre Schmerzen vergessen sie schnell, wenn sie ihr Kind im Arm halten.«
»Danke, Herr Doktor, nochmals vielen Dank«, stammelte Joachim Fichte.
Dr. Norden musste sich beeilen. Seine Sprechstunde hatte eigentlich schon angefangen.
Er traf in der Halle noch Dr. Dieter Behnisch.
»Du bist ein ganz schneller, Dan«, sagte der. »Eine Viertelstunde später, und es wäre nichts mehr zu machen gewesen.«
»Wird sie durchkommen?«, fragte Daniel.
»Wir geben uns Mühe.«
»Kümmert euch auch ein bisschen um ihren Mann. Er ist ein sensibler Künstler. Ich muss weiter, die Pflicht ruft.«
»Wir sehen uns doch bald?«, rief ihm Dieter Behnisch nach.
»Wenn die Grippewelle gebremst ist.«
Als er am Steuer seines Wagens saß, dachte er, dass es ein langer Tag werden würde, denn Hausbesuche standen mehr als genug auf dem Notizblock.
Er gab Gas, aber er fuhr dennoch vorsichtig. In der Nähe gab es mehrere Schulen, und er wusste sehr gut, wie unvorsichtig Kinder waren, wenn sie es eilig hatten.
Da sah er auch schon einen Jungen, der über die Straße rannte, als die Ampel schon auf Gelb geschaltet war. Und dann preschte von der anderen Seite ein Sportwagen über die Kreuzung.
Daniel trat auf die Bremse und hörte das Kreischen von anderen Bremsen. Wie ein Filmstreifen rollte die Szene blitzschnell vor seinen Augen ab. Der Junge wurde gestreift, er fiel hin, der Wagen schleuderte, prallte an eine Mauer und drehte sich um seine eigene Achse.
Dr. Daniel Norden dachte nicht mehr an seine Sprechstunde, nur noch daran, dass hier ein Arzt gebraucht wurde.
Er lief zu dem Jungen, der benommen, aber nicht bewusstlos war, der ihn voller Entsetzen anstarrte und stammelte: »Das wollte ich doch nicht.«
Dann lief Daniel zu dem Wagen. Er sah nur eine Flut rotbrauner Haare über dem Steuer. Dann, als er die Wagentür aufgerissen hatte, eine schlaff herabhängende Hand. Er fühlte den Puls, der so schwach war wie der von Frau Fichte heute Morgen. Dann waren Menschen um ihn herum, und ganz automatisch erteilte er Anordnungen.
Und dann tönte plötzlich wieder eine klagende Stimme an sein Ohr: »Ich wollte das nicht. Ich bin schuld.« Ein kleiner schmutziger Junge in zerrissener Kleidung stand dicht neben ihm und schrie dann gellend: »Bringt sie zu Papi. Papi muss ihr helfen!«
»Wer bist du?«, fragte Dr. Norden.
»Stefan Albrecht. Mein Papi ist doch Professor, er kann der Dame helfen.« Und dann schluchzte er wieder herzzerreißend.
Irgendjemand musste getan haben, was Daniel Norden verlangt hatte. Der Unfallwagen kam.
Professor Albrecht, dachte er. Ein berühmter Chirurg am Unfallkrankenhaus. Es war bekannt, was er in der Unfallchirurgie geleistet hatte. Persönlich war ihm Daniel Norden noch nie begegnet!
»Und du kommst gleich mit«, sagte er zu dem Jungen. »Ich bin nämlich auch Arzt.«
»Und von Tante Hella kriege ich auch noch eine Tracht Prügel«, sagte der Junge bebend. »Aber sie soll mich ruhig hauen, wenn die Dame nur wieder gesund wird.«
»Nun beruhige dich mal, Stefan«, sagte Daniel. »Du bist bei Gelb über die Kreuzung, aber die Dame auch. Schuld seid ihr beide.«
»Ich war so spät dran. Ich hatte verschlafen. Tante Hella hat mich nicht geweckt. Sie hat wieder Migräne.«
»Und deine Mutter?«, fragte Daniel geistesabwesend.
»Ich habe keine Mutter. Sie ist schon lange tot.«
Daniel holte tief Luft. »Und dein Vater ist Professor Albrecht?«
»Ich hab’s doch gesagt. Ich habe nicht gelogen. Papi hat einen schweren Fall, deshalb ist er die ganze Nacht im Krankenhaus geblieben. Sonst weckt er mich, wenn Tante Hella Migräne hat. Wenn die Dame bloß am Leben bleibt, sonst mag Papi mich auch nicht mehr.«
*
Professor Martin Albrecht hatte eine aufregende Nacht hinter sich und war eigentlich schon todmüde, als der Morgen graute. Dann war bei seinem schwierigen Patienten nochmals eine Kreislaufschwäche aufgetreten.
Es handelte sich um eine prominente Persönlichkeit, und man erwartete von ihm, dass dieser Mann seinen Unfall überleben würde. Es handelte sich um einen ganz gewöhnlichen Unfall. Der Mann war auf einer Marmortreppe ausgeglitten und hatte sich dabei unglücklicherweise das Rückgrat verletzt. Da er zudem schwer herzkrank war, hatten sich zusätzliche Komplikationen ergeben. Die Hauptschwierigkeiten lagen aber darin, dass dieser Mann einem außereuropäischen Staat angehörte, dessen Machthaber diesen Unfall als ein Attentat auslegen wollten.
Die Oberschwester hatte zum ersten Mal erlebt, dass der Professor an diesem Morgen zu einem Aufmunterungsmittel gegriffen hatte.
Und dann kam der Unfallwagen. Als nach Professor Albrecht gerufen wurde, winkte die Oberschwester ab. »Unmöglich«, sagte sie barsch.
Dr. Norden stand vor ihr. »Professor Albrechts Sohn ist in den Unfall verwickelt«, sagte er.
»Stefan?«, schrie sie auf.
»Was ist mit Stefan?«, fragte eine heisere Stimme.
Dr. Norden stand Professor Albrecht gegenüber. Er war etwas kleiner als er, und sein markantes Gesicht war grau.
»Was ist mit meinem Sohn?«, fragte er erregt.
Daniel Norden stellte sich vor. »Ihrem Sohn geht es gut, soweit ich es bisher feststellen konnte. Er hat jetzt vor allem Angst.« Und dann erklärte er rasch, was geschehen war.
»Mein Gott«, sagte Professor Albrecht. Und dann schien alle Müdigkeit von ihm abgefallen zu sein.
»Sie sind der Sohn von Friedrich Norden?«, fragte er überstürzt. »Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Können Sie sich um meinen Sohn kümmern? Ich muss mir die Verletzte ansehen.«
»Soll ich Stefan mit in meine Praxis nehmen?«, fragte Daniel.
»Macht es Ihnen nichts aus?«
»Nein.«
»Danke«, sagte Professor Albrecht und eilte schon davon.
Stefan saß schluchzend in einem Sessel. »Papi ist wohl sehr böse auf mich, Dr. Norden?«, fragte er.
»Nein, aber er hat jetzt keine Zeit für dich. Du kommst mit zu mir und dann schauen wir uns mal deine Verletzungen an.«
»Tut gar nicht sehr weh«, sagte Stefan. »Brennt nur.«
Daniel nahm ihn bei der Hand. »Wie alt bist du?«, fragte er.
»Sieben.«
»Und wer ist Tante Hella?«
»Mamas Schwester. Mama habe ich ja gar nicht gekannt. Ich war noch ein Baby, als sie gestorben ist, aber so wie Tante Hella kann sie doch nicht gewesen sein.«
»Wie ist Tante Hella?«, fragte Daniel beiläufig.
»Affig, und dauernd hat sie Migräne«, erwiderte Stefan.
»Migräne kann einem schwer zu schaffen machen«, erklärte Daniel.
»Aber sie hat nie Migräne, wenn sie ausgeht, oder wenn Papi daheim ist. Da tanzt sie um ihn herum und kichert dämlich«, sagte Stefan.
Daraus konnte Daniel schon einiges entnehmen. Er meinte auch, dass der Junge nun ein wenig abgelenkt sei, aber es vergingen nur ein paar Sekunden, dann sagte Stefan beklommen: »Aber wenn der Dame was ganz Schlimmes passiert ist, wird Papi mich auch nicht mehr mögen, und dann ist alles aus.«
»Ich habe dir gesagt, dass sie genauso schuld war wie du, Stefan«, erklärte Daniel. »Ich habe es gesehen und kann es bezeugen.«
»Aber sie wollte mich nicht überfahren«, flüsterte der Junge. »Sie wollte es nicht. Ich habe mich umgedreht und ihr Gesicht gesehen. Sie sah aus wie ein Geist.« Und dann weinte er wieder.
*
Fee lief verstört in der Praxis umher. »Mein Gott, wo bleibt Daniel nur«, flüsterte sie. »Es wird doch nichts passiert sein.«
»Er kommt schon«, sagte Helga Moll tröstend, obgleich sie sich nicht weniger Gedanken machte. Es war immerhin schon neun Uhr vorbei, und anrufen hätte der Doktor wenigstens können, meinte auch sie.
Fee hatte schon in der Klinik angerufen, aber da hatte man ihr gesagt, dass Dr. Norden schon so um acht Uhr herum weggefahren sei. Es war verständlich, dass Fee sich Sorgen machte. Und sie schrie erleichtert auf, als er nun durch die Türe trat. Den Jungen an seiner Hand sah sie gar nicht.
»Daniel, Liebster«, flüsterte sie bebend, »ich habe mich so geängstigt.«
»Daran bin ich nun auch noch schuld«, murmelte Stefan.
»Das ist der Grund«, sagte Daniel und schob den Jungen vor, »und noch was anderes. Reg dich doch nicht auf, Fee. Ich bin ja da.«
»Na, Gott sei Dank«, sagte Hella Moll.
»Molly, können Sie den Kleinen mal bemuttern?«, fragte Daniel Norden. »Ich muss mich erst waschen.«
Bericht erstatten wollte er seiner Frau nebenbei auch noch.
»Was hast du denn angestellt?«, fragte Molly den Jungen.
»Sag ich lieber nicht, sonst schmeißt ihr mich raus. Der Doktor ist ja nett, aber sonst kriege ich bestimmt was aufs Dach.«
»Sehe ich aus, als würde ich beißen?«, fragte Molly.
»Nö, und Molly klingt auch gemütlich«, sagte Stefan, »aber du weißt ja nicht, was ich gemacht habe.«
»Du kannst es mir erzählen«, sagte sie. »Ein hübsches Loch hast du in der Hose und im Knie auch.«
»Hübsch ist das nicht. Tante Hella wird wieder keifen. Es war nämlich so, dass ich nicht zu spät in die Schule kommen wollte. Dann bin ich über die Straße gelaufen, und da kam ein Auto. Und dann ging alles schnell, aber viel habe ich nicht abgekriegt. Lieber wär’s mir, ich würde im Unfallkrankenhaus sein, und die Dame könnte reden. Aber sie kann nicht reden, Molly. Sie wird doch nicht tot sein?«
»Reg dich jetzt nicht auf, Stefan«, tönte da Dr. Nordens Stimme durch den Raum. »Meine Frau verarztet dich, und nachher reden wir in aller Ruhe miteinander.«
Aus tränenvollen Augen sah Stefan Fee an. »Es tut mir ja so leid, so sehr leid. Auch dass du dich aufgeregt hast, Frau Doktor.«
Fee wusste nun schon Bescheid, und liebevoll nahm sie den Jungen in den Arm.
»Was geschehen ist, ist nicht mehr zu ändern, Stefan«, sagte sie beruhigend. »Wir wollen hoffen, dass dein Papi der Dame helfen kann. Jetzt werde ich dich mal untersuchen. Bist du einverstanden?«
Er nickte. »Nur nicht zu Tante Hella«, flüsterte er, »bitte, nicht zu Tante Hella.«
»Na, das muss ja ein Drachen sein«, brummte Molly.
Professor Martin Albrecht stand indessen am Operationstisch vor dem Unfallopfer. Es war eine junge Frau und wenn man von den Gesichtsverletzungen absehen wollte, eine sehr schöne Frau. Vielleicht Mitte zwanzig, vielleicht auch älter. Ein klassisch geschnittenes Gesicht, das ganz still war.
Professor Albrecht hatte getan, was er konnte, und so, als hätte er nicht die ganze Nacht gewacht. Seine Hände waren sicher gewesen, seine Konzentration so, wie man es von ihm gewöhnt war.
Er hatte an seinen Jungen gedacht, seinen einzigen Sohn, der diesen Unfall mitverschuldet hatte. Er hatte gedacht: Sie darf nicht sterben. Stefans Leben darf nicht mit solcher Schuld belastet werden.
»Sie haben getan, was Sie konnten«, sagte die Oberschwester theatralisch. »Nun müssen wir auf Gottes Hilfe hoffen.«
Der Professor reagierte nicht. Er blieb stumm, und stumm ging er auch hinaus. Sein Assistenzarzt folgte ihm.
»Sind die Personalien bekannt?«, fragte Professor Albrecht tonlos.
»Ich werde mich sofort erkundigen, Chef«, sagte der junge Arzt.
»Ich bitte darum. Sie finden mich in meinem Zimmer. Die Visite soll der Oberarzt übernehmen.«
Er setzte sich an seinen Schreibtisch und stützte den Kopf in beide Hände. Er war so müde, so erschöpft, und doch vibrierten seine Nerven.
Dr. Schilling kam leise herein. Sein Klopfen hatte Professor Albrecht überhört.
»Sie wollten die Personalien haben, Chef«, sagte Dr. Schilling.
»Ja, bitte!«
»Sie heißt Kerstin Torstensen, ist Schwedin, Architektin. Die genaue Adresse wissen wir noch nicht.«
»Man soll versuchen, sie in Erfahrung zu bringen«, sagte der Professor. »Man muss ja die Angehörigen verständigen. Ist sie verheiratet?«
»Im Pass steht nichts.«
Neunundzwanzig Jahre alt, dachte Martin Albrecht. Neunundzwanzig war Irene, als sie starb. Irene, Stefans Mutter. Auch sie war jung und schön gewesen. Aber sie war im Bett gestorben; im Kindbett. Und er hatte ihr nicht helfen können und auch kein anderer.
»Sie müssen jetzt schlafen, Herr Professor«, sagte Minuten später die Oberschwester. »Sie sind rund um die Uhr auf den Beinen.«
Nach Hause fahren? Sich Hellas Gezeter anhören? Nein, das konnte er nicht. Er ging ins Ärztezimmer, aber als er seine müden Glieder ausgestreckt hatte, dachte er an Stefan.
Dr. Norden, ging es ihm durch den Sinn. Friedrich Nordens Sohn. Die Insel der Hoffnung. Friedrich Nordens Lebenswerk. Erlebt hatte er es selbst nicht mehr, aber sein Sohn hatte seine Idee verwirklicht. Ein prächtiger Sohn. Sehr sympathisch. Er wird sich um Stefan kümmern, dachte Professor Albrecht, und dann schlief er ein. Die Natur verlangte ihr Recht.
*
Kerstin Torstensen war in ein schmales Zimmer gefahren worden. Ein Notbehelf, aber es war kein Krankenzimmer frei. Von der Verwaltung war der Bescheid gekommen, dass man auch erst wissen müsse, in welche Klasse man sie legen könne.
Eine Ausländerin! Vielleicht war sie nicht einmal versichert, hatte die Oberschwester gemeint.
»In Schweden braucht man keine Versicherung«, erklärte Dr. SchilIing kühl. »Da wird man auf Staatskosten ärztlich versorgt.«
Er hatte einen ziemlich giftigen Blick der Oberschwester dafür eingehandelt, aber er war sicher, dass sein Chef nicht danach fragen würde, ob die Verletzte versichert sei.
Dass Oberschwester Ursula es auf Professor Albrecht abgesehen hatte, wusste jeder. Es gab auch andere, die es auf ihn abgesehen hatten. Dr. Schilling wusste aber auch, dass es den Chef gar nicht berührte. Er lebte nur für seinen Jungen, und der sollte in den Unfall verwickelt sein.
Dr. Schilling bewunderte seinen Chef, von dem er viel gelernt hatte. Ja, in manchen Augenblicken wurde die Bewunderung sogar zur Verehrung, denn Martin Albrecht gehörte nicht zu jenen Chefärzten, die die Honorare der Privatpatienten für sich scheffelten. Man tuschelte jedoch, dass er dies nicht nötig hätte, weil er sehr vermögend sei. Wie dem auch sein mochte, Dr. Bernd Schilling hat den Chefarzt nicht nur als ganz großen Mediziner kennengelernt, sondern auch als Mensch voller innerer Werte.
Dr. Schilling betrachtete die Patientin, deren blasses Gesicht von dem wundervollen goldbraunen Haar umgeben war. So schönes Haar hatte er noch niemals gesehen, auch noch nie ein so apartes Gesicht, das selbst in der Bewusstlosigkeit noch ausdrucksvoll war.
Zum Glück waren die Kopfverletzungen nicht schlimm gewesen. Die paar Schrammen würden verheilen. Es wäre auch ein Jammer gewesen, wenn dieses Gesicht zerstört worden wäre. Als er leise, aber schon ruhige und vernehmbare Atemzüge erlauschte, atmete er erleichtert auf.
Es war fast unglaublich, aber sie kam schon zu sich. Verschleiert war ihr Blick, verwundert und auch angstvoll.
»Was ist mit dem Kind?«, flüsterte sie.
Der Schock, den sie mit in die Bewusstlosigkeit genommen hatte, beherrschte auch jetzt im Augenblick des Erwachens ihr Denken. Für den jungen Arzt bedeutete es Erleichterung, dass ihre Gehirnzellen arbeiteten.
»Dem Jungen geht es gut«, erwiderte er, obgleich er so genau nicht informiert war.
»Gott sei Dank«, flüsterte Kerstin, dann schloss sie wieder die Augen. Was mit ihr selbst geschehen war, wollte sie anscheinend nicht wissen. Dr. Schilling konnte nicht ahnen, wie unwichtig ihr das war, nachdem, was sie heute morgen erlebt hatte.
Kerstin schlief nicht ein. Ihre Gedanken arbeiteten. Zuerst hatte sie geglaubt, in einem bösen Traum gefangen zu sein, doch nun wusste sie, dass alles wirklich geschehen war, dass es sich in ihrer Wohnung abgespielt hatte. Vor zwei Tagen war sie mit dem Einrichten fertig geworden, und gestern hatte sie ihren Mitarbeitern eine kleine Einweihungsparty gegeben. Natürlich war auch ihr Chef dabei, Tonio Laurentis, der geniale Architekt, ihr Vorbild, in ihren Augen der ideale Mann.
Kerstin war neunundzwanzig Jahre, und es hatte manchen Flirt in ihrem Leben gegeben, doch mehr nicht. Sie hatte keine Zeit gehabt, sich um Männer zu kümmern, sie war vom Ehrgeiz besessen, auf der Erfolgsleiter ganz nach oben zu steigen, so bekannt zu werden wie Tonio. Sie hatten so fantastisch zusammengearbeitet, wie sie es sich idealer gar nicht vorstellen konnte.
Er war noch geblieben, als die andern alle gegangen waren. Er müsse noch etwas mit ihr besprechen, hatte er gesagt, und sie hatte nichts besonderes dabei gefunden. Und dann? Sie sah ihn vor sich, groß, breitschultrig, mit dem abenteuerlichen Gesicht eines Wikingers, den stahlblauen Augen, die meist so kühl blickten, dem immer etwas spöttischen Mund, der doch so manches Mal Sehnsüchte in ihr geweckt hatte. Waren diese unbegreiflichen Worte tatsächlich über diese Lippen gekommen, die jetzt wieder in ihren Ohren klangen?
»Nun pass mal auf, Kerstin, machen wir Schluss mit dem Versteckspielen. Du willst mich, und ich will dich. Du bist ein verdammt ehrgeiziges kleines Frauenzimmer, aber bilde dir nicht zu viel ein. Ohne mich bist du nichts, das musst du einsehen, aber wenn du dich auf mich einstellst, werden wir ein gutes Gespann abgeben. Heirat ist nicht drin, wenn du darauf spekulierst. Meine Frau würde niemals in eine Scheidung einwilligen, und wir haben drei Kinder.«
Da war sie schon fassungslos genug gewesen, denn noch nie war davon die Rede gewesen, dass er verheiratet war und Kinder hatte. Dabei arbeiteten sie schon zwei Jahre zusammen.
Aber es kam schlimmer. Seine Frau und Kinder würden in der Schweiz leben, und sie brauche sich dadurch nicht gestört zu fühlen.
»Du regst meine Fantasie an, Kerstin, du bist modern, unkonventionell und sehr begehrenswert.«
Und wie er sie begehrte, hatte sie dann zu spüren bekommen, obgleich sie ihm sagte, dass sie so modern nun auch wieder nicht sei.
Sie hatte in ihrem wilden Zorn böse Worte zu dem Mann gesagt, den sie doch auf ein Podest gestellt hatte, als ihr Ideal, und das hatte ihn ernüchtert.
»Na gut, wenn du Moral predigen willst, kannst du dir eine andere Stellung suchen. Dann werden wir doch mal sehen, wie weit es mit deinem Können bestellt ist.«
So war er also wirklich, der große, geniale Tonio Laurentis. Ein eitler Mann, der wegschob, was ihm nicht einfach zuflog. Wie erschreckend kalt war sein Blick gewesen, seine Stimme.
Er war gegangen, sie hatte versucht zu schlafen. Wie hätte sie schlafen können mit all den Gedanken, die sie bewegten. Sie kam sich gedemütigt vor und stellte sich vor, wie er seinen Mitarbeitern sagen würde, dass sie für ihn nicht mehr akzeptabel sei.
Und die Drohung tönte in ihren Ohren, dass sie bei den bekannten Kollegen bestimmt keine Anstellung finden würde. Sie saß also auf der Straße, hatte ihr ganzes Geld in diese Wohnung gesteckt, von der sie geträumt hatte.
Das so einfach hinnehmen? Nein, hatte sie gedacht, als der Morgen graute. Und sie war zur gleichen Zeit wie immer aus dem Hause gegangen, hatte sich in ihren Wagen gesetzt und war losgefahren. Und dann war plötzlich das Kind über die Straße gelaufen. Nicht überfahren, nein, nicht überfahren! – Das war ihr einziger Gedanke gewesen, und wie sie dann reagiert hatte, wusste sie nicht mehr.
*
»So, Stefan, das hätten wir«, sagte Fee Norden zu dem Jungen.
Er sah sie nachdenklich an. »Bist du eine richtige Frau Doktor?«, fragte er.
»Eine ganz richtige«, erwiderte sie lächelnd.
»Du hast mein Bein auch sehr schön verbunden. Das muss man gelernt haben. Tante Hella kann nicht mal einen Finger verbinden.« Er atmete schnell. »Wenn sie nun von der Schule anrufen bei ihr? Das haben sie schon mal gemacht, als ich nicht gekommen bin, und dann war sie vielleicht wütend. Sie hat mich gleich mit der Hundeleine geschlagen.«
Das scheint ja eine seltsame Tante zu sein, dachte Fee bestürzt.
»Gehst du öfter nicht zur Schule?«, fragte sie nun aber doch, denn es konnte ja möglich sein, dass er so ganz schuldlos an Zornausbrüchen nicht wäre.
»Nur das eine Mal bin ich nicht gegangen. Es war so ein schöner Tag, und die Schneeglöckchen im Park haben gerade geblüht. Außerdem war ich sowieso viel zu spät dran, weil sie mich nicht geweckt hatte. Papi war auf dem Kongress. Könntest du nicht mal in der Schule Bescheid sagen, dass ich nicht kommen kann, Frau Doktor?«
»Wenn du mir sagst, in welche Schule du gehst?«
Vertrauensvoll nickte er und sagte es. »Wenn sie bloß nicht schon angerufen haben. Dass Tante Hella hierherkommt, will ich auch nicht. Der Doktor, dein Mann, hat mir gesagt, dass Papi mich hier abholen wird. Darf ich bleiben?«
»Natürlich darfst du bleiben, aber meinst du nicht, dass man deine Tante benachrichtigen müsste?«
»Das soll lieber mein Papi tun. Vor dem hat sie wenigstens Respekt. Da traut sie sich nichts mehr zu sagen. Sonst langt es ihm vielleicht doch einmal, und er setzt sie aus dem Haus.«
Merkwürdige Verhältnisse schienen im Hause Professor Albrechts zu herrschen, aber Fee wollte sich nicht in Vermutungen verlieren, bevor sie den Vater dieses aufgeweckten kleinen Jungen nicht kennengelernt hatte.
Sie rief in der Schule an und entschuldigte Stefan. Man erkundigte sich, wer sie denn sei, und sie erklärte es. Sie sagte auch, dass Professor Albrecht benachrichtigt sei. Das endlich schien zu genügen. Sie konnte sich wieder dem Jungen zuwenden.
»Hast du Hunger, Stefan?«, fragte sie.
»Eigentlich schon. Ich habe heute morgen nichts gegessen. Tante Hella ist ja nicht aufgestanden wegen der Migräne.«
»Dann bringe ich dich jetzt hinauf in unsere Wohnung, und Lenchen wird dich versorgen. Wir haben hier nämlich allerhand zu tun.«
»Wer ist Lenchen?«, erkundigte sich Stefan vorsichtig.
»Unsere Haushälterin. Sie ist schwerhörig, aber sie hat Kinder gern.«
»Und ist sie nicht böse, wenn du mich einfach mitbringst?«
»Nein.«
Sie nahm ihn bei der Hand. Schüchtern lächelte er Molly zu, als sie an ihr vorbeigingen. Dann fuhren sie mit dem Lift aufwärts zum Penthouse, und das imponierte Stefan gewaltig. Ein richtiges Haus auf dem Dach eines anderen großen Hauses, und man konnte über die Stadt blicken. Sogar einen richtigen Garten gab es mit echten Pflanzen. Stefan kam aus dem Staunen nicht heraus.
Fee informierte indessen Lenchen, die in der Küche rumorte und sie natürlich nicht hatte kommen hören.
Lenchen nahm sich also Stefans an. Er betrachtete sie forschend und entschuldigte sich höflich, dass er Mühe mache.
»Du musst lauter sprechen«, sagte Fee, aber Lenchen beeilte sich schon, ihr Hörgerät zu holen, das sie notfalls doch anlegte, obgleich sie das »dumme Ding«, wie sie es nannte, sonst behinderte.
Fee konnte beruhigt wieder an die Arbeit gehen, und das war gut so, denn die Grippewelle hatte so um sich gegriffen, dass es keine Verschnaufpause gab.
Daniel wurde dann zu ein paar dringenden Fällen gerufen, wo sich Kreislaufversagen eingestellt hatte, die tückischste Begleiterscheinung dieser Grippe.
Im Unfallkrankenhaus war indessen Professor Albrecht von unbekannten Geräuschen emporgeschreckt worden, und er konnte sich nicht gleich erinnern, dass er im Ärztezimmer geschlafen hatte. Es lag neben dem Speiseaufzug, und der war nun um die Mittagszeit unaufhaltsam in Betrieb.
Schnell war er nun wieder auf den Beinen. Er dachte an Stefan, an seinen Jungen, den er Dr. Norden anvertraut hatte. Du lieber Himmel, was mochte der Kollege von einem Vater denken, der schlief, anstatt sich um seinen Sohn zu kümmern.
Allerdings konnte er die Klinik nicht verlassen, ohne sich von dem Befinden der Verletzten überzeugt zu haben, und es musste wohl auch sein, dass er seinen prominenten Patienten aufsuchte.
Oberschwester Erika war zur Stelle. Sie war gekränkt, weil er lieber von Dr. Schillig Bericht erstattet bekommen wollte.
Schnell ging Professor Albrecht zu Kerstin Torstensen. Sie schlief oder sie tat so. Er war sich nicht schlüssig, ob er sie ansprechen solle, aber das konnte er auch später tun. Es beruhigte ihn einigermaßen, dass sie nicht in Lebensgefahr schwebte.
Nachdem er sich auch davon überzeugt hatte, dass sich der Zustand seines prominenten Patienten gebessert hatte, gab er noch einige Anordnungen und verließ dann die Klinik.
Als er in seinem Wagen saß, fiel ihm ein, dass er Dr. Nordens Adresse gar nicht kannte. Und es fiel ihm auch ein, dass Hella jetzt wohl auf den Jungen warten würde.
Er hielt bei der nächsten Telefonzelle und rief zuerst Hella an, während er gleichzeitig in dem Buch blätterte, bis er den Buchstaben N gefunden hatte.
Hellas schrille Stimme überfiel ihn gleich mit Vorwürfen, dass Stefan noch immer nicht zu Hause sei und dass er sich ständig herumtreibe, und, und … Er kannte diese Wehklagen zur Genüge und hatte auch schnell eine Ausrede erfunden.
Er sagte, dass er den Jungen abgeholt hätte und er mit ihm in einem Restaurant essen würde, da sie ja ohnehin ihre Migräne hätte. Er sagte es spöttisch und legte mit einem kurzen Gruß auf.
Sie war eine Nervensäge, aber was sollte er machen? Im Augenblick konnte er nicht darüber nachdenken, dass auch eine andere Lösung zu finden wäre. Er suchte Dr. Nordens Adresse heraus, stellte fest, dass seine Praxis im gleichen Viertel gelegen war wie sein Haus und brauchte so nicht lange herumzusuchen. Eine Viertelstunde später hielt er vor dem modernen Hochhaus, in dem sich Dr. Nordens Praxis befand.
Molly war bereits heimgefahren. Sie arbeitete jetzt nur noch halbtags.
Am Nachmittag kam eine andere Sprechstundenhilfe. Molly hatte schließlich auch eine Familie zu versorgen.
Daniel machte noch Hausbesuche. Fee hatte gerade den letzten Patienten abgefertigt, als Professor Albrecht kam. Sie war überrascht. Ein recht jugendlicher Professor, dachte sie, aber ein sympathischer Mann.
Er war überrascht, in dieser bezaubernden jungen Frau die Ehefrau Dr. Nordens kennenzulernen.
»Stefan ist oben in unserer Wohnung«, erklärte Fee unbefangen. »Unser Lenchen versorgt ihn. Fahren wir gleich hinauf.«
Im Lift gab er ihr verlegen die Erklärung ab, warum er erst so spät käme, aber Fee sagte, dass dies gar nichts ausmachen würde.
»Wie geht es der Verletzten?«, erkundigte sie sich. »Mein Mann war, wie Sie ja wohl wissen, Zeuge des Unfalls. Stefan trifft nicht die Alleinschuld.«
»Frau Torstensen geht es glücklicherweise auch den Umständen entsprechend einigermaßen. Mein Gott, was hätte passieren können!«
»Torstensen?«, fragte Fee. »Doch nicht die Architektin?«
»Ja, ich glaube, so etwas gehört zu haben. Um nähere Einzelheiten konnte ich mich noch nicht kümmern.«
»Stefan ist gut davongekommen«, sagte Fee. Davon konnte er sich überzeugen. Allerdings begrüßte ihn Stefan recht kleinlaut.
»Wird die Dame wieder gesund, Papi?«, war seine erste Frage.
»Ja, Stefan, gesund wird sie, aber du bist dir doch im Klaren, was du angerichtet hast.«
»Ich weiß es ja, Papi, und es tut mir so schrecklich leid. Du kannst auch mein ganzes Sparschwein für die Dame haben, aber bitte, sag Tante Hella nicht, wie es gewesen ist.«
»Sie wird es doch erfahren«, sagte Martin Albrecht. »Die Tatsachen kann man nicht wegwischen, Stefan. Ich bin froh, dass dir nicht mehr passiert ist«, fügte er dann leise hinzu.
»Hier sind alle so schrecklich nett zu mir, Herr Doktor und Frau Doktor und Lenchen. Warum haben wir nicht auch ein Lenchen oder eine Molly, Papi?«
Sein Kummer machte sich auf diese Weise Luft, und was sollte er, der Professor, der so wenig Zeit hatte, sich um seinen Sohn zu kümmern, dazu schon sagen? Er kannte das Dilemma seines Familienlebens zur Genüge.
»Ja, dann werden wir Frau Dr. Norden mal nicht länger zur Last fallen«, sagte Professor Albrecht. »Ich werde mich zu einer günstigeren Zeit mit Ihnen unterhalten und kann Ihnen einstweilen nur sehr herzlichen Dank sagen, Frau Norden.«
»Ich möchte aber nicht zu Tante Hella«, schluchzte Stefan auf.
Lenchen hatte ihr Hörgerät noch an und vernahm es.
»Das Jungchen kann doch hierbleiben«, trompetete sie. »Bei uns isst sowieso nie einer zur normalen Zeit.«
Fee lächelte. »Das ist ihr größter Kummer«, sagte sie, »aber Stefan könnte wirklich noch hierbleiben, Herr Albrecht.«
»Das wäre wohl zu viel der Güte«, meinte er.
»Ach was, wir brauchen doch nicht so formell zu sein. Wir sind Kollegen. Wie wäre es denn, wenn wir Lenchen die Freude machen würden, uns ein warmes Essen zu servieren?« Er sah sie irritiert an und Fee lachte leise. »Sie sind hiermit ganz formell eingeladen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich sage, dass Sie so aussehen, als könnten Sie eine kräftige Mahlzeit brauchen.«
Der Bann war gebrochen. Fees zauberhafter Charme nahm Martin Albrecht die Hemmungen. Seine Zunge löste sich. Er erklärte, dass ihm der Name Norden vor allem in Verbindung mit der Insel der Hoffnung bekannt sei. Und nun mangelte es an Gesprächsstoff nicht mehr.
Abgehetzt kam Daniel eine halbe Stunde später, und er zeigte überhaupt keine Überraschung, den Professor am Mittagstisch vorzufinden.
»So ist es recht«, sagte er. »Freut mich, dass wir uns näher kennenlernen.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll«, erwiderte Martin Albrecht. Fee war er von Minute zu Minute sympathischer geworden. Keine Spur von Arroganz zeigte er, wie sie doch so manchen Chefärzten anhaftete.
»So gut hat es uns schon lange nicht mehr geschmeckt, gell, Papi«, sagte Stefan. »Möchte nur wissen, was sich Tante Hella jetzt aufregt, wenn ich nicht heimkomme.«
»Ich habe sie angerufen und ihr gesagt, dass ich mit dir essen gehen würde«, erklärte sein Vater.
»Du bist aber schlau und lieb«, sagte Stefan strahlend, »und dabei müsstest du doch wirklich wütend auf mich sein.«
Daniel und Fee tauschten einen lächelnden Blick. Ob dieser Mann überhaupt wütend werden konnte?
Nun, erschrocken hatte Daniel ihn heute Morgen kennengelernt, und auch tief besorgt. Und in Anbetracht dessen, dass wohl noch einiges auf ihn zukommen würde, wäre es verzeihlich gewesen, wenn er erregt wäre, aber er trug wohl seine Gemütsbewegungen nicht zur Schau.
»Mit einer Gegeneinladung in meinem Hause kann ich Ihre Gastfreundschaft leider nicht erwidern«, sagte er, als er sich verabschiedete. »Vielleicht können wir ein Treffen an einem neutralen Ort vereinbaren, wenn diese Geschichte durchgestanden sein wird.«
»Wäre es nicht gemütlicher, wenn wir uns wieder mal hier bei uns zusammensetzen?«, fragte Fee.
»Sie beschämen mich«, sagte Professor Albrecht leise. »Wenn Sie jetzt schon Stefan noch hierbehalten, bis sich die Sturmeswogen bei uns daheim geglättet haben, gerate ich immer tiefer in Ihre Schuld.«
»Davon kann gar nicht die Rede sein«, sagte Daniel leger.
Und Fee lenkte ab. »Übrigens, wenn es sich um die Architektin Kerstin Torstensen handelt, kann ich Ihnen zeigen, wo sie wohnt.« Sie machte eine Handbewegung zur Dachterrasse und deutete dann auf ein Haus, das gar nicht weit entfernt stand.
»Da droben auf diesem Dach hat sie ihre Wohnung eingerichtet«, erklärte Fee. »Ich erfuhr es von einer Freundin. Kerstin Torstensen hat einen ungewöhnlichen Geschmack, deswegen interessiere ich mich für sie. Lassen Sie es mich doch bitte wissen, ob sie identisch mit Ihrer Patientin ist, Herr Albrecht.«
»Gern. Ich hoffe, dass sie bald wieder hergestellt ist.«
»Ich auch, Papi. Ich entschuldige mich auch bei ihr, wenn sie nicht zu böse auf mich ist«, sagte Stefan kleinlaut.
»Das wird das Mindeste sein«, sagte sein Vater. »Du hast einen hübschen Denkzettel bekommen.«
»Aber dadurch die allerliebsten, netten Menschen kennengelernt«, sagte Stefan kindlich. Und wie sollte man ihm da noch böse sein?
Professor Albrecht fuhr in die Klinik zurück, allerdings mit einem Umweg. Er musste mit Hella sprechen.
Stefan wurde wieder Lenchens Obhut übergeben, und das gefiel beiden sehr. Daniel und Fee mussten sich um ihre Patienten kümmern.
»Dass du dich ja nicht ansteckst, Feelein«, sagte Daniel besorgt. »Denk auch an das Baby. Ich habe heute morgen ehrlich gesagt wieder mal einen Schock bekommen.«
Er meinte damit Frau Fichte. Über diesen Fall hatten sie sich in dem Trubel noch gar nicht unterhalten können.
Freitag, der Dreizehnte, auch Professor Albrecht sollte ihn nicht vergessen, so wenig wie Dr. Norden auch.
Hella benahm sich so hysterisch wie noch nie, bevor er ihr überhaupt etwas erklären konnte. Und als ihm dies schließlich doch gelungen war, bekam sie beinahe einen Tobsuchtsanfall.
»Mir wird das einfach zu viel«, schrie sie. »Nun kommt womöglich auch noch die Polizei ins Haus. Aber das kommt davon, dass du den Bengel so verwöhnen musst. Irene hätte das nicht getan.«
»Nein, Irene hätte das nicht getan«, sagte er tonlos. »Wenn es dir zu viel wird, Hella, ist es besser, wenn wir uns trennen.«
Sie sah ihn fassungslos an, starr vor Entsetzen, denn in ihrer Wut hatte sie mit solcher Reaktion nicht gerechnet.
»Und was soll aus Stefan werden?«, rief sie schrill.
»Ein vernünftiger Junge ohne Angst«, erwiderte er heiser. »Ein Junge, der beizeiten geweckt wird und ein Frühstück bekommt und nicht rennen muss, um rechtzeitig in die Schule zu kommen. Ein Kind, das Kind sein darf und gern nach Hause geht. So, das musste einmal gesagt werden.«
»Na, dann such dir nur jemanden, der sich mit diesem Lausebengel abmüht«, zischte sie.
»Ich werde jemanden suchen und auch finden«, sagte er. »Und du suchst dir jemanden, der deine Launen erträgt. Ich kann es nicht mehr.«
Und dann ging er, und irgendwie fühlte er sich wie befreit.
In der Klinik erlebte er eine Überraschung. Oberschwester Erika verkündete ihm, dass die Polizei dagewesen sei wegen Frau Torstensen. Dr. Schilling warf rasch ein, dass Frau Torstensen ausgesagt hätte, dass sie schuld sei an dem Unfall.
»Hatte ich nicht angeordnet, dass sie in keiner Weise belästigt werden soll?«, fragte Professor Albrecht.
Oberschwester Erika zuckte ob des scharfen Tones zusammen.
»Sie ist bei Bewusstsein, und der Kommissar wollte sie befragen. Sie wird schon allein schuld gewesen sein, wenn sie es sofort zugibt, und was hätte Stefan passieren können«, fügte sie salbungsvoll hinzu.
»Ihm ist nichts passiert, abgesehen von ein paar Abschürfen, und Dr. Norden hat gesehen, dass er bei Gelb über die Straße lief«, sagte Professor Albrecht kühl.
Für Oberschwester Erika geriet die Welt ins Wanken, weil der Professor seinen Sohn nicht von aller Schuld reinwaschen wollte, wo Frau Torstensen diese doch schon auf sich genommen hatte.
»Ich werde jetzt mit Frau Torstensen sprechen und wünsche nicht gestört zu werden«, sagte Professor Albrecht. »Liegt noch etwas Besonderes vor?«
Dr. Schilling verneinte. »Sie wissen, wo ich zu finden bin, falls etwas sein sollte«, sagte der Professor.
Leise öffnete er die Tür des Krankenzimmers und blickte dann sofort in zwei wunderschöne topasfarbene Augen, die voll auf ihn gerichtet waren.
»Mein Name ist Albrecht«, sagte er. »Mein Sohn hat den Unfall verschuldet.«
»Ich habe ihn verschuldet«, sagte Kerstin mit klarer Stimme. »Ich habe nicht aufgepasst, Herr Professor.«
»Mein Sohn hat auch nicht aufgepasst. Er ist jedenfalls nicht bereit, seine Mitschuld zu bestreiten und ich auch nicht. Stefan ist mit ein paar Schrammen davongekommen, Sie werden mindestens vierzehn Tage hier liegen müssen. Ab morgen werden Sie jedoch ein freundlicheres Zimmer bekommen.«
»Machen Sie meinetwegen keine Umstände. Es gibt sicher Menschen, die schlimmer dran sind als ich«, sagte Kerstin.
»Wir werden noch feststellen müssen, wie sich der Unfall auswirkt. Unter der Schockeinwirkung vergisst man die Schmerzen. Dass ich sehr froh wäre, wenn sich keine Folgen auswirken, brauche ich wohl nicht zu betonen. Aber vielleicht sagen Sie mir, warum Sie so schnell bereit waren, die Schuld auf sich zu nehmen?«
»Es wäre schrecklich gewesen, wenn ich das Kind überfahren hätte«, flüsterte sie. »Ich habe nicht aufgepasst. Ich war mit meinen Gedanken nicht auf der Straße, also trifft mich die Schuld. Bei Kindern muss man immer mit unüberlegten Reaktionen rechnen. Warum soll Ihr Sohn bestraft werden?«
»Das liegt mir fern. Er ist tief betrübt und hofft nur, dass er sich bei Ihnen entschuldigen darf, Frau Torstensen. Aber würden Sie mir jetzt bitte sagen, was ich für Sie tun kann, abgesehen von medizinischer Betreuung.«
»Nichts«, erwiderte Kerstin leise.
»Haben Sie nicht Freunde oder Angehörige, die verständigt werden sollten?«
»Nein. Mir wäre es am liebsten, niemand würde erfahren, dass ich hier liege.«
Eine seltsame und überraschende Erklärung. Professor Albrecht betrachtete die junge Frau gedankenvoll.
Eine bekannte Architektin. Sie musste schon einen Namen haben, wenn eine Frau wie Fee Norden sich für sie interessierte. Und sie sollte keine Freunde haben? Es war unvorstellbar.
»Ich bin froh, wenn ich hier meine Ruhe habe«, sagte Kerstin, »aber wenn Ihr Sohn mich besuchen will, habe ich nichts dagegen. Ich möchte mich gern überzeugen, dass es ihm gutgeht.«
Eine eigenartige Frau, stellte Professor Albrecht für sich fest. Für ihre eigenen Verletzungen schien sie sich überhaupt nicht zu interessieren. Und auch nicht dafür, welche Folgen es für ihren Beruf haben könnte, wenn sie jetzt für ein paar Wochen ans Bett gefesselt war.
Sobald er sie ansah, verschloss sich ihr Gesicht. Und dann erklärte sie, dass sie jetzt gerne schlafen würde. Er spürte, dass sie weiteren Fragen aus dem Wege gehen wollte.
*
Tonio Laurentis hatte schneller von dem Unfall erfahren, als Kerstin lieb sein konnte. Er hatte ihren zerbeulten Wagen gesehen und sofort erkannt. Er hatte nun ziemlich schwere Gewissensbisse. Nicht sosehr deswegen, weil er so hart mit ihr gewesen war, sondern deshalb, welche Folgen für ihn erwachsen konnten, wenn Kerstin über die nächtlichen Vorgänge sprechen würde.
Bei dem Gedanken, dass sie tot sein könnte, verspürte er doch eine menschliche Regung. Zwar nur eine flüchtige, aber immerhin doch eine. Ihm wäre es lieber, eine lebendige Kerstin, die gewagt hatte, ihn zurückzuweisen zu demütigen, als einer toten Kerstin einen Nachruf zu widmen.
Im Atelier wusste man schon Bescheid, als er eintraf. Die Polizei war schnell gewesen und hatte Erkundigungen eingezogen. Tonio Laurentis wurde schweigend empfangen, aber mit einer sehr deutlichen Aggressivität, die ihn stutzig werden ließ.
»Was ist denn los?«, fragte er in seinem gewohnten leichten Tonfall.
»Kerstin ist verunglückt«, erwiderte Benno Deubler, der nie eine so gute Meinung von seinem Chef hatte wie Kerstin.
»Bin ich etwa daran schuld?«, fragte Tonio spöttisch. »Was hat man so gehört?«
»Wir haben in der Klinik angerufen, aber Besuche sind nicht gestattet.«
Insgeheim atmete Tonio auf. Zu den Mitarbeitern konnte Kerstin also nichts sagen, und er war heraus aus dem Dilemma, weil der Unfall passiert war, bevor sie erfahren konnten, dass er Kerstin vor die Tür gesetzt hatte. Er konnte einfach sagen, dass ihr Verstand durch den Schock verwirrt worden sei. Er konnte vorerst Zeit gewinnen.
»Ich werde mich selbstverständlich um Kerstin kümmern«, sagte er. »Aber wir wollen die Arbeit darüber nicht vergessen, meine Herren.«
Er machte sich am frühen Nachmittag auf den Weg zur Klinik. Er hatte sich schon zurechtgelegt, wie er Kerstin versöhnlich stimmen könnte. Stets von sich und seiner Wirkung überzeugt, hatte Tonio Laurentis nicht die geringsten Skrupel, Kerstins augenblickliche Hilflosigkeit auszunützen, denn er wusste sehr gut, wie prekär ihre finanzielle Situation durch den Kauf der Wohnung war.
Dass er eine eindrucksvolle Persönlichkeit war, ließ sich nicht leugnen. Oberschwester Erika war für so viel umwerfende Männlichkeit sehr empfänglich, aber den Anordnungen ihres Chefs wagte sie doch nicht zuwiderzuhandeln.
»Frau Torstensen darf keine Besuche empfangen«, erklärte sie. »Dazu müsste der Chefarzt schon persönlich die Erlaubnis erteilen.«
»Na, dann fragen wir ihn doch«, sagte Tonio leger.
»Ich werde mein Möglichstes tun«, sagte sie mit einem Augenaufschlag, der aber völlig wirkungslos von ihm abprallte. Da musste eine Frau schon anders aussehen, wenn sie sein Wohlwollen erringen wollte. Aber er lächelte, und sie war hingerissen.
Professor Albrecht war mit Röntgenaufnahmen beschäftigt, als Oberschwester Erika hereingeschwebt kam.
»Ja, was ist?«, fragte er.
»Herr Laurentis möchte Frau Torstensen besuchen, dringend wie er sagt, und da ich mich an die Vorschriften halte …«
»Wenn Sie sich daran halten, warum schicken Sie ihn dann nicht weg?«, fragte er.
Sie errötete. »Solch einen Mann kann man nicht einfach wegschicken, Herr Professor. Er möchte Sie sprechen.«
Ein bisschen wunderlich ist sie schon, dachte er, aber für ihn zählte in erster Linie, dass sie tüchtig war, und da konnte man ihr nicht das Geringste nachsagen.
»In zehn Minuten«, erwiderte er. »Vertrösten Sie ihn.«
Indessen wurde Tonio Laurentis von einer anderen Schwester angehimmelt und weil sie jung und auch recht
hübsch war, betrachtete er sie mit größerem Wohlwollen.
Schwester Ruth wurde von seinem Blick fast vom Erdboden gehoben, aber da nun Dr. Schilling auftauchte, entschwand sie rasch, um ihre Hingerissenheit ihrer Kollegin Petra kundzutun.
»Er ist doch umwerfend«, wisperte sie verzückt.
»Wer? Dr. Schilling?« Petra würde so etwas nicht gefallen, denn auf Dr. Schilling hatte sie nicht nur ein, sondern gleich alle zwei Augen geworfen.
»Quatsch, was ist an dem schon dran«, sagte Ruth. »Tonio Laurentis, meine ich.«
»Wer ist denn das?«, fragte Petra.
»Den kennst du nicht? Der berühmte Architekt. Mein Vater hat schon mit ihm zusammengearbeitet.«
Petra lächelte maliziös. Ruths Vater war Maurer, und wie die »Zusammenarbeit« aussah, konnte sie sich vorstellen.
»Er ist hinreißend«, sagte Ruth schwärmerisch.
»Zu wem will er denn?«, fragte Petra.
»Zu Frau Torstensen, das ist eine Angestellte von ihm.«
»Nur eine Angestellte?«, fragte Petra anzüglich.
Das Gleiche dachte auch Professor Albrecht, als ihm Tonio Laurentis dann gegenübersaß.
Ist er ihr Freund, ihr Verlobter, fragte er sich. Und er wunderte sich, dass er diesem Mann durchaus nicht wohlgesonnen war.
Er hatte schon von Laurentis gehört. Patienten hatten über ihn geredet, über die fantastische Wohnanlage, die er im Schlosspark gebaut hatte. Hingepilgert waren die Leute, als bekämen sie etwas geschenkt. Jedenfalls musste er etwas können und auch massenhaft verdienen. Und dass er blendend aussah, konnte auch Professor Albrecht nicht ignorieren. Ein Mann, der wohl allen Frauen gefiel.
Aber Kerstin Torstensen hatte es abgelehnt, Besuche zu empfangen, jeden, auch Tonio Laurentis. Sie musste ihre Gründe dafür haben. Welche Gründe?
Er spürte, wie der andere unter seinem forschenden Blick verlegen wurde.
»Es tut mir leid, aber ich kann keine Besuche bei Frau Torstensen gestatten«, sagte Professor Albrecht. »Sie müssen später einmal nachfragen, und sie muss ihre Einwilligung dazu geben.«
»Wir haben wichtige berufliche Dinge zu besprechen. Frau Torstensen ist seit zwei Jahren meine engste Mitarbeiterin«, sagte Tonio.
»Tut mir leid, ihr Zustand erlaubt keine langen Gespräche.«
»Wie schwer sind denn die Verletzungen?«, fragte Tonio.
»Wir müssen sie noch gründlich untersuchen. Heute Morgen war das nicht möglich.«
»Wieso nicht?«
»Um sie keiner weiteren Belastungen auszusetzen. Ich bedauere, Herr Laurentis, meine Zeit ist knapp bemessen. Fragen Sie morgen wieder nach.«
Er konnte verflixt kurz angebunden sein, und er ließ sich auch von einem Tonio Laurentis nicht beeindrucken.
»Dann sagen Sie ihr bitte meine Grüße und dass ich sehr auf ihre baldige Genesung hoffe. Ich brauche sie dringend.«
Kalt wie Hundeschnauze, dachte Professor Albrecht sarkastisch. Und seltsamerweise kam ihm wieder der Gedanke, was er in Kerstin Torstensens Leben für eine Rolle spielen könnte.
»Kommen Sie eigentlich gut mit Ihrem Chef aus?«, fragte Tonio die Oberschwester im Vorübergehen. Aber bevor sie irgendetwas erwidern konnte, war er schon an ihr vorbei und ihr schenkte er keinen freundlichen Blick.
Oberschwester Erika fand ihn nicht mehr so umwerfend. Außerdem stand der Chef ihr näher. Da Tonio Laurentis anscheinend etwas an dem Professor auszusetzen hatte, entzog sie ihm sofort ihre Sympathie. Was ging sie denn dieser arrogante Architekt an?
Sie sagte es ihrem Chef mit anderen Worten. Er lächelte flüchtig.
»Man sollte frei von Vorurteilen sein, Oberschwester Erika«, sagte er hintergründig. Dann ging er nochmals zu Kerstin Torstensen.
Diesmal lehnte sie mit geschlossenen Augen im Bett. Ihre Gedanken waren wieder bei der vergangenen Nacht, bei den demütigendsten Minuten ihres Lebens. Ihr Stolz rebellierte.
Professor Albrecht setzte sich an ihr Bett und griff nach ihrem Handgelenk. Ganz mechanisch fühlte er ihren Puls.
»Ihr Chef war hier«, sagte er beiläufig. Er spürte ein Erschrecken.
»Wieso?«, fragte Kerstin. »Haben Sie ihn benachrichtigt?«
»Ich wusste gar nicht, wer Ihr Chef ist«, erwiderte er nachsichtig. »Die Polizei ist natürlich schon fest bei den Ermittlungen. Herr Laurentis wollte Sie besuchen.«
»Wozu?«, stieß Kerstin hervor, und das machte ihn wiederum stutzig.
»Ich soll Ihnen Grüße ausrichten und die Hoffnung ausdrücken, dass er Sie bald gesund sieht. Er braucht Sie nötig.«
»Dieser erbärmliche Schuft«, entfuhr es ihr, doch dann biss sie sich erschrocken auf die Lippe.
Er zögerte einen Augenblick, dann sagte er: »Ich will mich nicht in Ihr Vertrauen drängen, aber wenn Sie den Besuch von Herrn Laurentis nicht wünschen, werde ich entsprechende Anordnungen geben.«
»Danke, nein, ich wünsche den Besuch dieses Herrn nicht«, sagte Kerstin. »Überhaupt keinen Besuch, abgesehen von Ihrem Sohn, wie ich es schon sagte.«
Sie weiß, was sie will, aber vielleicht will sie nur nicht bemitleidet werden, dachte Professor Albrecht. Klug wurde er nicht aus Kerstin.
»Sie werden noch heute Abend umgebettet werden«, sagte er ablenkend. »Das Zimmer ist frei geworden. Es ist übrigens unser schönstes.«
»Nur keine Extravaganzen«, sagte Kerstin. »Vielleicht kann ich nicht einmal Ihr Honorar zahlen, Herr Professor.«
Er wurde unter ihrem Blick schrecklich verlegen. Und im Augenblick war er aus der Fassung gebracht. Dann gewann er aber seine Selbstsicherheit zurück.
»Es wäre wohl noch schöner, wenn ich Ihnen eine Rechnung stellen würde, dafür, dass mein Sohn Sie gefährdet hat«, sagte er.
Mit einem merkwürdig ernsten Blick sah sie ihn an.
»Ich sage es noch einmal mit allem Nachdruck, ich habe den Unfall verschuldet. Am Steuer muss man sich nur auf den Verkehr konzentrieren. Ich habe die Ampel überhaupt nicht bemerkt.«
Was war das für ein seltsames Geschöpf. Sie hatte schwere Verletzungen erlitten, ihren Wagen eingebüßt und dadurch auch noch großen finanziellen Verlust, wenn sie auf ihrem Standpunkt beharrte.
»Dann möchte ich Ihnen sagen, dass ich in einer Haftpflichtversicherung bin«, erklärte er.
»Und denken Sie nicht daran, welchen seelischen Schaden es bei Ihrem Sohn anrichten könnte, verantwortlich gemacht zu werden? Was sagt Ihre Frau dazu, Herr Professor Albrecht?«
Er sah an ihr vorbei. »Stefans Mutter ist tot«, erwiderte er leise. »Ich trage für meinen Sohn die alleinige Verantwortung.«
»Dann helfen Sie ihm, über diesen Schrecken hinwegzukommen.«
Sie sagte nichts mehr. Ihr Gesicht war wieder ganz verschlossen. Es war nicht der Unfall allein, der ihr einen Schock versetzt hatte. Professor Albrecht fühlte es. Er nahm ihre Hand und zog sie an seine Lippen.
»Ich bedanke mich in Stefans Namen für Ihre Großmut«, sagte er leise.
*
Stefan und Lenchen waren ein Herz und eine Seele. Der Junge war richtig enttäuscht, als sein Papi ihn dann gegen sieben Uhr abholte, obgleich es wirklich schon reichlich spät war.
»Besuchst mich wieder, Stefan«, sagte Lenchen liebevoll. »Ist ja so ein herziger Bub, Herr Professor.«
Nun war der »herzige Bub« eher ein Häufchen Unglück, denn daheim war ja Tante Hella.
Aber dann konnte er nur noch staunen, denn sie empfing ihn überschwänglich, sagte »mein Liebling« und zerdrückte sogar ein paar Tränen.
Vater wie auch Sohn waren sprachlos. Und dann flötete Hella in den höchsten Tönen.
»Es tut mir ja so leid, Martin, dass ich mich so dumm benommen habe, aber du wirst verstehen, welche Angst ich um unseren Jungen ausgestanden habe.«
»Ich bin aber nicht dein Junge, ich bin Papis Junge«, fiel Stefan ihr ins Wort, da er so viel Falschheit nicht ertragen konnte und sein Instinkt ließ ihn aber jetzt nicht im Stich.
»Mein armer Kleiner, was bin ich froh, dass dir nichts Schlimmeres widerfahren ist«, fuhr Hella jedoch im gleichen theatralischen Ton fort. »Ich weiß ja, dass du immer vorsichtig bist und keine Schuld hast.«
»Ich hatte aber Schuld«, sagte er trotzig.
»Nein, nein, sag das nicht, mein Kleiner. Komm jetzt, ich habe dir dein Lieblingsessen gemacht.«
»Ich habe bei Lenchen gegessen«, erwiderte er bockig. »Und jetzt will ich ins Bett.«
Hella schluckte, behielt aber ihr süßliches Lächeln bei.
»Ich habe jetzt nämlich auch mal Migräne«, sagte Stefan noch triumphierend und lief eilends zu seinem Zimmer.
»Du siehst, wie schwer er es mir macht«, sagte Hella nun spitz zu ihrem Schwager. »Ich bringe ihm alle Liebe entgegen, aber er stößt mich immer wieder vor den Kopf.«
»Kinder haben ihren eigenen Instinkt, Hella«, erklärte Martin Albrecht.
»Ich will nicht mit dir streiten, Martin. Stefan ist auch das Kind meiner einzigen, lieben Schwester. Mein ganzes Herz hängt an ihm.«
»Ich will auch nicht streiten, Hella, aber ich bin fest entschlossen, eine Kraft zu engagieren, die Stefan korrekt versorgt. Ich lasse dir Zeit, Entscheidungen über dein künftiges Leben zu treffen und bin bereit, dir bei einem neuen Start zu helfen, aber unsere Wege müssen sich trennen. Ich möchte auch nicht, dass du dich noch länger falschen Hoffnungen hingibst. Ich werde dich nicht heiraten. Es tut mir leid, dass ich es so deutlich sagen muss, aber einmal muss es gesagt werden.«
»Ah, so ist das. Du willst eine andere Frau ins Haus bringen. Du willst Irenes Sohn eine Stiefmutter geben«, rief sie mit flammender Empörung.
»Davon kann gar keine Rede sein. Benimm dich nicht so albern. Du solltest doch genau wissen, dass es keine Frau in meinem Leben gibt, aber ich will in meinem Hause meine Ruhe haben.«
Hella zog es vor zu schweigen. Sie musste erst zu anderen Überlegungen kommen. Mit Worten war es nicht getan, das hatte sie begriffen. Aber sie dachte nicht daran, das Feld zu räumen, dieses sorglose Leben aufzugeben. Ihre besten Jahre hatte sie geopfert. Das wollte sie Martin doch bei einer anderen Gelegenheit einmal klarmachen. Und wenn doch eine andere Frau dahintersteckte, nun, dann sollte sie ruhig wissen, dass mit Hella Günther zu rechnen war. Insgeheim ballte sie schon kampfbereit die Hände.
»Nun, ich denke, wenn es dir recht ist, wird Stefan ein paar Tage von der Schule daheim bleiben«, sagte sie mit gekünstelter Ruhe.
»Ein Tag genügt. Ich nehme ihn morgen mit in die Klinik.«
Sie sah ihn überrascht an, dann senkte sie aber schnell den Blick.
»Du willst ihn vorsichtshalber sicher röntgen«, sagte sie.
»Ja«, brummte er. Sollte sie doch bei diesem Glauben bleiben. Warum er Stefan mit in die Klinik nehmen wollte, hätte er ohnehin nicht verraten.
*
Dr. Norden machte seinen letzten Arztbesuch. Er führte ihn zu einer Villa, die ganz in der Nähe von Professor Albrechts Haus lag, an dem er schon so oft vorbeigefahren war, ohne zu wissen, wem es gehörte. Heute nun wusste er es.
Es war ein Haus, das ihm gleich aufgefallen war, als er es zum ersten Mal gesehen hatte. Es hatte Stil.
Hoffentlich hat die böse Tante Hella dem Jungen nicht zu sehr zugesetzt, dachte Daniel, dann hielt er wenig später vor einem der hypermodernen Bungalows am Ende der Straße, von denen einer dem andern wie ein Ei glich.
»Endlich kommen Sie«, empfing ihn eine schlanke Frau mit hektisch geröteten Wangen. »Ich warte schon lange.«
»Tut mir leid, Frau Hanke, aber ich habe erst unterwegs erfahren, dass Sie angerufen haben«, erwiderte er ruhig.
»Christian hat entsetzlich hohes Fieber. In einem solchen Notfall müsste man doch erwarten, dass der Hausarzt sofort kommt.«
Solche Patienten gab es auch und nicht zu wenig. Dr. Norden kannte Frau Hanke. Sie rief ihn wegen jeder Bagatelle, wenn es um sie selbst ging. Bei ihrem Sohn war sie da nicht so schnell. Und dass es dem Jungen sehr schlecht ging, sah er sogleich.
»Dieses hohe Fieber kann Christian doch nicht erst seit einer Stunde haben«, stellte er fest.
»Schon ein paar Tage«, flüsterte der Junge apathisch. »Aber Mama hat gesagt, ich simuliere, weil ich nicht in die Schule gehen will.«
»War er heute etwa in der Schule?«, fragte Daniel.
»Es ging ihm nicht schlecht«, sagte Frau Hanke ungehalten. »Er schwänzt öfter. Da weiß man dann gar nicht mehr, ob ihm etwas fehlt oder nicht.«
In Daniel gärte es, aber er musste sich beherrschen. »Lungenentzündung«, sagte er. »Ich bin dafür, ihn in die Klinik zu bringen. Er muss ständig überwacht werden.«
»Das kann ich auch. Sein Vater wird nicht einverstanden sein, wenn er in die Klinik kommt.«
»Das werde ich mit Ihrem Mann besprechen, Frau Hanke«, sagte Daniel. Dann schob er sie aus dem Zimmer. »Christians Zustand ist bedenklich. Das kann ich Ihnen nicht verschweigen. Sie hätten mich sofort rufen müssen.«
»Und wenn ich Sie anrufe, kommen Sie nicht«, beschwerte sie sich,
»Ich bin sofort gekommen. Wir haben eine Grippeepidemie. Ich bin seit vier Uhr unterwegs, Frau Hanke. Aber wenn Sie heute vormittag angerufen hätten, wäre ich längst hiergewesen.«
»Das sagen Sie jetzt«, warf sie ihm vor.
Nun begann es in Daniel zu brodeln, doch er vermeinte Fees warnende Stimme zu hören, die da sagte: »Halt die Luft an, Daniel.« Fee hatte schon genug mit dieser Frau Hanke auszustehen gehabt, die es als persönliche Kränkung empfunden hatte, als »ihr« Dr. Norden Fee heiratete. Und nicht nur mit Frau Hanke war es ihr so ergangen. Doch deswegen konnte er den Jungen nicht im Stich lassen.
»Ich halte es für richtig, dass Christian schnellstens in die Klinik kommt und wenn Sie sich weigern, Frau Hanke, geben Sie es mir bitte schriftlich«, sagte er energisch.
Der Junge begann zu husten, und es kostete ihn gewaltige Anstrengung. Dr. Norden ging zum Telefon. Die Räumlichkeiten kannte er schon recht genau. Auch Herr Hanke war sein Patient, ein biederer braver Mann, der es vom einfachen Mechaniker zum Unternehmer gebracht hatte. Dies war seine zweite Frau: Christians Mutter war bei der Geburt gestorben, und er hatte eine Stiefmutter im sprichwörtlichen Sinne bekommen.
Dies alles war nebensächlich in diesem Augenblick. Christians Leben stand auf dem Spiel, für Dr. Norden war es die dritte dramatische Situation an diesem Tage und während er den Krankenwagen herbeirief, dachte er entsagungsvoll, dass aller schlechten Dinge drei wären, und nicht der guten Dinge.
Christian war jedenfalls kein Fall für die Behnisch-Klinik, er musste in das Kinderspital gebracht werden. Bei Dr. Derringer würde er in guten Händen sein.
Frau Hankes Gerede war verstummt. Unter halbgeschlossenen Lidern sah sie Dr. Norden an.
»Wenn Christian mich nicht so oft hinters Licht geführt hätte, wäre das nicht passiert«, sagte sie. »Aber es ist so wie bei den Hunden. Wenn sie unnütz bellen, hört man nicht mehr darauf.«
Daniel fand es impertinent, ein krankes Kind mit einem Hund zu vergleichen.
Es war schon komisch. Man sagte den Ärzten immer nach, dass einer den andern decken würde, wenn mal ein Fehler unterlief und in vielen Fällen mochte dies auch zutreffen. Aber wenn sich ein Arzt einer aufdringlichen Patientin erwehren musste und die wollte ihm einen Strick drehen, dann war die öffentliche Meinung auch gegen den Arzt, obgleich er keine Schuld trug.
»Wann kommt Ihr Mann heim?«, fragte er.
»Gar nicht. Er ist verreist«, erwiderte Frau Hanke gereizt.
Eigentlich hätte er sich das denken müssen, denn Herr Hanke hätte seinen einzigen Sohn bestimmt nicht in Lebensgefahr geraten lassen. Er war ein fürsorglicher Vater, wenn seine Geschäfte ihn auch mehr als genug beanspruchten.
Und in diesem Zusammenhang musste Daniel wieder an Professor Albrecht denken.
Und dann, als Christian in der Klinik untergebracht war und Dr. Derringer sich um ihn bemühte, dachte Daniel auch wieder an den dramatischen Anfang dieses Tages. Auf jeden Fall musste er sich noch erkundigen, wie es Frau Fichte ging.
*
Es war fast elf Uhr, als er heimkam. Fee hatte es sich bequem gemacht, aber sie war noch putzmunter, obgleich auch sie einen anstrengenden Tag hinter sich hatte.
»Da reden sie immer davon, dass es zu viele Ärzte gibt«, sagte sie, nachdem sie ihren Mann mit einem zärtlichen Kuss begrüßt hatte, der ihn mit aller Unbill des Tages versöhnte. »Diesmal war es wohl kein Fehlalarm bei Frau Hanke?«
»Christian hat Lungenentzündung. Diese grässliche Frau hätte mich viel früher rufen müssen.«
Wenn er mal so harte Ausdrücke in den Mund nahm, musste es schon sehr schlimm sein. Fee war besorgt. »Sie ist eben eine Stiefmutter. Es gibt solche immer noch.«
»Wir wollen nicht sagen, dass alle Mütter fürsorglich sind, aber mit ihr hat Herr Hanke sich wahrhaftig vergriffen. Ich habe den Jungen in die Klinik bringen lassen, obwohl sie fast geplatzt ist. Wenn sie mir was anhängen kann, tut sie es, Fee.«
»Dann hänge ich ihr aber auch was an«, ereiferte sich Fee. »Ich habe sie neulich tête à tête mit unserem neuen Hausverwalter gesehen. Diese falsche Schlange. Sie giftet sich doch nur, weil du ihren Reizen nicht erlegen bist.«
»Hat sie denn welche?«, fragte Daniel sarkastisch. »Lassen wir das Thema. Ich hoffe nur, dass Christian noch mal davonkommt. Der Junge hat mir ohnehin schon genug Sorgen gemacht. Ich war dann schnell noch bei Frau Fichte«, fuhr er nach einer kurzen Pause fort. »Gott sei Dank geht es ihr besser. Sie spricht gut auf das fremde Blut an und auch auf die Infusionen.«
»Und das Kind?«, fragte Fee.
»Ist mobil. Ein kräftiges Kerlchen. Was diese kleinen Wesen doch zäh sind.«
»Und so muss man sich immer wieder fragen, woran es liegt, dass manche bei durchaus normalen Geburten doch nicht überleben«, sagte Fee gedankenvoll.
»Es ist ein großes Fragezeichen, Feelein. Bedenken wir, dass Jahrtausende eine Geburt einfach ein Naturereignis war und der Tod eines Kindes ebenfalls. Wie in der Natur, bei den Tieren, gab man den Schwachen keine Chance. Ein schwaches Kind war sogar als Makel betrachtet worden. Und wenn wir daran denken, was der gute Ignaz Semmelweis vor hundert Jahren ausstehen musste, weil er die Ursache des Kindbettfiebers bei der Unsauberkeit unserer damaligen werten Kollegen und des Pflegepersonals entdeckte, müssen wir hübsch still sein. Meinst du, dass ein Gynäkologe zugeben würde, er hätte etwas versäumt? Aber wie wenig Zeit nehmen sich die meisten, um die werdenden Mütter genügend aufzuklären. Es gibt so viele Einflüsse, die dem werdenden Kind schaden können, von den organischen Beschwerden ganz abgesehen. Frau Fichte hat sich bei dem Umzug übernommen. Sie ist eine natürliche, gesunde Frau und hat kleine Anzeichen nicht tragisch genommen. Außerdem ist ihr Mann eine Mimose. Sie wollte ihn nicht aufregen. Ich habe noch ein paar Worte mit ihr sprechen können. Sie sorgt sich jetzt auch mehr um ihren Mann als um sich selbst. Ich bin froh, dass sie es schaffen wird, sonst gäbe es wieder einmal ein kleines Kind, das von seinem Vater für den Tod seiner Mutter verantwortlich gemacht werden würde.«
»Ist Albrechts Frau eigentlich auch bei der Geburt des Jungen gestorben?«, fragte Fee.
»Das weiß ich nicht. Aber jetzt ist Schluss für heute, Liebes. Ich bin todmüde.«
Doch bevor er einschlief, murmelte er noch: »Freitag, der Dreizehnte. Und da soll man nicht abergläubisch werden.«
Fee gab ihm einen ganz weichen, zärtlichen Kuss.
*
Am nächsten Morgen erwachte Stefan von selbst, aber als er auf die Uhr schaubte, erschrak er. Er würde heute wieder nicht pünktlich zur Schule kommen. Heiß und kalt lief es ihm über den Rücken, aber dann erinnerte er sich, dass sein Papi gesagt hatte, er wollte ihn mit in die Klinik nehmen.
Sein Herzklopfen legte sich. Er stand auf, wusch sich ordentlich und kleidete sich an. Staunend riss er die Augen auf, als er den Frühstückstisch gedeckt vorfand, in der Küche Geräusche hörte.
Fassungslos stand er Hella gegenüber, denn sie war angekleidet und nicht in einem ihrer komischen Negligés.
»Guten Morgen, mein kleiner Liebling«, sagte sie. »Geht es dir wieder gut?«
»Kleiner Liebling« wollte Stefan nun gewiss nicht von ihr genannt werden, aber er war sprachlos und konnte nicht protestieren.
Es reichte gerade dazu, dass er auch guten Morgen sagen konnte, dann lief er zu seinem Papi, der gerade beim Rasieren war. Das fand Stefan immer noch höchst interessant.
Er drückte ihm einen Kuss auf den Arm, weil das Gesicht eingeseift war.
»Ab wann muss man sich eigentlich rasieren?«, fragte er.
»Wenn man einen Bart bekommt«, erwiderte Martin.
»Und wann bekommt man den?«
»Das lässt sich nicht voraussagen. Einer bekommt ihn früher, der andere später.«
»Wann hast du einen Bart bekommen, Papi?«
»Als ich achtzehn war. So ungefähr. Ich erinnere mich nicht mehr genau.«
»Du, Papi, stell dir vor, Tante Hella ist schon auf und angezogen. Nicht in so ’nem Tüttelkleid«, lenkte Stefan ab.
»Soso«, brummte Martin. Auf die Art kommt sie jetzt also, dachte er für sich.
»Und der Frühstückstisch ist auch schon gedeckt. Ich bin einfach baff«, sagte Stefan.
»Ich auch«, gab Martin zu.
»Da steckt doch was dahinter«, vermutete der Junge richtig.
»Mag sein, aber bei uns wird sich manches ändern. Dennoch«, erklärte Martin sehr bestimmt.
»Komme ich nun in ein Internat?«, fragte Stefan ängstlich.
»Aber nein. Wir haben uns doch versprochen, immer zusammenzubleiben. Ich hoffe, dass Tante Hella uns bald verlässt.«
Stumm sah Stefan seinen Vater eine ganze Weile an. »Das tut sie nicht«, sagte er. »So gut geht es ihr doch nicht wieder, oder meinst du, ein anderer erträgt ihre Migränen?«
Wie scharfsinnig der kleine Bursche war. Martin hatte auch schon seine Bedenken, dass selbst sein Ultimatum nichts fruchten würde.
»Wenn sie doch bloß einen finden würde, der sie heiratet«, sagte Stefan. »Aber so doof ist ja keiner. Vielleicht unser Lehrer Holzner? Der ist auch dauernd so miesepetrig. Der würde gut zu ihr passen.«
Martin kannte den Lehrer Holzner. Mit dem würde sich seine Schwägerin Hella bestimmt nicht zufriedengeben.
»Laß dich mal anschauen, Stefan«, schlug er ein anderes Thema an, weil ihm das jetzige ein bisschen zu gefährlich schien. »Bist du auch okay für einen Besuch bei Frau Torstensen?«
»Denke schon, Papi. Ich habe mich mächtig gewaschen und Zähne geputzt. Habe ich das Haar auch richtig gekämmt?«
Er sah recht ordentlich aus.
Richtig brav und bildhübsch, wie Martin Albrecht mit väterlichem Stolz feststellte.
Er war seiner Großmama auf eine unglaubliche Weise ähnlich, aber wenn Martin an seine Mutter dachte, die vor drei Jahren an einer schweren Herzkrankheit gestorben war, wurde es ihm immer schwer ums Herz.
Ja, wenn Mama noch leben würde, ging es ihm durch den Sinn, doch der tiefernste Blick seines Sohnes brachte ihn schnell in die Wirklichkeit zrück.
»Jetzt denkst du wieder an Omi, ich weiß schon«, sagte Stefan leise. »Wenn doch Omi bei uns geblieben. wäre. Der liebe Gott ist manchmal so ungerecht, Papi.«
Ganz schnell beugte sich Martin über das Waschbecken und ließ das kalte Wasser über sein Gesicht rinnen.
»Niemand kann gegen das Schicksal an, mein Junge«, sagte er dann leise hinter dem Handtuch hervor, mit dem er sich abtrocknete.
»Und nun müssen wir mit Tante Hella frühstücken«, murrte Stefan. »Da bleibt mir eh gleich der Bissen im Halse stecken.«
Martin erging es nicht viel anders. Man sah es Hella an, dass sie sich sehr beherrschen musste, um nicht wieder aufzubrausen. Aber Martin verließ mit seinem Sohn dann sehr schnell das Haus.
Sie fuhren noch zu einem Blumengeschäft.
»Was wollen wir denn nehmen, Stefan?«, fragte Martin, und insgeheim fragte er sich, welche Blumen wohl zu Kerstin Torstensen passen mochten. Am besten wohl ein bunter Frühlingsstrauß.
Ohne dass er es gesagt hätte, entschied sich auch Stefan dafür und er war sehr wählerisch. Die Verkäuferin nahm lächelnd die Blumen entgegen, die er aus den Vasen zog.
»Du hast aber einen guten Geschmack«, sagte sie lobend.
»Sie sollen schön und frisch sein. Aufhängen lass ich mir nichts«, erklärte er.
Blumen liebte er über alles. Er sorgte dafür, dass ihre Blumen im Haus und im Garten immer richtig gegossen wurden. Hella kümmerte sich darum nicht.
Auch Martin musste anerkennen, dass sein Sohn ganz genau wusste, was er wollte. Es rührte ihn tief, wie er aufpasste, dass die Blumen auch schön gebunden wurden.
»Habt ihr Vasen, Papi?«, fragte er.
»Ich denke schon«, erwiderte Martin.
»Eigentlich würde ich gern den bunten Krug nehmen. Den dort. Er gefällt mir.«
Es war ein teurer Krug, aber Martin nickte der Verkäuferin zu.
»Du kriegst das Geld nachher wieder. Ich habe mein Sparschwein ganz vergessen«, sagte Stefan.
Vorsichtig trug Stefan die Blumen vor sich her, Martin den Krug, als sie die Klinik betraten. Die Schwester am Empfang sprang gleich auf.
Professor Albrecht winkte ab. »Du wirst noch warten müssen, bis die Visite beendet ist, Stefan«, sagte er.
»Macht nichts, Papi, Hauptsache, ich muss nicht zu Hause bei Hella sein«, erwiderte der Junge.
»Setz dich zu Schwester Petra«, sagte Martin. »Sie ist nett.«
Stefan warf seinem Vater einen schrägen Blick zu. »Hübsch auch?«
»Schau sie dir an. Ich kenne deinen Geschmack noch nicht«, sagte Martin lächelnd.
Stefan fand Schwester Petra ganz nett, aber Dr. Schilling gefiel ihm noch mehr, obgleich Schwester Petra ihn verwöhnte.
»So möchte ich auch mal verwöhnt werden«, sagte Dr. Schilling mit einem humorvollen Augenzwinkern zu der jungen Schwester.
Stefan fand das recht lustig, aber so ganz im Innern hatte er doch ein bisschen Angst, weil er sich gar nicht vorstellen konnte, dass Frau Torstensen nett zu ihm sein könnte, und wenn er auch noch so schöne Blumen mitbrachte.
Er war ganz froh, dass Schwester Petra sich jetzt mehr um Dr. Schilling kümmerte als um ihn, und dann war seine Wartezeit endlich rum und sein Papi holte ihn.
*
Kerstin war von Professor Albrecht auf den Besuch vorbereitet worden. Ihr Blick war auf die Tür gerichtet, durch die der Junge jetzt hereinkam, von dem riesigen Blumenstrauß fast verdeckt.
Schwester Petra folgte mit dem wassergefüllten Krug. Sie wollte Stefan die Blumen aus den Händen nehmen, aber er machte eine unwillige Bewegung. »Ich stelle sie selbst ins Wasser«, sagte er.
Schwester Petra verschwand wieder. Stefan sah Kerstin kummervoll an.
»Es tut mir so leid«, flüsterte er. Dann stellte er die Blumen vorsichtig in den Krug.
»Der Krug gehört Ihnen auch«, sagte er. »Dass ihn keiner wegnimmt.«
»Er ist wunderschön«, sagte Kerstin und in ihrer Stimme war ein weiches, zärtliches Schwingen.
»Ja, er hat mir gefallen. Die Blumen habe ich auch selbst ausgesucht. Haben Sie Blumen auch gern?«
»Sehr gern, Stefan. Und das sind wunderschöne Blumen, ich danke dir.«
»Ich muss Sie sehr viel um Verzeihung bitten«, sagte Stefan. »Tut es sehr weh?«
»Gar nicht. Dein Papi versorgt mich sehr gut.«
Sie streckte ihm ihre Hand entgegen, die er zaghaft ergriff, und dann machte er seine schönste Verbeugung.
»Ich wollte in die Schule«, flüsterte er. »Ich war schon zu spät dran.«
»Und ich habe nicht aufgepasst«, sagte Kerstin. »Ich war schuld, Stefan.«
»Das darfst du nicht sagen.« Er fand, dass es viel einfacher war, du zu sagen und dachte sich dabei nichts, denn Kerstin sah ihn ja so lieb an. »Du hast dich mächtig erschrocken. Ich habe dein Gesicht gesehen.«
»Vergiss es.«
»Kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht.« Tränen drängten sich in seine Augen. »Du hättest gestorben sein können«, flüsterte er. »Und das ist ganz schrecklich. Dann kann man nie mehr sagen, wie leid es einem tut. Meine Omi ist nämlich auch gestorben und ich habe nicht sagen können, wie ganz furchtbar lieb ich sie gehabt habe.«
Zärtlich glitten Kerstins Finger durch sein Lockenhaar, und ein ganz eigentümliches Gefühl bewegte sie.
Wofür lebte sie eigentlich, wenn sie kein Kind hatte? Für wen all der Ehrgeiz? »Ich lebe, und es geht mir gut, Stefan«, sagte sie.
»Und du bist mir nicht böse?«
»Ich bin froh, dass du wohlauf bist.«
Er sah sie lange und nachdenklich an. »Wie ich dich gesehen habe, hast du wie ein Geist ausgesehen, aber jetzt siehst du aus wie eine Prinzessin aus dem Märchen.«
»Das ist das hübscheste Kompliment, das ich je gehört habe«, sagte Kerstin mit einem weichen Lächeln.
»Hat Papi dir noch nicht gesagt, dass du sehr schön aussiehst?«, fragte Stefan naiv.
»Du lieber Himmel, das wäre wohl ein bisschen viel verlangt«, sagte sie und lachte herzhaft auf, aber dieses Lachen verursachte ihr einen stechenden Schmerz in der Brust und sie ächzte leise.
»Tut es weh?«, fragte Stefan aufgeregt. »Ich rufe gleich Papi.« Und ehe sie fähig war, etwas zu sagen, war er schon an der Tür und rief lautstark nach seinem Vater.
Martin war doch in Sorge gewesen, dass der Besuch nicht ganz reibungslos verlaufen könnte – und sofort zur Stelle, als er die ängstliche Stimme seines Sohnes vernahm.
Besorgt beugte er sich über Kerstin. »Es war nur ein Augenblick. Ich musste lachen, und das tat weh.«
Martin sah seinen Sohn mahnend an. »Frau Torstensen hat ein paar Rippen gebrochen, da darf sie nicht lachen«, sagte er mahnend.
»Das kann Stefan doch nicht wissen«, sagte Kerstin.
»Das hättest du mir auch sagen müssen, Papi«, sagte Stefan, »und außerdem konnte ich nicht wissen, dass Frau Torstensen lacht.«
»Verabschiede dich jetzt«, sagte Martin.
»Aber warum denn?«, fragte Kerstin. »Bitte nicht. Stefan trifft doch keine Schuld, wenn ich lache. Er ist so lieb.«
»Und ich habe sie bloß gefragt, ob du ihr noch nicht gesagt hast, dass sie schön ist, Papi.«
Das Blut stieg Martin in die Stirn, aber wie sollte er sich dazu äußern, da Stefan ihn so unschuldvoll anblickte.
»Dazu hatte ich noch keine Gelegenheit, und außerdem darf ein Arzt so etwas nicht zu einer Patientin sagen.«
»Warum denn nicht?«, fragte Stefan.
Zum Glück wurde der Professor jetzt von Oberschwester Erika zu einem Patienten gerufen. Stefan durfte weiterhin bei Kerstin bleiben, und nun erkundigte er sich erst einmal, wie er sie nennen dürfe.
»Sag ruhig Kerstin zu mir. Frau Torstensen ist zu lang. Außerdem bin ich nicht verheiratet.«
»Nein, das finde ich sehr gut. Tante Hella ist auch nicht verheiratet, aber sie will, dass man Frau zu ihr sagt. Sie ist auch schon viel älter als du.« Ein Seufzer schloss sich an, der wohl ausdrücken sollte, wie wenig er Tante Hella zugeneigt war, dann fuhr er rasch fort: »Ein Arzt hat schon viel zu tun. Er kann sich nicht mal richtig unterhalten. Aber Papi ist ein guter Arzt, findest du auch, Kerstin?«
»Ein sehr guter Arzt sogar. Du siehst ja, wie schnell er mich wieder gesund macht.«
»Das wäre ihm aber auch ganz arg gewesen, wenn es noch schlimmer gewesen wäre, wo er doch wusste, dass ich schuld war.«
»Du sollst das nicht sagen, Stefan. Jeder Autofahrer ist verpflichtet, auf Kinder besonders Obacht zu geben.«
»Aber wenn die Kinder nicht aufpassen, kann er nicht schuld sein«, sagte Stefan. »Du bist sehr lieb, Kerstin, und ich schenke dir noch mal was ganz Schönes. Ich muss mich für so viel bedanken bei dir, auch dass ich Dr. Norden kennengelernt habe deswegen, und dass ich darum Lenchen besuchen darf und nicht immer zu Hause bei Tante Hella sein muss.«
Zu gern hätte Kerstin etwas mehr von dieser Tante Hella erfahren, aber Stefan fand das Thema nicht schön. Er wollte sich mit Kerstin lieber über andere Dinge unterhalten, und als dieser Besuch dann doch beendet werden musste, weil Kerstin ärztlich versorgt werden sollte, war er sehr betrübt.
»Du kannst mich ja morgen wieder besuchen«, sagte sie.
»Darf ich? Aber vormittags muss ich zur Schule.«
»Sonntags auch?«, fragte sie mit einem verschmitzten Lächeln.
Seine Augen leuchteten auf. »Ach, morgen ist ja Sonntag, das habe ich ganz vergessen. Dann komme ich freilich.«
Er winkte ihr von der Tür immer noch zu und warf ihr auch noch eine Kusshand zu. Auf Kerstins Gesicht blieb ein glückliches Lächeln zurück.
Professor Albrecht hatte indessen die zweite Unterhaltung mit Tonio Laurentis geführt. Sie hatte in feindseliger Atmosphäre stattgefunden, nachdem der Professor erklärt hatte, dass Besuche bei Frau Torstensen nach wie vor nicht gestattet wären.
»Sie haben wohl allen Grund, Frau Torstensen abzuschirmen«, sagte Tonio anzüglich. »Es scheint, als wollten Sie vertuschen dass es Ihr Sohn war, der den Unfall verschuldet hat. Aber ich werde dafür sorgen, dass Frau Torstensen zu ihrem Recht kommt.«
Er konnte sich überzeugend aufspielen, und Professor Albrecht war sich im Klaren darüber, dass dieser Mann ein äußerst gefährlicher Gegner sein konnte, aber Kerstin Tortensen wollte nichts von ihm wissen und das zählte.
»Es gibt nichts zu vertuschen. Frau Torstensen wird zu ihrem Recht kommen«, sagte er ruhig. »Wenn Frau Torstensen bereit ist, Sie zu empfangen, werden wir Sie unterrichten.«
Er hatte nicht die geringste Neigung, seine kostbare Zeit für diesen Mann zu verschwenden. Wohl oder übel musste Tonio wieder den Rückzug antreten.
Als er am Parkplatz Schwester Ruth entdeckte, kam ihm ein Gedanke. Sie machte es ihm nicht schwer, ein Gespräch anzuknüpfen. Sie half sogar nach.
»Entschuldigen Sie die Frage, Herr Laurentis, aber würden Sie mich bitte mitnehmen, falls Sie in die Stadt fahren?«
»Aber gern«, erwiderte er mit seinem charmantesten Lächeln.
»Ich muss nämlich zum Zahnarzt«, erklärte sie. Das stimmte sogar, aber sie war jetzt doppelt froh, dass sie ihr hübschestes Kostüm angezogen hatte.
Mit einem schicken Mann in einem schicken Wagen, das gefiel ihr, und er brauchte sich nicht anzustrengen, um sie zum Reden zu bringen.
»Darf Frau Torstensen eigentlich gar keinen Besuch empfangen, oder hat Ihr Chef nur gegen mich etwas?«, fragte er beiläufig.
»Der kleine Albrecht war den ganzen Vormittag bei ihr«, sagte sie. »Der Sohn vom Professor«, setzte sie erklärend hinzu. »Mit einem riesigen Blumenstrauß. Nun ja, es ist dem Chef wahrscheinlich sehr fatal, dass sein Sohn es war, der ihr ins Auto lief.«
»Er leugnet es nicht?«, fragte Tonio.
»Nein, aber Frau Torstensen behauptet, dass sie in erster Linie schuld war.«
»Vielleicht hat Ihr Chef sie gekauft.«
Ruth sah ihn ziemlich verblüfft an. Das gefiel ihr nun doch nicht, sosehr ihr Tonio Laurentis auch gefiel.
»Er ist sehr korrekt«, sagte sie zurückhaltend, »und hätte Frau Torstensen das nötig?«
»Es kommt auf die Summe an. Geld spielt für sie eine große Rolle. Da wir uns nun so nett angefreundet haben, könnten wir uns doch einmal treffen, wenn Sie nicht gerade zum Zahnarzt müssen.«
Das schmeichelte ihrer Eitelkeit so sehr, dass das Misstrauen wieder verflog. Was würden ihre Kolleginnen sagen, wenn sie sich mit dem berühmten Tonio Laurentis traf. Ihr Herz schlug höher. Ihr Selbstbewusstsein war groß genug, um sich zu sagen, dass sie ihm gefiele.
»Warum nicht«, sagte sie. »Morgen hätte ich frei.«
»Schade«, sagte er. »Ich muss heute noch unbedingt nach Zürich fahren, und gerade deswegen hätte ich Frau Torstensen dringendst sprechen müssen. Vielleicht versuche ich es am Nachmittag doch noch mal.«
»Aber heute Nachmittag ist der Chef nicht im Hause«, sagte Ruth.
»Sie auch nicht?«
»Freilich bin ich da. Ich muss mich jetzt höllisch beeilen. Mein Zahnarzt nimmt mich ausnahmsweise an. Dann sehen wir uns heute Nachmittag vielleicht? »
»Bestimmt sogar«, sagte er mit einem undeutbaren Lächeln, bei dem ihr ein Kribbeln über den Rücken lief. »Sie sind reizend, Ruth«, sagte er auch noch.
Da mussten doch alle Zweifel schwinden. Warum sollte er denn Frau Torstensen nicht besuchen, wenn es doch so wichtig für ihn war. Ruth war ganz überzeugt, dass nur geschäftliche Interessen diese beiden verbanden und dass sie selbst ganz große Chancen bei ihm hatte.
*
Auf der Heimfahrt erzählte Stefan unentwegt von Kerstin.
»Man kann sich sehr gut mit ihr unterhalten, Papi«, versicherte er. »Ich glaube, dass sie sehr gescheit ist. Ich möchte sie morgen wieder besuchen, das geht doch?«
Martin Albrecht kämpfte mit zwiespältigen Gefühlen. Er konnte Tonio Laurentis nicht aus seinem Gedächtnis streichen.
Was war zwischen diesem Mann und Kerstin vorgefallen? Mit Abscheu hatte sie diese Bemerkung gemacht, die ihm im Gedächtnis haften geblieben war. Aber warum hatte es dieser Mann gar so eilig, sie zu besuchen?
»Warum bist du so still, Papi?«, fragte Stefan. »Gefällt es dir nicht, dass ich mit Kerstin vertraut bin?«
»Doch es gefällt mir sehr.«
»Möchtest du nicht auch mit ihr vertraut sein? Du siehst sie doch jeden Tag.«
»Sie ist eine Patientin und da darf man nicht vertraut sein.«
»Das ist komisch.«
»Das ist eine Vorschrift, mein Sohn.«
»Deshalb darfst du ihr auch nicht sagen, dass sie schön ist, gell? Du findest sie doch auch schön.«
»Ja, ich finde sie schön, aber nun reden wir mal von was anderem.«
»Wie lange muss Kerstin denn noch in der Klinik bleiben?«, fragte Stefan.
»Bestimmt noch zwei Wochen.«
Stefan seufzte. »Aber wenn sie dann draußen ist, kannst du doch auch mit ihr vertraut sein, gell?«, bohrte er.
»Wir werden mal zusammen zum Essen gehen, wenn sie zustimmt«, sagte Martin, um seinen Sohn zu beschwichtigen.
»Und was wird nun eigentlich mit ihrem Auto?«, fragte Stefan. »Kann man das ganz machen?«
»Ich werde mich darum kümmern.«
»Ich würde ihr ja ein neues kaufen, aber dazu reicht mein Geld wohl nicht«, sagte Stefan betrübt.
Was wird sie machen, wenn sie wieder gesund ist, ging es Martin durch den Sinn. Wieder mit Laurentis zusammenarbeiten, mit diesem Mann, den sie als Schuft bezeichnet hat?
»Wir fahren ja gar nicht nach Hause«, sagte Stefan.
»Nein, wir fahren zum Jagdhof zum Essen«, erwiderte Martin. Hella sollte ruhig spüren, dass er nicht bereit war, ihre hinterlistigen Annäherungsversuche zu akzeptieren.
*
Für Daniel und Fee brachte auch der Samstag eine Unmenge Arbeit. Das Telefon klingelte unentwegt, obgleich sie keinen Wochenenddienst hatten. Aber ein gewissenhafter Arzt konnte seinen Patienten nicht einfach sagen, dass er keinen Dienst hätte und sie den dafür zuständigen Kollegen bemühen sollten. In der Grippezeit waren alle Ärzte überlastet.
Daniel war schon am frühen Morgen von Herrn Hanke bestürmt worden, der außer sich war, dass sein Junge so schwer krank war und wie erwartet, hatte Frau Hanke die Schuld Dr. Norden zuzuschieben versucht. Daniel musste recht energisch werden, um dem aufgeregten Mann die Sachlage zu erklären. Er dachte nicht daran, Rücksicht auf Frau Hanke zu nehmen, und er fand auch Glauben.
»Es ist schon so, dass Christian die Schule manchmal schwänzt«, versuchte er seine Frau dennoch zu entschuldigen. »Edith hat es nicht leicht mit ihm, aber seine Großeltern haben ihm ja von Anfang an eingebläut, dass er von einer Stiefmutter nichts zu erwarten hätte.«
Notgedrungen musste Daniel sich eine ganze Zeit die Familienkalamitäten der Hankes anhören, bis er dann erklärte, Herr Hanke solle doch lieber in die Klinik fahren und sich an Ort und Stelle nach Christians Befinden erkundigen. Er hatte dies schon getan und erfahren, dass noch keine Besserung eingetreten sei, aber das wollte er Herrn Hanke nicht sagen, damit er nicht noch mehr aus dem Häuschen geriet. Eine Freude brachte ihm der Vormittag dann, als er sich überzeugen konnte, dass es mit Frau Fichte aufwärts ging.
Man hatte ihr am Morgen das Kind gebracht, und der Anblick dieses gesunden kleinen Burschen war wohl die beste Medizin gewesen. Auch Herr Fichte hatte sich nun halbwegs wieder gefangen, obgleich er versicherte, dass er diesen Dreizehnten nie vergessen würde.
»Ich auch nicht«, sagte Daniel lächelnd, »aber immerhin werden Sie den Tag doch künftig fröhlich feiern.«
»Wieso denn?«, fragte Herr Fichte verwirrt.
»Weil es der Geburtstag Ihres Sohnes ist«, lachte Daniel.
Herr Fichte schlug sich an die Stirn, und dann lachte er auch.
Fee hielt die Stellung in der Praxis, denn auch hier gab einer dem andern die Klinke in die Hand.
Zwischendurch rief ihr Vater an. Was denn bei ihnen los sei, wollte er wissen. Sie hätten bestimmt damit gerechnet, dass sie das Wochenende bei ihnen verbringen würden.
Dr. Johannes Cornelius leitete das Sanatorium »Insel der Hoffnung«. Er war Friedrich Nordens bester Freund gewesen. Er verwirklichte die Idee dieses großen Arztes und Menschenfreundes. Daniel wusste bei seinem Schwiegervater die Leitung in den besten Händen, und für Dr. Cornelius war es das größte Glück, dass Daniel und Fee ein Ehepaar geworden waren.
Auf der Insel gäbe es keine Grippe, sagte Dr. Cornelius.
»Aber leider können wir nicht alle unsere Patienten hinschicken, Paps«, meinte Fee.
Gegen zwölf Uhr kam Isabel Guntram hereingeplatzt, stockheiser und fiebrig.
Mit Isabel waren sie lange befreundet. Das heißt, zuerst war es Daniel gewesen, der sich mit der bekannten Journalistin angefreundet hatte, und Fee war sehr eifersüchtig gewesen, wenn auch grundlos, denn für Daniel war Isabel immer nur eine gute Freundin gewesen.
Die Eifersucht war längst vergessen. Isabel hatte ihr Herz an Dr. Jürgen Schoeller verloren, der als Assistenzarzt auf der Insel der Hoffnung tätig war.
»Gib mir ein Mittel, das sofort hilft, Fee«, krächzte Isabel.
»Du gehörst ins Bett«, sagte Fee streng.
»Da werde ich nur kränker. Ich will zur Insel fahren. Wolltet ihr das nicht auch?«
»Unmöglich. Habe eben schon mit Paps telefoniert. Du bist nicht die Einzige, die von der Grippe erwischt wurde, Isabel.«
»Ich habe keine Grippe. Ich bin nur heiser. Aber Jürgen regt sich auf, wenn mir was fehlt.«
»Und du meinst, dass du deine Heiserkeit auf dem Wege zur Insel auskurieren kannst?«, fragte Fee kopfschüttelnd. »Willst womöglich ein starkes Medikament nehmen und dich dann auch noch ans Steuer setzen? Das muss ich verbieten.«
»Hör mal, wie haben wir’s denn. Bist du meine Freundin oder nicht.«
»Weil ich deine Freundin bin, muss ich streng sein. Messen wir mal Temperatur.«
»Ach was, ich bin nur heiser«, sagte Isabel.
»Du hast Fieber«, erklärte Fee. »Und du wirst jetzt parieren, sonst gibt Jürgen mir die Schuld, wenn ich dich in solchem Zustand fahren lasse.«
»Wenn ich dort bin geht es mir wieder gut«, beharrte Isabel. »Diese Stadt macht mich verrückt.«
Früher hatte sie behauptet, ohne München nicht leben zu können, jetzt machte sie die Stadt verrückt. So konnte Liebe den Menschen verändern. Bei Fee war es umgekehrt. Sie hatte sich schwer an den Gedanken gewöhnen können, in der Stadt zu leben, nun liebte sie diese.
Fee steckte Isabel das Fieberthermometer in den Mund, doch da läutete es schon wieder.
Ein Patient wollte ein Vorbeugungsmittel gegen die Grippe verschrieben haben. Fee tat es.
Als sie wieder zu Isabel kam, hatte die das Thermometer zwar noch im Mund, aber Fee wusste nicht, dass sie es inzwischen herausgenommen hatte.
Kopfschüttelnd betrachtete es Fee. »Du bist ein Naturwunder, Isabel. Glühst wie ein Backofen und hast nur ein bisschen erhöhte Temperatur.«
»Ich hab’s dir doch gesagt«, erklärte Isabel, doch dann begannen ihre Zähne aufeinanderzuschlagen. Den Schüttelfrost konnte sie nicht wegleugnen und nun ahnte Fee auch schon, dass Isabel sie hatte täuschen wollen. Und sie erlebte zum ersten Mal eine weinende Isabel, als sie nun ganz energisch wurde.
»Was soll ich denn allein zu Haus in der tristen Bude im Bett«, flüsterte Isabel heiser.
Sie hatte eine bezaubernde Wohnung, aber dass sie diese als triste Bude bezeichnete, machte klar, wie einsam sie sich dort fühlte.
»Ich bring dich rauf in die Wohnung. Du legst dich ins Gästezimmer. Lenchen betreut dich. Ich rufe Jürgen an, und da es auf der Insel keine Grippe gibt, wird er kommen und dich liebevoll verarzten. Heul jetzt nicht, sonst steigt das Fieber noch mehr.«
Das wirkte. Isabel folgte, wurde von Fee hinaufbegleitet und ins Bett gesteckt. Lenchen kam gleich mit ihren Hausmitteln daher. Obgleich sie ihr Doktorehepaar überaus liebte, hielt sie doch nichts von neumodischen Methoden, und weder Daniel noch Fee hätten ihr diesbezüglich zu widersprechen gewagt. Immerhin wussten sie aus Erfahrung, dass auch Lenchen Heilerfolge mit ihren Kräutertees erzielte.
Fee rief Jürgen Schoeller an und brachte es ihm vorsichtig bei. Am späten Nachmittag könne er bei ihnen sein, sagte er.
Daniel kam nach Hause, aber gerade nur, um ein paar Bissen zu essen.
Die Neuigkeit beantwortete er mit dem Ausruf: »Liebe Güte, jetzt machen wir auch noch eine Privatklinik Dr. Norden auf.«
Isabel war völlig apathisch, aber es war jetzt vorwiegend Schwäche auf Lenchens Tee, nachdem sie schon heftig geschwitzt hatte.
»Überlass es Lenchen, sie zu versorgen, Feelein«, sagte Daniel mahnend. »Geh du nicht so nah an sie ran.«
»Ich bin immun«, erwiderte Fee lächelnd. »Wie viel Besuche musst du noch machen?«
»Ein Dutzend etwa. Ist nichts mit einem gemütlichen Wochenende, Liebling.«
»Aber wir sind wenigstens gesund«, sagte sie fröhlich.
»Du bist eine Zauberfee«, sagte er zärtlich.
»Wenn ich das wäre, würde ich die böse Grippe wegzaubern.« Sie schmiegte sich in seine Arme, strich ihm das Haar aus der Stirn und küsste ihn innig. »Werde du mir bloß nicht krank, Liebster.«
»Kann ich mir nicht leisten. Dann würden unsere lieben Patienten wohl noch sagen, ich wolle mich drücken.«
Schon war er wieder draußen. Fee ging auf die Dachterrasse und atmete tief die frische Luft ein. Ihr Blick wanderte hinüber zu dem Haus, auf dem Kerstin Torstensen ihre Dachterrassenwohnung hatte, und sie musste unwillkürlich an den kleinen Stefan denken, und auch an seinen Vater.
Ein Jammer war es, wenn ein Kind ohne Mutter aufwachsen musste. Wie mochte sie gewesen sein, diese Mutter?
*
Daran dachte auch Kerstin. Viel zu viel dachte sie über Stefan und seinen Vater nach, wie ihr jetzt bewusst wurde. Sie versuchte zu schlafen, aber erzwingen ließ sich der Schlaf nicht.
Mittagsruhe herrschte in der Klinik, kaum ein Geräusch war zu vernehmen.
Dr. Schilling hatte Zeit, sich mit Schwester Petra zu unterhalten. Er war jetzt nicht mehr ganz so schüchtern. Er fand sie wirklich nett. Und heut kam Ruth ihm mal nicht in die Quere.
Er wollte Petra ja nicht in Verruf bringen, und Ruth hatte halt eine lose Zunge. Sie versuchte es auch bei jedem annehmbaren Mann. Petra tat das nicht.
»Sie haben doch heute frei«, sagte er rasch, um keine unnütze Zeit verstreichen zu lassen.
Petra nickte errötend. Geahnt hatte sie nun doch, dass er ein bestimmtes Anliegen hatte.
»Ich habe von einem Patienten zwei Theaterkarten geschenkt bekommen«, sagte er verlegen. »Würden Sie mitkommen, Petra?«
»Und wenn uns jemand sieht?«, fragte sie.
»Wäre das so schlimm? Es ist doch unsere Freizeit.«
»Aber Ruth darf es nicht spitzkriegen. Psst, sie kommt.«
»Bis heute Abend«, raunte er ihr zu, dann machte er sich schnell aus dem Staub.
»Na, kleiner Flirt gefällig?«, fragte Ruth auch sogleich, denn sie hatte wohl gesehen, dass er aus dem Schwesternzimmer gekommen war.
»Wieso denn?«, fragte Petra.
»Schilling war doch bei dir. Na, ich gönne es dir ja. Mein Fall ist er ja nicht, und mit Tonio Laurentis kann er sich schon gar nicht messen. Stell dir vor, er hat mich zum Zahnarzt gefahren und außerdem hat er sich mit mir verabredet. Was sagst du nun?«
»Dass ich die Finger von solchem Mann lassen würde«, erwiderte Petra.
Ruth schnitt eine Grimasse. »Du bist ja nur neidisch«, sagte sie wegwerfend.
Das war Petra nun ganz und gar nicht, und sie sagte es auch sehr deutlich. »Mich geht’s ja nichts an«, fügte sie hinzu, »aber das ist doch so ein Typ, der über Leichen geht.«
Ruth lachte auf und verschwand. Petra hatte plötzlich das untrügliche Gefühl, dass nun allerhand passieren würde. Sie konnte es sich nicht erklären, es war einfach da.
Und auch Martin Albrecht hatte ein ganz eigentümliches, beklemmendes Gefühl, als er mit Stefan heimwärts fuhr. Sie hatten im Jagdhof gut gegessen, und natürlich hatte Stefan auch wieder von Kerstin gesprochen.
Ob Laurentis es heute Nachmittag noch mal versucht, zu ihr zu gelangen, ging es Martin durch den Sinn. Und er war dann nicht da.
»Hältst du es mal eine Stunde allein bei Hella aus, Stefan?«, fragte er. »Ich muss noch einmal kurz in die Klinik.«
»Kannst du mich nicht mitnehmen?«, fragte der Junge.
»Nein, das wird zu viel. Frau Torstensen braucht noch viel Ruhe.«
»Du kannst wenigstens Kerstin sagen«, meinte Stefan. »Frau Torstensen klingt so fremd.«
»Gut, Kerstin braucht Ruhe«, sagte sein Vater nachgiebig. »Du warst heute sehr lange bei ihr, eigentlich hätte ich das nicht erlauben durfen.«
»Aber morgen darf ich sie besuchen? Dann bleibe ich auch bei Tante Hella.«
»Ja, du darfst sie besuchen«, versprach Martin.
Hella hatte wieder ihre beleidigte Miene aufgesetzt, aber sie mäßigte ihren Ton. »Wenn ihr schon nicht zum Essen kommt, könntest du wenigstens anrufen, Martin«, sagte sie vorwurfsvoll. Er erwiderte nichts.
»Ich bin bald zurück«, sagte er nur.
Stefan wäre am liebsten gleich in seinem Zimmer verschwunden, aber so schnell ließ ihn Hella nicht los.
»Wo wart ihr denn?«, fragte sie.
»Im Jagdhof«, erwiderte er wahrheitsgemäß, weil das schließlich nicht verheimlicht zu werden brauchte.
»Eigentlich wollte ich heute Nachmittag ins Kino gehen«, sagte Hella, um zu betonen, dass sie jetzt seinetwegen darauf verzichten müsste.
»Kannst du doch. Ich bleibe auch allein zu Hause.«
»Damit du wieder etwas anstellst«, sagte sie. »Wir könnten auch zusammen ins Kino gehen. In einen Zeichentrickfilm.«
»Mag ich nicht.«
»Was haben Sie denn mit dir gemacht in der Klinik?«, lenkte sie ab.
»Was sollen sie schon gemacht haben?«, fragte Stefan verwundert. »Ich war die ganze Zeit bei Kerstin.«
»Bei Kerstin?«, fragte sie schrill. »Wer ist das?«
»Eben Kerstin. Sie ist lieb und schön. Papi findet sie auch schön«, sagte er triumphierend, weil er endlich mal etwas hatte, womit er sie ärgern konnte.
Und wie sie sich ärgerte. Er empfand eine stille Freude darüber.
»So ist das also«, sagte sie. »Ich habe es ja geahnt.«
Das verstand Stefan nun doch nicht so richtig, aber ihm genügte es, dass sie sich ärgerte.
»So ist das«, sagte er, und dann marschierte er in sein Zimmer.
*
Tonio Laurentis kam diesmal zu einem sehr günstigen Zeitpunkt, denn Dr. Schillig und Schwester Petra waren bei einem Schwerkranken, und Oberschwester Erika hatte noch Mittagspause.
Ruth wartete ohnehin voll fieberhafter Spannung auf sein Erscheinen, denn so ganz sicher war sie sich nun doch nicht mehr gewesen, dass er kommen würde.
Jetzt kam er siegessicher auf sie zu, da er gesehen hatte, dass außer ihr weit und breit niemand zu sehen war.
Ein wenig bange war ihr doch. Anordnungen vom Chef mussten auch befolgt werden, wenn er nicht im Hause war. Aber Schwester Ruth konnte diesem Mann, seinem Lächeln einfach nicht widerstehen.
»Sie dürfen aber nicht sagen, dass ich Ihnen das Zimmer gezeigt habe«, sagte sie schnell. »Bitte, bringen Sie mich nicht in Schwierigkeiten.«
Ruth war ihm so gleichgültig wie nur irgendetwas. Für ihn war sie ein dummes Gänschen, das im Höhenflug begriffen war. Er wollte nur zu Kerstin vordringen, sonst nichts.
»Ich habe überhaupt niemanden gesehen, Süße«, sagte er und eilte schon auf die Türe zu.
Dass er zu vielen Mädchen Süße sagte, wusste Ruth nicht. Sie war der Erde entrückt. Für diesen Mann hätte sie alles getan, würde sie alles tun. Traumverloren blickte sie ihm nach.
Blitzschnell stand Tonio in dem Krankenzimmer. Und ehe Kerstin es noch begriffen hatte, dass er es wirklich war und nicht ein böser Traum, war er schon am Bett und hielt ihre Hände fest, damit sie nicht nach der Klingel greifen konnte. Sie war aber ohnehin erstarrt, bewegungsunfähig, voller Angst.
»Du machst ja schöne Geschichten, Liebling«, sagte er dreist. »Was hast du mir für einen Schrecken eingejagt, und dann will man mir auch noch verbieten, dich zu besuchen. Du siehst doch blendend aus, wie ich feststellen kann.«
Gab es so viel Unverfrorenheit? Kerstin versuchte vergeblich, ihm ihre Hände zu entziehen.
»Du bist schön brav«, sagte er, »und hörst mir zu. Was hast du denn plötzlich gegen mich?«
»Das fragst du noch?«, stieß sie hervor. »Geh, geh sofort, ich will dich nie mehr sehen.«
»Ich versteh dich nicht, Kerstin, wir lieben uns doch. An mir liegt es nicht, und ich weiß überhaupt nicht, dass uns etwas trennen könnte.«
Plötzlich wusste sie, was er bezweckte, und dass er Angst hatte. Und mit dieser Erkenntnis schwand ihre eigene Angst und es blieb nur noch Verachtung. »Der Mann ohne Gedächtnis«, sagte sie sarkastisch, »aber nicht nur ohne Gedächtnis, auch ein Mann ohne Seele, ohne Charakter. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich werde es nicht hinausposaunen, wie mies du bist, bist du zufrieden.«
Aber wenn Tonio Laurentis in seiner Eitelkeit getroffen wurde, wenn ein anderer ihm überlegen war und dies dann auch noch eine Frau, verlor er alle Selbstbeherrschung.
Er packte ihre Hände fester, schmerzhaft fest, und der Schmerz ging durch ihren ganzen Körper, durch diesen noch wunden Körper. Kerstin schrie gequält auf.
*
Professor Albrecht durchquerte im Eilschritt die Halle. Die Schwester am Empfang sah ihm verwundert nach. Machte er denn gar keine Pause mehr, fragte sie sich.
Schwester Ruth war voller Entsetzen, als er plötzlich an ihr vorbeiging, und sie war unfähig, ihn mit irgendeinem Anliegen aufzuhalten.
Dr. Schilling und Schwester Petra kamen aus einem Krankenzimmer und sahen sich bestürzt an, als der Chef so schnell auf Frau Torstensens Zimmer zuging, und dann hörten sie, wie auch Martin Albrecht Kerstins Aufschrei.
Schwester Ruth lehnte fahl und bebend an der hellen Wand. Das verkörperte schlechte Gewissen, ging es Schwester Petra durch den Sinn, als sie in das verzerrte Gesicht hlickte.
Professor Albrecht hatte das Krankenzimmer betreten. Tonio Laurentis drehte sich um und versuchte zu lächeln, doch es misslang ihm gründlich.
»Was machen Sie hier? Wer hat Sie hereingelassen?«, fragte Martin kalt.
»Niemand«, erwiderte Laurentis, »aber ich sehe nicht ein, warum man mir den Zutritt verweigern sollte. Ihr Sohn durfte doch Kerstin auch besuchen.«
Er sagte es drohend, aber Martin Albrecht ließ sich dadurch nicht einschüchtern.
»Verlassen Sie sofort diesen Raum und auch die Klinik«, sagte er eisig.
»Sag ihm, dass du wünscht, dass ich bleibe, Kerstin«, sagte Tonio Laurentis befehlend.
Schwer atmend lag Kerstin in den Kissen. »Er soll gehen, er soll gehen«, stammelte sie.
»Sie haben es gehört, Herr Laurentis. Ich werde Sie dafür verantwortlich machen, wenn sich Frau Torstensens Zustand verschlechtert.«
Dr. Schilling erschien in der Tür.
»Brauchen Sie mich, Herr Professor?«, fragte er.
»Befördern Sie diesen Mann hinaus, wenn es sein muss mit Gewalt. Wenn er sich weigert, rufen Sie die Polizei.«
Tonio Laurentis weigerte sich nicht mehr. Eine solche Abfuhr hatte er in seinem Leben noch nicht erfahren, eine solche Demütigung weckte nur noch Rachegefühle in ihm. Er ging an Ruth vorbei, als wäre sie gar nicht vorhanden, und ihr verschloss die Angst den Mund.
»Was ist, Kerstin?«, fragte Martin Albrecht leise. »Ganz ruhig sein. Stefan würde einen schönen Schrecken bekommen, wenn sich Ihr Zustand verschlimmert.«
Schwester Petra kam schon mit der Injektion, und Kerstin spürte fast nichts, als die feine Nadel in ihre Armvene glitt. Selbst in dieser erregenden Situation, ließ Professor Albrecht nichts von seiner Sicherheit vermissen.
»Es tut mir sehr leid«, sagte er. »Ich war nicht im Hause. Den Verantwortlichen werde ich zur Rechenschaft ziehen.«
»Nein, nicht, er erreicht doch, was er will. Er erträgt nicht, wenn man ihm Widerstand entgegensetzt. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind.«
Eine innere Stimme hatte ihn hergetrieben. Wie war das nur zu begreifen? Er fragte es sich, als er sie betrachtete. Sie hatte die Augen geschlossen, ihre Lippen zuckten.
Ja, wie ist das nur zu begreifen, fragte er sich wieder. Es gab doch keine Bindung zwischen ihnen. Sie hatten kaum ein paar Worte miteinander gewechselt. Die Brücke zwischen ihnen hieß Stefan, aber Vertraulichkeit wie zwischen ihr und dem Jungen gab es nicht.
Aber war nicht allein das schon bindend, dass sie sich selbst in Gefahr gebracht hatte, um das Leben seines Jungen zu retten, dass sie sich schützend vor ihn stellte und alle Schuld auf sich nehmen wollte?
»Herr Professor«, begann sie leise, langsam die Augen öffnend.
»Bitte nicht so formell! Stefan würde das gar nicht gefallen«, sagte er sanft. »Sie haben sein Herz im Sturm erobert. Er hat die ganze Zeit nur von Ihnen gesprochen.«
»Er ist so lieb. Nur von einem Kind kann man ehrliche Zuneigung erwarten. Es macht glücklich.«
»Ja, es macht glücklich, aber ist es Ihre Überzeugung, dass nur ein Kind ehrlicher Zuneigung fähig ist?«
»Kinder können sich nicht verstellen.« Nun sah sie ihn voll an. »Wie haben Sie Herrn Laurentis eingeschätzt, vor diesem Zwischenfall? Darf ich Sie das fragen?«
»Aber gewiss. Ich halte ihn für einen eitlen, selbstherrlichen Mann.«
»Er ist ein genialer Architekt«, sagte sie leise. »Man kann es ihm nicht absprechen.«
»Das mag sein. Es gibt auch geniale Ärzte, die eitel und selbstherrlich sind. Es gibt sie in jedem Beruf. Und es gibt auch Frauen, die ihnen da nicht nachstehen.«
»Ich habe Tonio falsch eingeschätzt«, sagte sie. »Ich möchte Ihnen mein Verhalten damit erklären. Früher habe ich sehr viel von ihm gehalten, auch für einen Gentleman.«
»Und er hat sich nicht als solcher benommen«, sagte Martin nachdenklich. »Ich kann mir das gut vorstellen.«
»Ich weiß nicht, warum ich Ihnen das erzähle. Es ist doch meine ganz eigene Angelegenheit. Verzeihen Sie.«
»Manchmal braucht man einfach einen Menschen, dem man sich mitteilen kann. Jeder braucht das mal, und es ist schlimm, wenn man den Menschen nicht findet, dem man vertrauen kann. Ich bin dankbar, dass Sie mich Ihres Vertrauens für würdig befinden.«
Feine Röte stieg in ihre blassen Wangen.
»Ich raube Ihnen Ihre kostbare Zeit«, flüsterte sie.
»Sie rauben mir gar nichts. Heute Nachmittag hätte ich hier eigentlich gar nichts zu tun. Wissen Sie, meine Assistenten sind schwer beleidigt, wenn ich dauernd da bin.«
»Und warum sind Sie doch hier. Doch nicht meinetwegen? Oder wartet Stefan?«
»Nein, er ist zu Hause. Er erträgt seine Tante Hella, damit er Sie morgen besuchen darf.«
»Warum ist die Tante Hella für ihn so ein Schreckmittel?«, entfuhr es Kerstin.
»Nicht nur für ihn. Für mich auch«, erwiderte Martin mit einem flüchtigen Lächeln. »Aber wir wollen jetzt nicht davon sprechen. Ich war mit Stefan zum Essen gefahren. Zum Jagdhof. Wenn Sie wieder gesund sind, werden wir dort einmal gemeinsam essen, einverstanden?«
»Ich weiß nicht, ob das möglich sein wird«, sagte sie verhalten.
»Warum nicht?«
»Ich bin stellungslos und werde meine Wohnung wieder verkaufen müssen. Aber reden wir nicht davon.«
»Doch, davon reden wir auch. Das müssen Sie mir schon zubilligen, damit ich nicht noch mehr Schuldgefühle bekomme.«
»Sie trifft überhaupt keine Schuld«, widersprach Kerstin.
»Ich bin Stefans Vater und verantwortlich für ihn.«
»Stefan hat seine kleine Unüberlegtheit längst wiedergutgemacht«, sagte Kerstin.
»Jetzt lenken Sie nicht ab. Sie haben Ihre Stellung doch nicht nur wegen des Unfalls verloren.«
»Nein, ich hatte mit Herrn Laurentis eine schwere Auseinandersetzung. Und er hat in unseren Berufskreisen auch großen Einfluss.«
»Er ist also auch rachsüchtig. Das passt ins Bild. Von Frau Dr. Norden hörte ich, dass Sie eine sehr begabte Architektin sind. Sie müssen verzeihen, dass ich nicht so auf dem Laufenden bin, aber ich habe einfach keine Zeit, und mein Haus steht und ist komplett eingerichtet.« Es gelang ihm, seiner Stimme einen leichten Klang und seinen Worten einen humorvollen Anstrich zu geben. Sein Mienenspiel faszinierte Kerstin. Erst in dem Vergleich zwischen Martin Albrecht und Tonio Laurentis begriff sie, wie wenig Gefühl der Letztere besaß. Martin Albrechts Gesicht war markant und sensibel zugleich. Eine seltsame Mischung.
»Frau Dr. Norden«, sagte sie, sich gewaltsam auf andere Gedanken bringend. »Sie ist mir nicht bekannt. Nur Stefan hat den Namen erwähnt.«
»Sie ist reizend und hat sich Stefans sehr angenommen.« Unter Kerstins forschendem Blick wurde er etwas verlegen. »Dr. Norden ist der Sohn eines berühmten Arztes. Haben Sie schon mal etwas von der Insel der Hoffnung gehört?«
Jetzt war Kerstin ganz da. »Aber natürlich. Das ist doch dieses Sanatorium auf der Roseninsel.« Sie hätte sich selbst nicht eingestanden, wie erleichtert sie war, dass die reizende Frau Dr. Norden auch einen Mann hatte. Kerstin war sich über ihre Gefühle im Augenblick überhaupt nicht im Klaren, und das war gut so, denn plötzlich konnten sie ohne jede Hemmung miteinander sprechen, als sei ein Zauberwort gefallen.
Und dann kam Martin darauf zurück, wie er an diesem Nachmittag doch in die Klinik gelangt war.
»Manchmal habe ich Intuitionen. Es ist wie ein Zwang«, erklärte er. »Ich kann nicht mehr tun, was ich eigentlich vorhatte, sondern muss das tun, was mir meine innere Stimme befiehlt. Sie befahl mir, in die Klinik zu fahren, und als ich diese betrat, wusste ich, dass bei Ihnen etwas nicht stimmte. Nun lachen Sie mal über mich.«
»Nein, ich lache nicht. Sie sind mein Schutzengel.«
Er betrachtete sie mit einem ganz eigentümlichen Blick, der ihr das Blut schneller durch die Adern jagte. Erst jetzt gestattete er sich die Feststellung, dass sie wirklich schön war, und von einer bezaubernden, mädchenhaften, reinen Anmut. Und er ahnte auch, welche Differenzen es zwischen ihr und Tonio Laurentis gegeben hatte. Er hatte nicht bekommen, was er wollte. Aber warum ihn das so froh machte, war ihm augenblicklich ein Rätsel.
»Stellen wir uns doch einmal vor, ich wäre vom lieben Herrgott zu Ihrem Schutzengel bestellt gewesen«, sagte er mit einem tiefen, humorvollen Lächeln, das auch seine Augen widerspiegelte. »Ich hätte wahrhaftig nichts dagegen. Aber als Wechselwirkung sind Sie dann wahrscheinlich zum Schutzengel von Stefan bestellt.«
»Dagegen hätte ich auch nichts einzuwenden«, sagte sie. »Ich kann mir aber vorstellen, dass Stefan sehr auf seinen Papi wartet.«
Er fasste es so auf, dass sie jetzt allein sein wollte, und in gewisser Beziehung stimmte das auch, denn Kerstins Innenleben war von Gefühlen verwirrt, über die sie sich erst einmal klar werden musste.
»Es geht Ihnen jetzt wieder besser? Und Sie werden ruhig schlafen, wenn ich Ihnen das Versprechen gebe, dass Herr Laurentis bestimmt nicht wieder zu Ihnen vordringen kann?«
Sie nickte. »Ich danke Ihnen so sehr«, sagte sie leise.
Er ergriff ihre Hand und zog sie an seine Lippen, und diesmal berührten diese herben Lippen ihre Haut. Es war für Kerstin ein atemberaubender Augenblick, für Martin aber auch, doch in diesem Augenblick versagte seine Intuition. Er glaubte nicht, bei ihr eine Resonanz zu finden. Er war eben nicht eitel und selbstherrlich.
Aber energisch konnte er sein. Er rief, bevor er ging noch das gesamte Stationsteam zusammen und fragte, wer Herrn Laurentis die Zimmernummer von Frau Torstensen verraten hätte.
Schwester Ruth hatte viel Zeit gehabt, sich eine Ausrede zurechtzulegen. Jetzt dachte sie nicht mehr daran, dass sie für Tonio Laurentis alles zu tun bereit gewesen war. Jetzt war auch sie tief gekränkt und ihr war es ganz egal, was ihm vorgeworfen würde. Sie wollte mit heiler Haut davonkommen.
»Gesagt habe ich es ihm«, erklärte sie mit unsicherer Stimme. »Aber er hat behauptet, Sie hätten ihm gestattet, Frau Torstensen zu besuchen, Herr Professor.«
Er maß sie mit einem durchdringenden Blick und wusste, dass sie log, aber er nahm das nur schweigend zur Kenntnis. Er wusste auch, dass Kerstin kein Aufhebens machen wollte.
Auch Schwester Petra behielt ihre Gedanken für sich. Nur am Abend sprach sie zu Dr. Schilling darüber.
»Ruth hat damit geprotzt, dass Laurentis sie eingeladen hat. Mir kommt das merkwürdig vor, Bernd.«
Sie hatten die Theatervorstellung schon hinter sich. Besonders gefallen hatte sie keinem von beiden. Nun saßen sie schon lange bei einer Flasche Wein in einem gemütlichen Lokal, und beim Du waren sie auch schon angelangt. Aber beide waren sie auch darin einer Meinung, über die Verbindung Ruth und Laurentis nichts zu sagen.
*
Isabel hatte es tüchtig erwischt. Jürgen Schoeller schickte ein Dankgebet zum Himmel, dass Fee so konsequent gewesen war und dass es Isabel dann noch hier so richtig gepackt hatte. Es hätte ganz böse Folgen haben können, wenn sie erst unterwegs dieses hohe Fieber bekommen hätte.
Daniel war froh, dass Jürgen seine zukünftige Frau selbst betreuen konnte, denn er war bis spät abends unterwegs, und Fee konnte man die Pflege bei aller Freundschaft nicht mehr zumuten. Das hätte Isabel am Ende auch noch den Rest gegeben, wie sie selbst sagte.
Für Jürgen war Isabel ein Phänomen. Respektiert hatte er sie ja in jeder Beziehung, denn sie war eine enorm kluge und charaktervolle Frau, aber dass man mit fast vierzig Grad Fieber geistig immer noch auf der Höhe war und völlig klar reden konnte, brachte ihn aus der Fassung.
Die vorübergehende Apathie, hervorgerufen durch die Schwitzkur, war vorüber. Von dem Augenblick an, als Jürgen sich an ihr Bett setzte, war Isabel wieder ganz da und rebellierte gegen sich selbst, weil es sie so erwischt hatte.
»Mit Gewalt kann man eben nichts dagegen tun, mein Liebes«, sagte Jürgen. »Aber wenn du jetzt brav die Medikamente nimmst, wird es bald besser.« Sie nahm die Medikamente brav. Sie schlief dann auch die ganze Nacht ruhig durch. Daniel war nach elf Uhr nochmals zu einem Patienten gerufen worden. Er fiel dann buchstäblich ins Bett.
Martin Albrecht war noch munter. Als er heimgekommen war, hatte Hella es wieder mit Schmeicheleien versucht. Sie hatte Pläne gemacht und wieder verworfen.
So rachedurstig sie auch darauf sann, Martin Knüppel zwischen die Beine zu werfen, wollte sie es doch erst noch einmal auf die sanfte Tour versuchen. Doch dafür schenkte er ihr kein Gehör. Da verlor sie dann wieder die Beherrschung, die ihr ohnehin schwer genug fiel.
»Jetzt weiß ich wenigstens, warum du mich aus dem Hause haben willst«, stieß sie wütend hervor.
»Und warum bitte?«
»Wegen einer Frau, wegen dieser Kerstin. Warum leugnest du es?«
»Weil es nichts zu leugnen gibt«, erwiderte er spöttisch. »Spiel dich nicht auf, Hella. Ich habe genug von deinen Eifersüchteleien. Kerstin Torstensen ist meine Patientin. Ich schulde ihr Dank, dass sie so großmütig ist, die Schuld nicht auf Stefan abzuwälzen, dass sie ihm die Angst genommen hat, etwas getan zu haben, was nicht wiedergutzumachen wäre. Habe ich das nicht schon mal gesagt?«
Früher war er Auseinandersetzungen immer aus dem Wege gegangen. Er hatte sich gesagt, dass es immer
noch besser wäre, Stefan von Irenes Schwester betreuen zu lassen, als von einem fremden Menschen, aber das hat sich als Fehler erwiesen.
Irene war labil gewesen, ein schwankendes Rohr im Winde. Hella war das Gegenteil, aber eins hatten die Schwestern gemeinsam gehabt, sie waren krasse Egoisten. Sie wollen alles haben und nichts geben. Hella lebte nun bereits seit Jahren bedenkenlos auf seine Kosten, und von aufopfernder Liebe, die sie ihm nun in seinem langen Sermon darlegen wollte, konnte wahrhaftig nicht die Rede sein.
Glück bei Männern hatte Hella nie gehabt. Eine Zeit hatte er sie sogar bedauert, weil ihre negativen Charakterzüge auch ihre Gesichtszüge prägten und sie vorzeitig altern ließen.
Martin hatte sich nach Irenes Tod nur noch seinem Sohn und seinem Beruf gewidmet. Frauen interessierten ihn nicht. Keine vermochte den Panzer zu durchbrechen, mit dem er sich umgeben hatte. Er hatte an die wahre Liebe nicht mehr glauben können. Ein kurzer Rausch der Verliebtheit, dann die Ernüchterung, so war seine Ehe gewesen. Das wollte er nicht wiederholen.
Und nun dachte er doch unentwegt an eine Frau, obgleich er es eben doch geleugnet hatte.
»Hörst du mir überhaupt zu?«, fragte Hella scharf.
»Nein«, erwiderte er lakonisch.
»Dann kann ich ja gehen.«
»Bitte, ich habe nichts dagegen.«
Sie zischte wie eine Schlange, dann verschwand sie. Eine halbe Stunde später hörte er, wie sie das Haus verließ. Er atmete befreit auf. Er konnte seinen Gedanken freien Lauf lassen. Die Beklemmung, dass sie im nächsten Augenblick wieder vor ihm stehen könnte, um ihm Gehässigkeiten ins Gesicht zu schleudern, war vorbei.
Kerstin hatte ihm von ihren Sorgen erzählt. Er grübelte nach. War das ohne Berechnung geschehen? Hoffte sie nicht doch insgeheim, dass er sich großzügig erkenntlich zeigen wollte?
Er wollte es ja, aber ihn quälte doch die Ungewissheit, ob sie es darauf anlegte. Er schämte sich bald darauf dafür. Kerstin war nicht wie Hella. Sie war nicht berechnend. So viel Menschenkenntnis besaß er doch. Damals, als er sich in Irene verliebt hatte, war das noch ganz anders gewesen. Aber wie war er denn selbst? Was konnte er einer Frau an Gefühlen entgegenbringen? Hatte Irene ihm nicht vorgeworfen, dass er ein Eisblock sei?
Nicht gleich hatte sie das getan, aber schon als sie kaum ein paar Wochen verheiratet waren, als er nach den Flitterwochen wieder seinem Beruf nachgehen musste, manchmal zum Umfallen müde heimkam und sie ihn zwingen wollte, noch mit ihr auszugehen.
Er ahnte nicht, dass Kerstin genauso viel über ihn nachdachte.
Martin Albrecht war der eigenartigste Mann, der ihr je begegnet war. Und sie hatte fast ausschließlich mit Männern zu tun gehabt. Sie hatte sich einen Beruf erwählt, der ausschließlich Männersache zu sein schien. Jedenfalls hatte sie das von den Männern oft gesagt und auch zu spüren bekommen.
Sie war glücklich gewesen, als Tonio Laurentis ihr die Chance gegeben hatte, seine Mitarbeiterin zu werden. Sie hatte sich nach gewissen Spannungen auch mit den Kollegen gut verstanden, die schließlich anerkannten, wie viel sie leisten konnte, wie oft sie geniale Ideen hatte. Es war ihr gar nicht bewusst geworden, dass Tonio dann oft ihre Anregungen sich selbst zuschrieb. Erst jetzt konnte sie alles ganz nüchtern überdenken und begreifen, wie schamlos sie von ihm ausgenutzt worden war.
Nun war er von dem Podest gestürzt, auf das sie ihn gestellt hatte. Endlich sah sie ihn so, wie er wirklich war. Aber wie konnte es geschehen, dass sie so bald einen anderen Mann idealisierte?
Bin ich denn so schwach, fragte sie sich. Brauche ich denn einen starken Mann, an den ich mich klammern kann?
Warum hatte sie ihm nur gesagt, in welcher Situation sie war? Musste er jetzt nicht denken, dass dies eine versteckte, gut bemäntelte Erpressung sein könnte?
Heiß und kalt wurde es Kerstin. Ihre Nerven vibrierten. An einschlafen war nicht mehr zu denken.
Sie bekam Durst, tastete nach der Teetasse. Versehentlich traf ihre Hand aber die Klingel, die schon bei der geringsten Berührung anschlug, ohne dass es im Zimmer zu hören war.
Ganz erschrocken war Kerstin, als die Nachtschwester plötzlich eintrat.
»Sie haben geläutet«, sagte Schwester Anna freundlich, als sie Kerstins verwirrten Blick gewahrte.
Sie war eine nette, abgehärtete Person und nicht so hektisch wie Schwester Martha, die in der vergangenen Nacht Dienst gehabt hatte.
»Es war ein Versehen. Es tut mir leid«, sagte Kerstin leise. »Ich hatte nur Durst.«
»Soll ich Ihnen nicht frischen Tee bringen?«, fragte Schwester Anna.
»Nein, ich trinke ihn gern kühl«, erwiderte Kerstin.
Schwester Anna stützte sie. »Wozu bin ich sonst da«, sagte sie mütterlich.
»Sie haben doch nachts genug zu tun«, meinte Kerstin.
»Samstag zum Sonntag geht es«, erwiderte Schwester Anna lächelnd. »Da bereiten sich alle schon auf die Besuche vor und sind sehr friedlich aus Angst, es könnten ihnen Besuche verboten werden.«
»Geschieht das öfter?«, fragte Kerstin.
»Manchmal muss es sein. Sie ahnen ja nicht, wie anstrengend und aufregend Angehörige manchmal sein können. Am Montag ist dann wieder der Teufel los. Besonders schlimm ist es, wenn der Chef am Sonntag nicht bei der Visite zugegen ist. Dann kann er sich am Montag zerreißen.«
»Er ist wohl sehr beliebt?«, fragte Kerstin tastend.
»Und wie«, erwiderte Schwester Anna. »Er ist ja auch ein feiner Mann. Hat für alles Verständnis, hat für jeden Zeit. Solchen Chef haben wir noch nicht gehabt, solange ich an dieser Klinik bin. Da gibt man gern noch ein paar Jahre zu, obgleich ich schon im Ruhestand sein sollte.«
»Aber es ist wohl immer noch Schwesternmangel?«, fragte Kerstin.
»Das kann man eigentlich nicht sagen, aber was haben die jungen Dinger denn schon im Kopf? Sie meinen partout, sich einen Arzt angeln zu können, und manchmal ist es ja auch ein Patient, aber ihr Leben wollen sie nicht in der Klinik verbringen und so ist denn ein Kommen und Gehen. So, nun denken Sie wohl, dass ich eine rechte Klatschbase bin, anstatt Sie in Ruhe zu lassen.«
»Nein, Sie sind nett. Ich kann nicht schlafen«, sagte Kerstin.
»Haben Sie Schmerzen, dann wecke ich den Oberarzt.«
»Nein, das nicht. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dauernd zu schlafen. Und krank war ich noch nie.«
Sie hoffte, dass Schwester Anna noch mehr von Professor Albrecht erzählen würde, aber das geschah nicht. Schwester Anna wurde nun doch in einem anderen Zimmer gebraucht.
Und nun dachte Kerstin an Stefan und daran, dass er sie morgen besuchen wolle. Da musste sie ausgeruht sein, und sie wollte keinen kranken Eindruck machen.
Sieben Jahre ist er. Er könnte mein Sohn sein, dachte sie. Wie schön wäre es doch, ein Kind zu haben. Aber das hatte sie auch früher schon manchmal gedacht. Doch zu einem Kind gehörte auch ein Vater und das musste der richtige Mann sein. Der Einzige, den sie sich als Vater ihres Kindes vorstellen konnte.
Der Schlummer überkam sie, und sie sank in das Reich der Träume, aller Sorgen enthoben, schwebend auf weichen Wolken.
*
Martin Albrecht wurde vom Läuten des Telefones geweckt. Er begriff es nicht gleich, denn es war Sonntag, und da war es ganz ungewöhnlich, dass er so früh in die Klinik gerufen wurde, denn mit einem Blick auf die Uhr überzeugte er sich, dass es noch nicht einmal sechs Uhr war.
Er glaubte nicht richtig zu hören, als sich ein Polizeirevier meldete. Sie hätten eine total betrunkene Frau aufgegriffen, die behauptet hätte, seine Schwägerin zu sein, wurde ihm gesagt.
Martin war sogleich hellwach. Unmöglich, dachte er, aber er brachte kein Wort über die Lippen.
Ob er eine Schwägerin hätte, wurde er gefragt.
»Ja«, erwiderte er geistesabwesend, aber sie sei sicher daheim.
Dann solle er sich erst davon überzeugen. Martin sprang aus dem Bett und lief in Hellas Zimmer. Das Bett war nicht benutzt. Seine Gedanken überstürzten sich. Er dachte an Irene, die auch zu oft nach der Flasche gegriffen hatte. O mein Gott, dachte er, Hella will mich ruinieren.
»Ich komme sofort«, sagte er in den Apparat hinein, aber ihm war einfach jämmerlich zumute.
Hella hatte doch immer mit Abscheu von Irenes Alkoholsüchtigkeit gesprochen. Hatte sie ihn nur so gut zu täuschen verstanden wie Irene auch? Waren ihre Migräneanfälle auch nur ganz schlicht gesagt Kater gewesen?
Er kleidete sich an und ganz gedankenlos ging er nochmals in Hellas Zimmer. Er öffnete die Schränke, entdeckte dort ganze Batterien von Flaschen und war augenblicklich wieder wie gelähmt.
Guter Gott, dieser Frau hatte er seinen Jungen anvertraut.
Er brauchte Minuten, um seine Fassung zurückzuerlangen. Dann ging er leise in Stefans Zimmer. Er schlief, seinen Teddy im Arm, den er von seiner Omi bekommen hatte.
»Stefan«, flüsterte Martin.
»Papi, was ist denn? Habe ich verschlafen?«, fragte er Junge.
»Nein, schlaf weiter. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in die Klinik muss. Weck Tante Hella nicht auf. Ich bin bald zurück.«
»Ich werde mich hüten, sie zu wecken«, murmelte Stefan. Dann richtete er sich auf. »Es ist doch nichts mit Kerstin?«, fragte er ängstlich.
»Nein, nein«, sagte Martin beruhigend. »Schlaf weiter. Ich wollte nur nicht, dass du mich suchst.«
Und was nun, dachte er, als er zu dem Polizeirevier fuhr. Morgen würde es vielleicht schon in den Zeitungen stehen, dass man seine Schwägerin volltrunken aufgegriffen hatte.
Vielleicht ging es ihm bald ebenso wie Kerstin, und er würde auf der Straße sitzen, untragbar für einen solchen Posten.
Nur konnte er es finanziell verkraften, aber was würde es ihm nützen, wenn sein Ruf ruiniert war. Er konnte sich vorstellen, dass Hella es in ihrer maßlosen Wut darauf abgesehen hatte.
Man empfing ihn mit sichtlichem Mitgefühl. Lallend saß Hella in einem kleinen Raum. Sie sah entsetzlich aus und erkannte ihn gar nicht.
»Wir haben gedacht, dass Sie wohl am besten wüssten, wohin man sie bringen kann, Herr Professor«, sagte ein junger Polizist. »Kennen Sie mich nicht mehr?«, fragte er dann, als Martin ihn verwirrt anblickte. »Sie haben doch mein Bein in Ordnung gebracht, als ich beim Skifahren verunglückt war.«
»Eine peinliche Geschichte«, murmelte Martin.
»Sie hat viel getankt«, sagte der junge Polizist.
»Heißen Sie nicht Reimer?«, fragte Martin gedankenvoll.
»Genau. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Ist schon drei Jahre her. Sie haben mein Bein prima hingekriegt, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Damals war gerade Ihre Frau Mutter gestorben.«
»Ja, und damit fing alles Elend an«, sagte Martin geistesabwesend. »Es wird einige Zeit dauern, bis sie nüchtern ist«, fuhr er mit einem langen Blick zu Hella fort. »Ich nehme sie mit nach Hause. Im Augenblick weiß ich wirklich nicht, wohin ich sie sonst bringen könnte.«
Herr Reimer fuhr mit. Er fühlte sich dazu verpflichtet. Von Amts wegen konnte er es ja auch verantworten.
Er versicherte auch, dass von ihnen niemand etwas von diesem Zwischenfall erfahren würde.
»Jeder hat sein Kreuz«, sagte Herr Reimer. »Bei mir ist es der Schwiegervater.«
Hella lag auf ihrem Bett. Sie schnarchte jetzt. Sie hatte auch von dem Transport kaum etwas verspürt. Ekelerregend sah sie aus. Martin kämpfte gegen das Übelkeitsgefühl an. Und er musste auch dagegen ankämpfen, ihr einfach einen Kübel Wasser überzuschütten.
»Das kommt in den besten Familien vor«, hatte Herr Reimer tröstend zum Abschied gesagt. Für Martin war es kein Trost. Er wusste nicht einmal, wie er sich verhalten sollte, wenn Hella wieder nüchtern geworden war. Aber das Schlimmste war, dass er nicht aus dem Hause gehen konnte, bevor man einigermaßen normal mit ihr reden konnte. Und wie sollte er das Stefan klarmachen, der doch nur darauf wartete, Kerstin zu besuchen.
Aber er durfte ja auch nicht nur an den heutigen Tag denken. Was sollte denn mit Stefan werden? Er konnte ihn nie und nimmer auch nur einen Tag länger mit Hella in einem Haus lassen. Wenn es schon so weit mit ihr gekommen war, dass sie sich in aller Öffentlichkeit betrank, war sie auch zu Schlimmeren fähig. Und wenn sie nun so enthemmt war, dass sie sagte, er hätte sie dazu getrieben?
Er konnte doch nicht preisgeben, dass er mit Irene das gleiche Drama erlebt hatte.
Als er Hellas Zimmer verließ, stand Stefan plötzlich vor ihm. Entsetzt sah ihn der Junge an, und dieser Blick, in dem tausend bange, schreckensvolle Fragen standen, ließ Martin zu sich selbst zurückfinden.
»Tante Hella ist krank, Stefan«, sagte er. »Ich glaube, wir müssen sie in ein Sanatorium bringen.«
»Bestell doch einen Krankenwagen, Papi«, sagte Stefan. »Ruf doch gleich an.«
»Ich muss erst überlegen«, sagte Martin leise. »Machen wir uns einen Kaffee?«
Stefan trabte neben ihm her in die Küche. »Was fehlt ihr denn überhaupt? Grippe?«, fragte er.
»Ich weiß es nicht so genau«, erwiderte Martin ausweichend.
»Ist wohl nicht dein Gebiet?«, fragte Stefan. »Ruf doch Dr. Norden an, der weiß alles«, sagte er. »Mit Grippe weiß er ganz gut Bescheid, aber was meinst du, was die Leute alles haben, die in seine Sprechstunde kommen. Er weiß sogar ein Sanatorium. Das gehört ihm sogar. Ihr habt euch doch auch darüber unterhalten.«
Die Insel der Hoffnung! Nun, da war wohl kein Platz für Hella, und man konnte es Dr. Cornelius nicht zumuten, sich mit einer Alkoholikerin zu befassen. Aber Dr. Norden war ein Mann, mit dem man ohne Scheu und ganz offen reden konnte. Allein fühlte sich Martin augenblicklich einfach hilflos.
»Das andere Problem bist du, Stefan«, sagte er nachdenklich.
»Wieso bin ich ein Problem?«, fragte der Junge.
»Ich kann dich doch nicht allein im Haus lassen und so schnell werde ich sicher niemanden finden, der für dich sorgt.«
»Tante Hella hat auch nicht für mich gesorgt. Ich habe mir immer ein Brötchen und eine Tüte Milch morgens gekauft. Und mittags kann ich auch zu Lenchen gehen. Sie freut sich, wenn jemand ihr Essen isst. Sie kocht sehr gut. Und nachmittag gehe ich zu Kerstin. Ist das nicht zu machen?«
Für Stefan waren es keine Probleme. Und diese wollte Martin jetzt auch erst mal beiseiteschieben. Hella musste aus dem Haus, das war klar.
Heute noch musste er sie wegbringen, und wenn es auch demütigend für ihn war, er musste jemanden einweihen, von dem man einen Rat erhoffen konnte. Er wusste tatsächlich nur Dr. Norden.
Er trank Kaffee und rauchte eine Pfeife. Stefan war der Appetit glücklicherweise nicht verdorben. Er aß, was noch vorhanden war, auf.
»Da siehst du es ja, nicht mal einkaufen kann Tante Hella«, sagte er. »Möchte nur wissen, was sie mit dem vielen Geld macht, das du ihr immer gibst.«
Martin wusste es jetzt. Er machte sich aber auch Vorwürfe, dass er sich nicht früher darum gekümmert hatte.
»Hat dir Hella zu essen gegeben, wenn ich nicht zu Hause war?«, fragte er den Jungen beklommen.
»Nö, das nicht, aber Geld hat sie mir gegeben, dass ich mir was kaufen konnte. Das war noch das Beste an ihr.«
»Und warum hast du mir das nie gesagt, Stefan?«
»Du hast genug Ärger, und außerdem hätte sie mir doch bloß eins ausgewischt«, erklärte Stefan. »Hoffentlich bleibt sie jetzt lange weg und noch besser wär’s, wenn sie gar nicht mehr wiederkommen würde.« Er überlegte ein paar Minuten, und Martin störte ihn nicht bei diesen Überlegungen. »Weißt du, Papi, eigentlich wäre es doch schön, wenn Kerstin zu uns kommen könnte. Geht das nicht?«, fragte er.
»Sie hat ihren Beruf«, erwiderte Martin heiser.
Stefan sah ihn nachdenklich an. »Ich überlege ja, ob es ihr gefallen würde. Aber wenn du sie schön findest und auch magst, dann könntest du sie heiraten. Dann braucht sie keinen Beruf mehr.«
»Zum Heiraten gehören zwei, Stefan. Ich glaube nicht, dass Kerstin auf ihren Beruf verzichten würde.«
»Na, den könnte sie dann doch auch weitermachen«, erklärte der Junge. »Ich würde sie nicht stören. Ich würde mich ganz still neben sie setzen und zuschauen. Kerstin ist die einzige Frau, die ich mag. – Na ja, Frau Norden und Lenchen mag ich auch, aber die können wir ja nicht heiraten, und Kerstin mag ich nicht nur, Kerstin habe ich wahnsinnig lieb.«
»Für dich ist alles einfach, Stefan«, sagte Martin.
Der Junge versank in Schweigen. Stefan brütete etwas aus, aber Martin wurde sich dessen nicht bewusst, da er jetzt vor allem daran dachte, was mit Hella geschehen sollte. Es war Viertel nach neun Uhr, und noch recht früh für den Sonntagmorgen eines geplagten Arztes, aber dennoch entschloss er sich, Daniel Norden anzurufen.
*
»Es war der Kollege Albrecht«, sagte Daniel, als er sich wieder am Frühstückstisch niederließ. »Scheint schwere Sorgen zu haben.«
»Mit Frau Torstensen?«, fragte Fee aufhorchend.
»Nein, mit seiner Schwägerin. Ich werde nachher mal schnell vorbeifahren.«
Fee protestierte nicht. »Falls es um Stefan geht, soll er doch den Jungen zu uns bringen. Dann hat Lenchen Gesellschaft. Von uns hat sie sowieso nicht viel. Er ist ein lieber kleiner Junge. Die Tante Hella scheint ja ein rechter Drache zu sein.«
»Und außerdem den Alkohol sehr zu lieben. Er hat sich zwar sehr vorsichtig ausgedrückt, wahrscheinlich auch, weil Stefan neben ihm stand. Jedenfalls beherrscht er vom Lateinischen nicht nur die Fachausdrücke, und er hat Glück, dass ich nicht alles verlernt habe. Ich kann diesen netten Menschen nicht im Stich lassen, Fee.«
»Nein, das können wir nicht, aber wenn es so ist, wird es besser sein, wenn Stefan aus dem Haus kommt. Du lieber Himmel, was es so alles gibt.«
»Was gibt es alles?«, fragte Jürgen, der nach einer Nacht, in der er nur wenig geschlafen hatte, recht angeschlagen daherkam.
»Kennst du eine vornehme Trinkerheilanstalt?«, fragte Daniel unverblümt.
Jürgen sah ihn verwirrt an. »Eine vornehme was?«, fragte er stockend.
»Du hast schon richtig verstanden. Ich meine ein Sanatorium, dem nicht gleich aufs Türschild geschrieben wird, welcher Art die Patienten sind.«
»Schloss Riebling«, erwiderte Jürgen trocken. »Nicht Riesling, sondern Riebling, aber es passt doch recht gut.«
»Waaas?«, fragte Daniel gedehnt.
»Der Name«, sagte Jürgen lächelnd.
»Ich bin erstaunt«, sagte Daniel. »Das wusste ich nicht. Es ist doch ein stinkfeines Sanatorium.«
»Danach hast du mich doch gefragt. Man bezeichnet es als Heilstätte für Zivilisationskrankheiten. Man ist diskret, aber das kostet auch allerhand. Du bist doch nicht etwa dem Alkohol verfallen?«
»Mach keine Späße. Wir müssen einem guten Freund helfen. Hast du persönliche Verbindung dorthin?«
»Wir haben schon bei manchen Patienten, die dort entwöhnt worden sind, den Rest besorgt und glücklicherweise mit bleibendem Erfolg.«
»Ihr schreckt auch vor nichts zurück«, sagte Fee neckend.
»Nichts Menschliches ist uns unbekannt«, sagte Jürgen. »Ich hoffe, euch auch nicht, denn ich habe nämlich einen Mordshunger. Isabel schläft noch.«
»Dann iss«, sagte Daniel. »Alles für dich«, deutete er mit einer Handbewegung auf den reichlich gedeckten Tisch an. »Ich verschwinde mal für eine Stunde.«
»Riebling, nicht Riesling«, rief Jürgen ihm nochmals nach.
»Ich bin ja nicht doof«, rief Daniel zurück.
»Ein leichtes Los hast du dir auch nicht erwählt, Fee«, sagte Jürgen Schoeller.
»Welche Arztfrau weiß das nicht?«, fragte sie schelmisch zurück.
»Na, bei uns geht es doch etwas geruhsamer zu«, erklärte er.
Erwartete er jetzt, dass sie sagen würde, sie wolle auch lieber auf der Insel der Hoffnung leben?
»Mein Platz ist an Daniels Seite«, sagte sie sehr bestimmt.
»Das weiß ich ja. Jetzt bräuchtest du halt ein bisschen mehr Ruhe.«
»Ich kann sie haben, wenn ich will. Mach du dir darüber keine Gedanken. Daniel ist sehr besorgt um mich, und wenn das Baby dann erst da ist, werden wir weitersehen.«
*
Begrüßen durfte Stefan Dr. Norden, aber dann wurde er von seinem Vater in sein Zimmer zitiert, und er ging auch widerspruchslos. Tante Hella musste ja ganz schön krank sein, da sie noch nicht in Erscheinung getreten war und ihnen etwas vorgejammert hatte.
Stefan hegte nun auch nur die Befürchtung, dass aus seinem Besuch bei Kerstin nichts mehr würde. Ob er den Papi mal fragte, ob er nicht mit dem Taxi hinfahren könne? Jetzt traute er sich nicht so recht. Es dauerte auch ziemlich lange, bis er Dr. Nordens Stimme wieder in der Diele hörte. Vorher hatte er auch noch telefoniert, und da Stefan ein bisschen gelauscht hatte, vernahm er auch, dass es darum ging, ob man die Patientin heute noch bringen könne. Stefan nahm allen Mut zusammen und schob sich durch die Tür.
»Papi, ich will ja nicht stören«, flüsterte er, »aber ich möchte so gern zu Kerstin. Ich habe es ihr doch versprochen.«
»Es tut mir leid, Stefan, aber ich kann jetzt nicht weg«, erwiderte Martin. »Tante Hella muss in eine Klinik gebracht werden, und da habe ich noch eine Menge zu erledigen.«
»Das sehe ich ja ein, aber könnte ich nicht mit einem Taxi fahren?«, fragte er.
Du lieber Gott, was würden sie da in der Klinik klatschen, dachte Martin.
»Oder vielleicht fährt Dr. Norden bei der Klinik vorbei, wenn er heimfährt«, meinte Stefan bittend.
»Ja, das ist eine Idee«, sagte Daniel.
Er tauschte schnell einen Blick mit Martin Albrecht. Es konnte gut sein, wenn Stefan aus dem Hause war, sollte Hella möglicherweise einen Tobsuchtsanfall bekommen.
»Ich gerate immer tiefer in Ihre Schuld, Herr Norden«, sagte Martin. »Nun störe ich auch noch Ihren Sonntagsfrieden.«
»Mit dem wird es wohl sowieso nicht viel werden. Machen Sie sich keine Gedanken.«
Stefan hatte seinen Teddy im Arm, als er zum Ausgehen angekleidet wieder in die Diele kam.
»Sei schön brav, Stefan«, sagte Martin.
»Ich mache dir keinen Ärger«, versprach der Junge. Dann warf er noch einen misstrauischen Blick auf Hellas Zimmertür, sagte aber nichts.
Erst draußen, als er hinter Daniel im Wagen saß, fand er die Sprache wieder.
»Ist sie vielleicht tot?«, fragte er. »Ich meine, weil es so still ist in ihrem Zimmer. Sie redet sonst nämlich immer mächtig laut, wenn ihr was fehlt, damit wir sie auch ja hören.«
»Deine Tante ist schwerkrank, Stefan«, erklärte Daniel.
»Kann Migräne denn so schlimm sein?«
»Ja, sehr schlimm«, erwiderte Daniel erklärend.
»Sie hätte dann ja schon längst mal in eine Klinik gehen können«, meinte der Junge. »Es tut mir leid, Dr. Norden, aber lieber haben kann ich sie deswegen doch nicht.«
Ja, und was sollte man dazu sagen? Daniel war sehr depremiert gewesen, als Martin Albrecht ihm diese Geschichte erzählt hatte. Er ahnte, was es für diesen empfindsamen Mann bedeutete, sich mit solcher Tragödie auseinanderzusetzen, deren Fortsetzung und Ende noch nicht abzusehen war, denn Martin Albrecht war nicht der Mann, der sich um eine Verantwortung drückte. Die kranke Hella konnte er nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Die Sorge um seinen Jungen zerrte zudem noch an seinen Nerven. Ja, wie konnte man da helfen? In Gedanken ging Dr. Norden alle seine Patienten durch, die alleinstehend waren und sich zur Betreuung eines Kindes eignen würden, und da fiel ihm Fanny Bürkel ein, die ihren Mann vor ein paar Monaten verloren hatte. Eine rüstige Frau, die ab und zu mehr aus Anhänglichkeit zu ihm kam, weil er ihren Mann so lange ärztlich betreut hatte.
Sie stand völlig allein. Sie bekam eine gute Rente, die sie davor bewahrte, sich eine Arbeit suchen zu müssen, aber sie hatte schon manches Mal gesagt, dass sie gern noch zu etwas nütze sein möchte.
Es war nur eine Idee, aber fragen konnte man sie ja.
Sie waren bei der Klinik angelangt. »Sagst du Kerstin auch mal guten Tag, Dr. Norden?«, fragte Stefan. »Sie freut sich bestimmt. Ich habe ihr schon viel von euch erzählt, und wie lieb ihr zu mir seid.«
Daniel begleitete ihn also hinauf. Oberschwester Erika zeigte sich von ihrer freundlichsten Seite.
»Herr Professor hat schon angerufen«, erklärte sie. »Ich werde Stefan unter meine Fittiche nehmen.«
»Ich gehe doch zu Kerstin«, sagte Stefan, und schon ging er energischen Schrittes auf das Krankenzimmer zu.
Daniel hielt sich nicht lange auf. Kerstin war etwas befangen, als Stefan mit aller Selbstverständlichkeit erklärte, dass das der nette Dr. Norden sei. Daniel erkundigte sich nach ihrem Befinden und erklärte ihr, dass Professor Albrecht seinen Sohn später abholen würde.
»Ich erzähle Kerstin alles«, versicherte Stefan. »Vielen Dank, dass du mich hergebracht hast und sag schöne Grüße an deine Frau und Lenchen.«
»Du wirst uns ja bald mal besuchen«, sagte Daniel. Dann war Stefan mit Kerstin allein.
Schmeichelnd drückte er seine Wange an ihre Hand. »Geht’s dir gut?«, fragte er. »Ich hatte solche Angst, dass Papi deinetwegen in die Klinik musste.«
»Mir geht es jetzt sehr gut, Stefan. Ich freue mich, dass du hier bist.«
Wie sehnsüchtig hatte sie gewartet, bange, dass er nicht kommen würde. Immerzu hatte sie auf die Uhr geschaut.
»Tante Hella ist nämlich krank geworden«, erklärte er. »Sie muss in eine Klinik, deswegen muss Papi jetzt auch noch zu Hause bleiben. Aber Dr. Norden hat mich hergebracht. Ist doch lieb, gell? Er ist ein richtiger Freund. Papi mag ihn auch gern.«
Schüchtern legte er seinen Teddy auf die Bettdecke. »Habe ich für dich mitgebracht, Kerstin, weil ich ihn am liebsten habe. Den habe ich nämlich noch von meiner Omi.«
»Dann musst du ihn auch behalten«, sagte Kerstin tief gerührt.
»Ich kann ja nicht immer bei dir sein. Morgen muss ich wieder zur Schule, dann ist Wuschi auch allein. Er kann dir Gesellschaft leisten. Ein anderer würde ihn auch nicht kriegen, nur du.«
»So gern hast du mich?«, fragte sie leise.
»Lieb«, berichtigte er. »Sehr lieb. Ich möchte sehr gern, dass du zu uns kommst, wenn Tante Hella nun nicht mehr bei uns ist. Geht das nicht?«
»Sie wird doch wiederkommen«, sagte Kerstin befangen.
»Hoffentlich nicht«, erklärte Stefan ehrlich. »Der liebe Gott hat dich hergezaubert, und Tante Hella kann er ruhig wegzaubern.«
»Der liebe Gott zaubert nicht. Er schenkt, aber manchmal schenkt er etwas nur für kurze Zeit, Stefan.«
Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Ich möchte so gern, dass er uns für immer geschenkt hat«, flüsterte er. »Hast du mich ein bisschen lieb?«
»Sehr«, erwiderte sie innig.
»Wenn du mich sehr lieb hast, dann könntest du meinen Papi doch wenigstens ein bisschen lieb haben«, fuhr er fort. »Wenn du sonst keinen Mann hast, meine ich.«
»Es kommt ja nicht nur auf mich an. Es gehören immer zwei dazu«, flüsterte Kerstin.
»Das hat Papi auch gesagt und außerdem darf er nicht vertraut mit dir sein, solange du seine Patientin bist. Aber du kommst ja bald raus. Was meinst du, Kerstin? Befreunden könnt ihr euch doch schon ein bisschen.«
Er machte wirklich keine Umwege, schnurstracks ging er auf sein Ziel los, aber dabei war er so rührend, dass eine Woge von Zärtlichkeit Kerstin ergriff.
»Befreunden können wir uns schon«, räumte sie ein. »Aber jetzt sag mir, wer sich um dich kümmert, wenn Tante Hella weg ist.«
»Vormittags bin ich in der Schule und nachmittags bei dir und mittags geht Papi mit mir zum Essen. Da braucht sich keiner kümmern«, erklärte er unumwunden. Für ihn gab es derzeit überhaupt keine Probleme. Er fand es wunderschön, dass Kerstin nichts dagegen hatte, sich mit seinem Papi anzufreunden.
*
Ein beklemmendes Gefühl beschlich Martin, als Hella abtransportiert worden war. Bewusstlos hatte man sie aus dem Hause getragen, doch was würde sie sagen, wenn sie wieder zu sich kam, wenn sie nüchtern war und alles überdenken konnte?
Mechanisch begann er die leeren Flaschen wegzuräumen. Da hatte sie also Nacht für Nacht heimlich getrunken. Um dann morgens unfähig zu sein, beizeiten aufzustehen. Und wie viele Nächte war sie allein mit Stefan im Hause gewesen.
Er musste sich Vorwürfe machen. Hatte sie aus Einsamkeit getrunken? Aus Kummer gar, weil er ihr keine Gefühle entgegenbrachte?
Aber konnte man Gefühle erzwingen? Und sie selbst war echter Gefühle doch auch nicht fähig gewesen. Das sagte er sich nicht zur Rechtfertigung. Er wollte alles klar und nüchtern überdenken.
Hella hatte sich nach Irenes Tod anfangs überhaupt nicht um Stefan gekümmert. Später sagte sie, sie wolle nicht den Eindruck erwecken, dass sie sich aufdrängen wolle. Allerdings hatte seine Mutter sie mit einer Konsequenz abgelehnt, die zu ihrer sonstigen Güte nicht passte.
Hella war Lehrerin gewesen, und er hatte sich sehr gewundert, als sie dann nach dem Tode seiner Mutter kam und ihm anbot, Stefan zu betreuen. Er hatte sie auch eindringlich gefragt, ob sie es nicht bereue, ihren Beruf aufzugeben.
Ihr Neffe sei ihr wichtiger als ihr Beruf, hatte sie gesagt. Die vielen Kinder hätten sie ohnehin krank gemacht.
Er hatte aber auch nicht das geringste Talent zur Pädagogin bei ihr feststellen können. Und jetzt musste er sich fragen, ob nicht schon früher ihre Leidenschaft zum Alkohol sie aus der Bahn geworfen hatte.
Es widerstrebte ihm, in ihren Sachen herumzukramen, aber wenn Hella geheilt werden sollte, musste er herausfinden, wann diese heimliche Trunksucht begonnen hatte. Und er fand es heraus, als er in dem wüsten Durcheinander ihres Schreibtischs ein zerknülltes Schreiben der Direktion des Internates fand, an dem Hella tätig gewesen war.
In sehr sachlichem Ton teilte sie Hella mit, dass ihre Tätigkeit am Internat untragbar geworden wäre, und sie könne nur hoffen, dass sie auf den rechten Weg zurückfinden würde. Und dieses Schreiben war auch an ein Sanatorium gerichtet.
Dann fand Martin auch noch ein paar Briefe von einem Mann, der zweifellos gleichfalls Lehrer am Internat gewesen war. In einem machte er bittere Vorwürfe, dass sie ihn durch ihr unverantwortliches Benehmen um die Stellung gebracht hätte.
Warum Hella die Beweisstücke einer unrühmlichen Vergangenheit aufbewahrt hatte, blieb ihm ein Rätsel, aber in dem Schreibtisch war so viel überflüssiges Zeug, dass er glauben konnte, sie hätte sich an diese Dinge gar nicht erinnert.
Als Arzt wusste er nur zu gut, wie sehr Alkoholiker ihre Umwelt über Jahre hinweg zu täuschen vermochten. Gerade deshalb sanken sie dann später schlagartig so tief, dass ihnen kaum noch zu helfen war. Besonders schlimm wurde es, wenn Menschen mit hohem Intelligenzgrad, den man Hella nicht absprechen konnte, dieser Leidenschaft verfielen.
Für Martin waren die Erkenntnisse dieses Sonntags deprimierend. Da habe ich schön versagt, warf er sich vor. Aber wurde ihm nun nicht die Verpflichtung auferlegt, Hella zu helfen und für sie zu sorgen?
Ein eisiger Schauer kroch über seinen Rücken. In finanzieller Hinsicht war er zu jeder Hilfe bereit, gewiss, aber genügte das?
Grau und trübe sah für ihn die Welt aus, obgleich die Sonne vom Himmel lachte. Und die Zeit verstrich über seinem Grübeln.
*
»So, die Tante Hella wäre also untergebracht«, sagte Daniel, nachdem er den Anruf von Martin entgegengenommen hatte. »Vorerst ist Albrecht dieser Sorge ledig. Wenn ich nachher die Krankenbesuche mache, werde ich mal bei Frau Bürkel vorbeifahren und sie fragen, ob sie nicht vorübergehend Kindermädchen spielen möchte.«
»Du bist ein Schatz«, sagte Fee. »Darauf wäre ich nicht gekommen.«
»Ich habe auch erst lange alle infrage Kommenden vor meinem geistigen Auge Revue passieren lassen«, sagte Daniel. »Mir tut Martin Albrecht leid. Ein so ausgezeichneter Arzt, aber als Mensch hat er hinreichend erlebt, dass ein Unglück nicht allein kommt.«
»Er müsste doch wohl eine nette Frau finden können«, sagte Fee. »Bei seinem Aussehen und seinen Qualitäten!«
»Ich glaube nicht, dass er sich die Zeit nimmt, sich eine zu suchen und wer nicht sucht, der findet auch nicht.«
Indessen hatte Stefan Kerstin die Vorzüge seines Vaters in den lichtesten Farben geschildert. Dass er allein Kaffee kochen könne und sogar Steaks braten und seine Hemden würde er auch immer allein in die Wäscherei bringen.
Das Haus hatte er ihr genau geschildert und den Garten. »Die schönen Blumen hat Papi alle selber angepflanzt«, erklärte er. »Er mag Blumen auch sehr.«
Schwester Erika kam herein und sagte, dass Stefan im Schwesternzimmer essen könne, aber er wollte lieber gar nichts essen, als sich von Kerstin trennen.
»Nun ist die Oberschwester gekränkt«, sagte Kerstin.
»Ist mir egal«, sagte Stefan.
Schwester Petra brachte dann auch für ihn eine Portion in Kerstins Zimmer. Das gefiel ihm weit besser.
»Schwester Petra ist viel netter«, stellte er fest. »Ich kann es nicht leiden, wenn Leute einen Flunsch ziehen, und Schwester Erika zieht einen.«
»Sie sieht es sicher nicht gern, dass du so lange bei mir bist«, sagte Kerstin, die schon längst ahnte, dass die Oberschwester sehr viel für ihren Chef übrig hatte.
»Hier hat Papi zu bestimmen«, erklärte Stefan.
Werde ich ihn nicht in Schwierigkeiten bringen, dachte Kerstin. Stefan ist so naiv.
Jetzt futterte er munter drauflos. Und dann erklärte er, dass Kerstin jetzt ihre Ruhe haben müsse.
»Ich setze mich still ans Fenster und du schläfst«, sagte er. »Keiner soll sagen, dass ich dich störe.«
»Du störst mich nicht, und außerdem bin ich gar nicht müde.«
»Du brauchst aber Schlaf, damit du schnell gesund wirst«, versicherte er eifrig. »Papi hat es gesagt.« Er machte eine kleine Pause. »Es dauert ziemlich lange, bis er kommt, aber vielleicht muss er Tante Hella selbst ins Krankenhaus bringen.«
Martin kam gegen drei Uhr, und Kerstin stellte fest, dass er erschöpft und niedergeschlagen aussah. Sie verspürte das heiße Verlangen, seine Sorgen zu teilen, richtige Freundschaft mit ihm zu schließen, wie es Stefan wohl erwartete, doch ganz plötzlich traf sie dann ein Blick aus Martins Augen, der ihr eine Glutwelle durch den Körper jagte. Ihr Herz begann rasend zu klopfen, und jäh wurde ihr bewusst, dass sie beide ganz andere als freundschaftliche Gefühle füreinander empfanden.
*
Isabel ging es viel besser. Das Fieber war so schnell wieder gesunken, wie es gestiegen war, aber Fee hatte die Erfahrungen mit der diesjährigen Grippe schon öfter gemacht, und sie hoffte auch, dass der Zustand des kleinen Christian Hanke nicht so bedenklich war, wie es ausgesehen hatte. Sie hoffte das auch in Daniels Interesse, denn wenn ärztliche Hilfe bei dem Jungen zu spät kam, war es nicht auszuschließen, dass der Vater doch noch durchdrehte und die Verantwortung Daniel zuschanzte.
Vorerst wurden sie von Isabel abgelenkt, die sich nicht dazu bereitfinden wollte, im Bett zu bleiben.
»Das schwächt nur«, erklärte sie. »Heiser bin ich auch nicht mehr. Das war nur so ein Anflug.« Es war nicht gegen sie anzukommen, und so wurde sie in eine warme Decke gehüllt in einen Lehnsessel gesetzt.
»Wenn es dir heute Abend aber wieder schlechter geht, mach uns bitte nicht dafür verantwortlich«, sagte Jürgen.
»Du wirst mich mit zur Insel nehmen, da kann ich mich besser erholen«, erklärte sie.
»Höre sich doch einer diese Frau an«, sagte Jürgen kopfschüttelnd. »Was soll man nur mit ihr machen?«
»Heiraten und ihr zeigen, wer der Herr im Hause ist«, scherzte Fee.
»Wenn ihr vielleicht meint, dass ich jetzt wie eine Sufragette auf die Barrikaden gehe, habt ihr euch getäuscht«, sagte Isabel. »Ich finde es blöd, wenn eine Frau in der Ehe die Hosen anhat.«
Es ging noch eine Weile so hin und her und wie sie dann plötzlich auf Kerstin Torstensen und Tonio Laurentis zu sprechen kamen, wusste eigentlich niemand zu sagen. Isabel hatte irgendwann das Stichwort gegeben, und dann hatten sie über den Unfall gesprochen.
»Komisch, dass überhaupt nichts in der Zeitung stand«, sagte Isabel.
»Sehr komisch, dass nicht mal du etwas davon weißt«, sagte Jürgen neckend.
»Ich hatte nur im Sinn, dich zu besuchen und war dabei meinen Schnupfen auszukurieren.«
»Die Grippe«, berichtigte er nachsichtig.
»Na schön, dann Grippe. Ich hatte keine Ahnung, dass es eine werden würde, aber mich wundert, dass Laurentis nicht wieder Reklame für sich daraus geschlagen hat.«
»Ist er so?«, fragte Fee interessiert.
»Meine Güte, er ist ein eitler Geck«, sagte Isabel wegwerfend. »Er hat sich immer sehr begabte Mitarbeiter gesucht und selbst abgesahnt. Und Kerstin Torstensen hat er bis aufs Blut ausgenutzt, das ist in einschlägigen Kreisen doch bekannt. Man hat ja gemunkelt, dass er etwas mit ihr hat, aber ich glaube es nicht. Ich habe sie zwar nur einmal gesehen, aber sie ist nicht der Typ, die etwas mit einem verheirateten Mann anfängt. Es ist nur schade, dass sie in seinem Schatten schuftet und er die Erfolge einheimst. Er tritt natürlich auf wie der King persönlich. Ich kann ihn nicht ausstehen.«
»Das möchte ich dir auch geraten haben«, warf Jürgen ein.
Indessen konnte Martin eine halbe Stunde mit Kerstin allein sein. Stefan hatte sich überreden lassen, mit Schwester Petra in deren Freizeit einen kleinen Spaziergang zu machen.
»Aber nur wenn ihr euch anfreundet«, hatte er kategorisch verlangt.
Nun musste Martin allerdings erst gegen die innere Befangenheit ankämpfen, die durch diese Bemerkung noch verstärkt worden war.
Kerstin lächelte schüchtern. »Ich hätte nichts dagegen, wenn wir Stefan diesen Gefallen täten«, sagte sie stockend. »Allerdings möchte ich Sie erst darum bitten zu vergessen, was ich gestern sagte.«
Er wusste augenblicklich, was sie meinte, denn er hatte ganz vergessen, dass er sich darüber Gedanken gemacht hatte, ob sie über ihre beruflichen und finanziellen Sorgen nicht doch mit einer ganz bestimmten Absicht gesprochen hatte. Heute wäre er auf solchen Gedanken gar nicht mehr gekommen. Ein einziger Blick hatte genügt, ein Blick, der die Tür zum Himmel zu öffnen schien.
Aber ihre Worte machten ihm Mut. »Stefans Zukunftspläne gehen noch viel weiter«, sagte er.
»Er ist ein Kind, und scheinbar hat er viel Fantasie.«
»Sie haben sein Herz im Sturm erobert, Kerstin. Und meines auch«, fügte er dann leise hinzu.
Dunkle Glut stieg in ihre Wangen. Sie sah wunderschön aus. Er hätte sie immerzu anblicken können, aber er vermied es, denn das Verlangen stieg in ihm empor, sie zu küssen und gar nicht sachlich über Dinge zu reden, die ihn so sehr bewegten, dass alles andere in den Hintergrund gedrängt worden war.
»Was fehlt Ihrer Schwägerin eigentlich?«, fragte Kerstin da jedoch.
Sein Gesicht verdüsterte sich. »Ja, darüber müsste ich wohl in erster Linie mit Ihnen sprechen, so schwer es mir auch fällt«, murmelte er.
Stockend begann er zu erzählen. Zuerst hatten sich Kerstins Augen staunend geweitet, dann lehnte sie sich zurück und blickte auf die Bettdecke, um nicht in sein zerrissenes Gesicht blicken zu müssen.
»Sie haben doch damit nichts zu tun«, sagte sie leise.
»Man hat immer eine gewisse Verantwortung für seine Mitmenschen. Ich fasse es jedenfalls so auf.«
»Verantwortung trägt jeder für sich allein«, sagte Kerstin bestimmt. »Man kann die Schuld, die man sich selbst zuschreiben muss, nicht auf andere abwälzen. Ich werde Ihnen erzählen, was zwischen Laurentis und mir vorgefallen ist, und vielleicht würden Sie von Ihrem Standpunkt aus sagen, dass ich daran nicht ganz schuldlos bin.«
So hatten sie sich dann in dieser Stunde offenbart, was quälend in ihnen bohrte, und dann war Schweigen zwischen ihnen. Auch ein Schweigen voller Angst!
Martins Hände griffen nach Kerstins, ihre Blicke versanken ineinander und eine glühende Zärtlichkeit erfasste ihn, als er die Hilflosigkeit in ihren Augen las.
»Du«, sagte er verhalten, und in seiner dunklen Stimme schwang Sehnsucht. Immer näher kam sein Mund dem ihren.
Ein zauberhaftes Lächeln blühte um ihre schönen Lippen auf. »Bringt dich das nicht mit deiner Stellung in Konflikt?«, fragte sie schelmisch.
»In diesem Fall lässt es sich wohl verantworten. Würdest du meine Frau werden, Kerstin?«
»Kennen wir uns nicht zu kurz, um schon jetzt einen so schwerwiegenden Entschluss zu fassen?«, fragte sie.
»Vielleicht kannst du es nicht verstehen, aber ich habe eine entsetzliche Angst, dich zu verlieren«, sagte er.
»An wen? Es gibt niemanden. Es gibt nur noch euch. Aber ich muss meine Angelegenheiten regeln, Martin. Es wäre mir schrecklich, dich damit zu belasten. Wenn ich die Wohnung schnell wieder verkaufen könnte, wäre ich aller Verpflichtungen ledig, und es würde auch noch etwas übrig bleiben. Wenn ich doch nur nicht ans Bett gefesselt wäre.«
»Kann ich etwas für dich tun?«, fragte er.
»Hast du nicht schon genug um die Ohren?«
»Im Hinblick darauf, dass bald ein wunderschönes neues Leben beginnen kann, wird mir nichts zu viel.«
Sollten sie aber nicht lieber erst abwarten, was nun mit Hella wurde? Kerstin wollte jetzt nicht davon anfangen. Sein Gesicht war so gelöst, wie sie es noch nie gesehen hatte. Ihre Lippen hoben sich seinen entgegen, und als er sie küsste, war für Sekunden beider Denken ausgelöscht.
*
Gesagt hatten sie Stefan noch nichts, aber er spürte es, dass etwas geschehen war.
»Du hast dich mit Kerstin richtig angefreundet, Papi«, sagte er glucksend.
»Ja, wir verstehen uns sehr gut. Du hast das auch sehr fein eingefädelt, Stefan«, meinte Martin schmunzelnd.
»Ich bin schon ein bisschen gescheit, gell? Getraut hätte sich Kerstin sicher nicht, weil du in der Klinik ja der Chef bist und der Oberschwester passt es sowieso nicht, dass wir uns so gut verstehen. Sie ist zickig.«
»Sie ist sehr tüchtig, Stefan«, sagte Martin.
»Mag ja sein, aber deswegen braucht sie sich nicht einbilden, dass ich lieber mit ihr esse als mit Kerstin.«
Stefans wegen hätte der Nachmittag überhaupt kein Ende nehmen brauchen, aber Ordnung musste in einer Klinik eben sein und sein Vater erklärte ihm, dass ja nicht gleich jeder wissen müsse, dass sie sich mit Kerstin so sehr angefreundet hätten.
»Hast du sie wenigstens gleich gefragt, ob sie zu uns zieht, wenn sie aus der Klinik raus kann?«, fragte Stefan.
Es war nicht so einfach, ihn von diesem Thema abzulenken, aber Martin erklärte ausweichend, dass sie darüber ein andermal sprechen könnten.
Kaum betraten sie ihr Haus, als das Telefon läutete.
Stefan hörte aus dem Gespräch, dass Dr. Norden am anderen Ende der Leitung war.
»Das ist aber unglaublich nett von Ihnen«, sagte sein Papi. »Jetzt sitze ich aber schon ganz tief im Keller.«
»Warum sitzt du im Keller, Papi?«, fragte Stefan.
»Weil ich sehr tief in Dr. Nordens Schuld stehe. Er hat jetzt auch vermittelt, dass sich jemand um dich kümmert.«
»Wer?«, fragte Stefan ohne Begeisterung.
»Eine Frau Bürkel. Wir holen sie jetzt gleich ab.«
»Heute noch?«, fragte Stefan. »Aber wenn sie jung ist, nehmen wir sie nicht.«
»Sie ist nicht jung. Sie ist eine alte Dame, die niemanden mehr hat und sich freut, wenn sie jemanden bemuttern kann.«
»Eine Omi?«, fragte Stefan.
»Sie möchte wohl gern eine sein. Sei sehr nett zu ihr, Stefan.«
»Wenn sie dich nicht heiraten will, bin ich nett. Ich möchte nämlich ernst, dass du Kerstin heiratest. Das sage ich nicht bloß so.«
»Du musst es dir ganz fest wünschen, dann geht es wohl auch in Erfüllung«, erwiderte Martin.
»Liebe Güte, ich wünsche es doch schon dauernd. Wie lange soll ich denn noch warten, bis es in Erfüllung geht?«, fragte Stefan schon leicht ungeduldig.
»Wir wollen noch warten, bis Kerstin aus der Klinik entlassen wird.«
»Und ich bin schuld, dass sie so lange liegen muss«, sagte Stefan bekümmert. »Aber wenn ich nun vorsichtig gewesen wäre und sie nicht so gebremst hätte, dann wäre sie weitergefahren und wir hätten uns nie kennengelernt. Stimmt’s? Ich habe ja gemeint, dass der liebe Gott das gezaubert hat, aber Kerstin sagt, dass der liebe Gott nicht zaubert, sondern schenkt. Manches auch nur für kurze Zeit, aber da machen wir nicht mit, gell, Papi? Wir geben Kerstin nicht mehr her.«
»Nein, wir geben sie nicht mehr her«, sagte Martin gedankenverloren. »Wir halten sie fest.«
Stefans Augen strahlten ihn an. »Das hast du so schön gesagt«, flüsterte er. »Dafür bekommst du einen ganz lieben Kuss von mir.«
Nachdem dies geschehen war, holten sie Frau Bürkel ab. Sie war eine schlanke weißhaarige Frau, flink auf den Beinen, mit einem freundlichen, rundlichen Gesicht und rosigen Wangen. Es bedurfte keiner großen Worte. Sie fand sich schnell zurecht, und Stefan war sehr zufrieden mit dem Abschluss dieses Tages. Er fasste es in diese Worte: »Kerstin hat uns nur Glück gebracht.«
Und Frieden war in das schöne Haus eingekehrt, das nun auch auf Kerstin wartete.
Auch im Hause Norden ging alles wieder seinen Gang. Isabel hatte ihren Kopf durchgesetzt. Jürgen hatte sie mit zur Insel genommen. Er hatte warme Sachen aus ihrer Wohnung geholt und dick vermummt war sie in den Wagen gesetzt worden.
Nun kamen Daniel und Fee doch noch zu ein paar geruhsamen Abendstunden, und die hatten sie, wie Lenchen mehrmals betonte, auch verflixt nötig.
Aber die Woche ließ sich dann geruhsamer an, als sie geendet hatte. Das anhaltend schöne Wetter mochte dazu beitragen, dass sich die Kranken schneller erholten.
Als Frau Hanke aufkreuzte, meinte Fee allerdings, dass die morgendliche Ruhe trügerisch gewesen wäre.
Fee meinte, Unheil von Daniel abwenden zu müssen und erklärte ihr, dass er jetzt unmöglich Zeit für sie hätte.
Frau Hanke sagte friedfertig, dass sie warten wolle, und da waren Fee und Molly sprachlos.
»Was soll ich denn zu Hause«, sagte Frau Hanke weiter. »Christian darf ich auch nicht besuchen.«
»Geht es ihm noch nicht besser?«, erkundigte sich Molly teilnahmsvoll.
Frau Hanke zuckte die Schultern. »Mein Mann redet ja nicht mit mir«, erwiderte sie weinerlich.
Fee und Molly tauschten einen bedeutungsvollen Blick. Anscheinend wollte Frau Hanke nun Trost und Unterstützung bei Daniel suchen.
Darin hatten sie sich dann aber doch getäuscht. Auch Daniel war zuerst sehr reserviert, als sie in klagendem Ton zu reden begann, aber dann merkte er schnell, dass dieser nicht gekünstelt war.
»Ein Mensch muss mir doch mal einen Rat geben«, sagte sie. »Ich habe doch auch nicht gewollt, dass alles so kommt. Aber wenn man von der ganzen Verwandtschaft von Anfang an als Stiefmutter bezeichnet wird und Christian dauernd zu hören bekommt, wie gut seine Mutter war, und was so alles …«, sie schluchzte auf, »man kommt sich ja wie der letzte Dreck vor.«
»Nun beruhigen Sie sich mal, Frau Hanke«, sagte Daniel begütigend. »Wir können uns darüber vernünftig unterhalten.«
Er sah das nun doch schon mit anderen Augen. Man schien sie in eine Ecke gedrängt zu haben, aus der es nur ein Ausweichen gab, wenn sie sich heftig wehrte. Wahrscheinlich war ihre Gegenwehr undiplomatisch, aber wenn noch etwas zu retten war, musste das gleich geschehen.
»Erzählen Sie mir, wie das Verhältnis zwischen Ihnen und Christian wirklich war, aber ganz ehrlich, Frau Hanke. Wenn ich Ihnen helfen soll, dürfen wir nichts beschönigen.«
»Zuerst war er ganz nett. Nicht gerade lieb, nein, das kann man auch nicht sagen, aber er war nicht aufsässig. Das ging erst los, als er ein paar Wochen bei seinen Großeltern war. Mein Mann hat gesagt, dass sie doch ein Recht darauf hätten, den Jungen mal für sich zu haben. Na, und dann ging es eben damit los, dass er dauernd sagte: Meine Mami war viel lieber als du, und dann hat er auch gesagt, dass ich meinen Mann nur geheiratet habe, um ein schönes Leben zu haben. Ich wusste genau, dass man ihm das eingeredet haben musste. Ein Kind kommt doch nicht darauf von allein. Ja, und dann fing er eben damit an zu simulieren. Einmal tat ihm der Bauch weh, dann der Kopf und immer wollte er dann, dass seine Oma kommt. Ein paarmal hat mein Mann sie auch geholt. Da war Christian dann vergnügt. Es fehlte ihm nichts mehr, und alle gingen wieder auf mich los. Ich war schon ein paarmal drauf und dran, meine Sachen zu packen, aber ich habe mein Geld doch in den Betrieb gesteckt und wenn ich es rausnehme, kommt mein Mann in Schwierigkeiten. So rosig sieht es augenblicklich gar nicht aus, und ich habe ihn doch nicht geheiratet, um versorgt zu sein. Wir hatten uns alles so schön vorgestellt. Und dass Christian diesmal wirklich so krank geworden ist …«
Sie konnte nicht mehr weitersprechen. Sie schluchzte herzzerbrechend.
Ja, wie sollte man da helfen. Zuerst war Daniel auch nicht gut auf sie zu sprechen gewesen, doch jetzt tat sie ihm leid. Er redete auf sie ein und wartete bis sie sich beruhigt hatte.
»Es ging doch zuerst darum, dass Christians Großeltern verreisten und ihn mitnehmen wollten. Aber man kann ihn doch nicht einfach von der Schule wegnehmen. Nun kann er ja auch nicht gehen, aber ich habe wirklich nicht gedacht, dass er so krank werden könnte, richtig krank.«
»Er wird auch wieder gesund werden und dann werden Sie mal mit ihm verreisen. Er soll sich aussuchen, wohin er gerne fahren möchte. Mal sehen, ob sich das Verhältnis zwischen Ihnen dann nicht bessert.«
»Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Und mein Mann wird damit auch nicht einverstanden sein.«
»Ich werde mit Ihrem Mann sprechen, und Christian werde ich besuchen. Sie dürfen jetzt nicht alles restlos damit verderben, dass Sie sagen, es wird nichts mehr. Was man aufgibt ist schon halb verloren, das ist eine alte Geschichte.«
Ein bisschen Mut hatte er ihr schon eingeflößt und sie bedankte sich tausendmal, dass er ihr Gehör geschenkt hatte.
Fee war verblüfft, als sie sich auch bei ihr für die Belästigung entschuldigte.
»Nanu, was ist denn mit Frau Hanke los?«, fragte sie ihren Mann.
»Im Grunde ist sie ein armes Hascherl, wie sich herausgestelIt hat. Man hat sie zur Stiefmutter gestempelt. Sie wollte es wohl gar nicht werden, aber mit der Zeit hat man es ihr von allen Seiten einsuggeriert, und in der Trotzreaktion hat sie Fehler über Fehler gemacht. Hätte sie schon vorher mal so mit mir geredet, anstatt mir auch dauernd mit irgendwelchen eingebildeten Wehwehchen zu kommen, wäre manches wohl besser gewesen. Vielleicht«, fügte er gedankenvoll hinzu, »ob jetzt noch etwas zu retten ist, steht in den Sternen.«
*
Im Hause Albrecht sah es ganz anders aus. Da herrschte vollkommene Harmonie. Stefan wurde von Frau Bürkel pünktlich geweckt. Er konnte sich an einen liebevoll gedeckten Frühstückstisch setzen und die Freude genießen, dass sein Papi sich dafür auch Zeit nahm.
»Setzen Sie sich doch zu uns, Frau Bürkel«, sagte Martin herzlich. »Es gibt doch noch einiges zu besprechen.«
»Zurechtfinden tu ich mich schon«, erklärte sie. »Und wenn Sie mir sagen würden, was ich so kochen soll?« Ein bisschen schüchtern war sie schon noch, aber sie hatte sich ja auch nicht vorgestellt, dass der Herr Professor so ein freundlicher Mann war.
Stefan zählte gleich auf, was er gerne aß. Vor allem nichts aus Büchsen, das hatte er zu lange vorgesetzt bekommen. Er hatte seinem Papi zwar versprochen, sich nicht allzu sehr über Tante Hella zu beklagen, aber Frau Bürkel hatte schnell herausgefunden, dass hier manches im Argen zu liegen schien.
Martin gab ihr Geld, damit sie Besorgungen machen konnte, dann war es aber auch Zeit, dass sie sich auf den Weg machten.
»Ich komme schon pünktlich heim, Frau Bürkel«, versprach Stefan. »So halb eins bin ich da.« Dann lachte er sie an und sagte: »Sie sind sehr nett.«
Martin brachte Stefan zur Schule. Er bestellte Grüße an Kerstin.
»Tausend ganz liebe«, sagte er, »und einen Kuss kannst du ihr auch von mir geben, wenn es keiner sieht.«
Das tat Martin dann auch. Allerdings kam er erst am späten Vormittag dazu. Er musste ihr auch erzählen, dass nun Frau Bürkel den Haushalt versorgte.
»Dann braucht ihr mich ja gar nicht mehr«, sagte sie verschmitzt.
»Dich wollen wir ja nicht als Haushälterin«, erwiderte er zärtlich.
»Ich wage es kaum zu sagen, aber wäre es dir möglich, mir einige Sachen aus meiner Wohnung zu holen?«
»Natürlich, mein Liebes.«
»Ich habe schon aufgeschrieben, wo du alles findest. Es tut mir leid, dass ich dir nichts als Arbeit mache.«
»Ich werde gleich zusammenbrechen«, scherzte er.
»Wenn ich mich doch nur bewegen könnte«, seufzte sie.
»Ich bin froh, dass du davongekommen bist, du ungeduldiges Mädchen, und dass du eine so gute Konstitution hast.«
»Ich habe halt immer solide gelebt und viel Sport getrieben. Im Bett halte ich es nicht mehr lange aus, Martin.«
»Wir wollen froh sein, dass nichts anderes gebrochen ist, sonst müsstest du es viel länger aushalten. Nicht ungeduldig werden, Kerstin. Mit den Rippenbrüchen ist nicht zu spaßen.«
»Ich kann aber schon wieder lachen, ohne dass es wehtut.«
Aber ganz ohne Schmerzen ging es doch nicht ab. Sie nahm sich nur höllisch zusammen, doch Martin müsste kein so erfahrener Arzt gewesen sein, um das nicht zu merken. Mit ihrem Allgemeinbefinden konnte er jedoch recht zufrieden sein.
Von Schloss Riebling bekam er keine erfreulichen Auskünfte. Hella lag im Koma. Alle Bemühungen waren bisher erfolglos gewesen. Ihr Körper hatte jede Widerstandskraft aufgezehrt. Ihre Gehirnzellen arbeiteten nicht mehr.
Wieder quälte ihn die Frage, ob er das nicht hätte verhindern können. Er rief das Sanatorium an, in dem sie sich vor ein paar Jahren aufgehalten hatte. Aber auch von dort bekam er deprimierende Auskünfte. Mit einem nachhaltigen Erfolg der Entziehungskur hatte man dort nicht gerechnet. Sie sei der typische Rückfallpatient.
Jetzt war es nutzlos, sich über Unterlassungssünden den Kopf zu zerbrechen. Die Erkenntnis blieb, dass jeder Schwerkranke nur eine Chance bekam, wenn er Vertrauen in seinen Arzt setzte und Glauben in seine eigene Kraft. Ja, Liebe konnte helfen, aber wenn ein Mensch keine Liebe geben konnte, wie sollte er denn welche empfangen?
*
Stefan war pünktlich heimgekommen, wie er versprochen hatte. Lockende Düfte empfingen ihn. Schnuppernd hob er die Nase.
»Das riecht aber gut«, sagte er. »Ich habe mächtigen Hunger, Frau Bürkel.«
»Das habe ich mir gedacht«, erwiderte sie lächelnd. »Ich werde dich schon satt bekommen.«
»Papi kommt wohl nicht?«, fragte er.
»Doch, er wird gleich hier sein. Er hat eben angerufen.«
Es ging alles nach Wunsch. So geruhsam hätte Frau Bürkel sich ihre Tätigkeit gar nicht vorgestellt und als Stefan dann gegen sechs Uhr von seinem Vater wieder heimgebracht wurde, war sie richtig froh, Gesellschaft zu haben.
Martin fuhr zu Kerstins Wohnung. Das ganze Haus roch neu. Nur wenige Wohnungen waren bisher bezogen, wie es in den teuren Bauten jetzt gang und gäbe war. Einfach würde es gar nicht sein, diese Dachwohnung weiterzuverkaufen. Darüber machte sich Martin aber augenblicklich wenig Gedanken, denn als er die Tür aufschließen wollte, fand er sie unverschlossen. Und als er eintrat, sah er sich Tonio Laurentis gegenüber.
Die beiden Männer maßen sich mit einem feindseligen Blick.
»Was machen Sie hier?«, fragte Laurentis wütend.
»Das möchte ich Sie fragen«, konterte Martin scharf.
»Wie Sie bemerken dürften, bin ich im Besitz des Wohnungsschlüssels«, sagte Laurentis gehässig. »Ihre Schlüsse daraus können Sie selbst ziehen.«
Martin wurde es augenblicklich schwarz vor Augen. Seine Gedanken überstürzten sich, aber sein Verstand besiegte die Zweifel, die ihn jäh überfallen hatten.
»Schlüsse zu ziehen, erspare ich mir«, sagte er eisig. »Ich finde es befremdlich, dass Sie in eine Wohnung eindringen, deren Besitzerin ans Bett gefesselt ist.«
»Spielen Sie sich nicht auf. Diese Wohnung ist nicht mal zu einem Drittel bezahlt und ich habe noch beträchtliche Forderungen an Frau Torstensen zu stellen. Ich habe das Recht, mich zu vergewissern, dass aus dieser Wohnung nichts entfernt wird.«
»Kann ich das bitte schwarz auf weiß sehen?«, fragte Martin sarkastisch. »Ich möchte einige Sachen für Frau Torstensen holen. Sie hat mich beauftragt und Sie werden mich nicht daran hindern, Herr Laurentis.«
Er wollte an dem andern vorbeigehen, der wollte ihm den Zutritt zu den Räumen verwehren. Und in diesem Augenblick tat sich eine Tür auf und ein junges Mädchen, in einen Bademantel gehüllt, erschien. Martin verschlug es augenblicklich die Stimme.
»Ich habe die Wohnung untervermietet, damit Kerstin keine finanzielle Einbuße hat«, sagte Laurentis dreist.
»Wie interessant«, sagte Martin. »Nun, dann werde ich mal die Polizei anrufen und feststellen lassen, ob das rechtens ist.«
»Ich will nichts mit der Polizei zu tun haben«, kreischte das Mädchen los.
»Halt deinen Mund«, fauchte Laurentis sie an.
»Du hast gesagt, dass ich keine Schwierigkeiten bekomme, wenn ich hier wohne«, heulte sie.
Martin starrte sie an. Er sah auf dem Bademantel die Initialen K T und kalte Wut kroch in ihm empor.
»Und die Benutzung von Frau Torstensens Kleidung ist Ihnen auch gestattet worden?«, fragte er heiser.
Laurentis hob unbeherrscht den Arm und machte einen Schritt auf ihn zu. Doch Martin packte ihn, und obwohl er kleiner und schlanker war als der andere, hielt er ihn eisern umklammert.
»Sie Schuft«, sagte er kalt. »Das wird Sie teuer zu stehen kommen!«
Laurentis hatte doch sehr viel von seiner Überheblichkeit eingebüßt und das Mädchen heulte hysterisch und überhäufte ihn mit Vorwürfen.
Er schrie sie an. Sie verstummte, um dann schleunigst wieder im Bad zu verschwinden.
»Was wollen Sie eigentlich?«, fragte Laurentis nun. »Noch gehört die Wohnung mir. Ich habe sie Kerstin überlassen, aber nach allem, was vorgefallen ist, betrachte ich dieses großzügige Angebot als hinfällig. Sie können ihr das ausrichten, Herr Professor.« Dann kniff er die Augen zusammen und sagte drohend: »Verschwinden Sie!«
Martin war die ganze Szene zu ekelhaft. Er war entschlossen, dieser schnellstens ein Ende zu bereiten. Er griff nach dem Telefon, doch mit einer heftigen Handbewegung schleuderte Laurentis dieses auf den Boden.
»Wir werden uns in dieser Angelegenheit später wieder sprechen«, sagte Laurentis bebend vor Wut. »Über meinen Anwalt. Und im Übrigen würde ich Ihnen empfehlen, sich hübsch still zu verhalten, sofern Sie Frau Torstensen nicht in Schwierigkeiten bringen wollen.«
Zu Martins Überraschung verließ er darauf eilends die Wohnung.
»Tonio!«, schrie das Mädchen hinter ihm her.
Martin maß sie mit einem verächtlichen Blick. »Ziehen Sie sich an und gehen Sie«, sagte er. Doch dann kam ihm plötzlich der Gedanke, dass Tonio Laurentis so schnell das Feld geräumt haben könnte, um eine neue Teufelei auszuhecken.
Er beachtete das Mädchen nicht weiter, ging schnell durch die Räume, in denen eine ziemliche Unordnung herrschte, suchte Kerstins Aktenkoffer an der Stelle, die sie ihm aufgeschrieben hatte und fand ihn zu seiner Erleichterung auch.
Dann raffte er noch ein paar Sachen zusammen, sich dabei aber nicht an Kerstins Merkzettel haltend.
Das Mädchen hatte es wohl auch eilig gehabt, sich anzukleiden. Mit hochrotem Kopf raste sie an ihm vorbei aus der Tür, als er wieder in die Diele trat.
Er hielt sie fest. »Möchten Sie mir nicht wenigstens Ihren Namen nennen?«, fragte er ironisch.
»Das könnte Ihnen so passen. Aber gegen Tonio kommen Sie nicht an«, stieß sie hervor, und dann ließ er sie gehen. Was sollte es auch. Er wollte jetzt schnellstens zu Kerstin. Wieder trieb ihn eine innere Stimme dazu.
Als er in die Klinik kam, wurde er von Dr. Schilling mit besorgter Miene empfangen.
»Frau Torstensen geht es schlechter, Chef«, sagte er.
»War jemand bei ihr?«, fragte Martin erregt.
»Nein. Von ihrem Büro ist angerufen worden und da …«
»Warum wurde das Gespräch durchgestellt?«, fiel ihm Martin ins Wort.
»Ich weiß nicht. Hatten Sie auch angeordnet, dass das unterlassen werden soll?«
Die letzten Worte hörte Martin schon nicht mehr. Im Laufschritt eilte er auf Kerstins Zimmer zu. Bleich lag sie im Bett.
Als er ihre Hand ergriff, richtete sie einen kummervollen Blick auf ihn, der ihn erschütterte.
»Dass du überhaupt noch zu mir kommst«, flüsterte sie.
»Hat Laurentis dich angerufen, Kerstin?«, fragte er atemlos.
Sie nickte, dann drehte sie den Kopf zur Wand. »Er hat gesagt, dass er dich mit einem Mädchen in der Wohnung angetroffen hätte.«
»Und du hast es geglaubt?«, fragte Martin bestürzt.
»Kein Wort, aber was hat er dir gesagt? Dass er Rechte an der Wohnung und auch an mir hat?«
Er beugte sich zu ihr herab. »Logisch denken kannst du wenigstens noch«, sagte er erleichtert. »Liebes, es ist zu hässlich, dass wir darüber auch noch sprechen. Wir überlassen das alles meinem Anwalt. Ich habe deinen Aktenkoffer geschnappt und ein paar Sachen und bin sofort hergefahren. Ahnte ich es doch, dass er etwas ausheckt.«
»Du hast den Aktenkoffer?«, fragte Kerstin erregt. »Gott sei Dank. Ich dachte schon, er hätte ihn auch an sich genommen. Ist er noch verschlossen?«
»Alles in Ordnung. Reg dich doch nicht so auf, dann musst du noch länger liegen.« Er legte den Arm um sie und presste seine Lippen an ihre Stirn. »Ich liebe dich, Kerstin, und daran wird niemand etwas ändern. Hast du deine privaten Papiere auch in diesem Aktenkoffer?«
Sie nickte wieder. Und da bedeckte er ihr Gesicht mit zärtlichen Küssen.
»Dann gib sie mir, damit ich gleich das Aufgebot bestellen kann. Und wir werden doch mal sehen, was Herr Laurentis gegen meine Frau unternehmen kann.«
»Erzähle mir erst, was wirklich in der Wohnung vorgefallen ist«, bat sie.
»Später einmal.«
»Nein, ich will es wissen. Ich muss es jetzt wissen.«
»Es ist schmutzig, Kerstin. Als Arzt muss ich darauf bedacht sein, meiner Patientin jede vermeidbare Aufregung zu ersparen.«
»Dann sieh jetzt bitte nicht deine Patientin in mir, sondern deine zukünftige Frau, wenn du immer noch nicht abgeschreckt bist.«
»Meinst du, dieser Pseudokavalier könnte mich abschrecken?«
»Ich habe ihn einmal bewundert, Martin. Ich hielt ihn für ein Genie.«
»Auch Genies sollen manchmal menschliche Schwächen haben.«
»Du sollst mich nicht ablenken. Ich will wissen, was in der Wohnung passiert ist«, drängte sie.
*
Sie hatte, wohl dosiert, alles erfahren und es war das Tüpfelchen auf dem »i« gewesen. Martin hatte seinen Anwalt eingeschaltet. Laurentis war mit seinem gekommen. Doch geschlossen standen alle Mitarbeiter hinter Kerstin. Man konnte wohl sagen, dass sich der berühmte Architekt Laurentis ins eigene Fleisch geschnitten hatte. Eines Tages konnte man in der Zeitung lesen, dass Tonio Laurentis sich in die Schweiz zurückgezogen hatte.
An diesem Tage konnte Kerstin die Klinik verlassen. Nun war es schon kein Geheimnis mehr, dass sie Professor Albrechts Frau werden würde. Selbst Oberschwester Erika hatte sich damit abgefunden. Schwester Ruth war ganz still geworden. Für sie war es ein herber Schlag, dass Dr. Schilling sich mit Schwester Petra verlobt hatte.
Noch viel mehr war in den drei Wochen, die bis zu diesem Tag noch vergangen waren, passiert. Stefan hatte die Nordens und Lenchen ein paarmal besucht, immer in Begleitung von Fanny Bürkel, die er schlicht Fanny nannte und die auch im Haushalt des Professors bleiben wollte, wenn die junge Frau Albrecht dort Einzug hielt.
Fanny Bürkel brauchte ihren Lebensabend nicht einsam zu verbringen. Sie war zu einem Omi-Ersatz für Stefan geworden, der sich als glücklichstes Kind der Welt fühlte.
Hella war im Sanatorium gestorben, ohne aus dem Koma zurückgeholt werden zu können. Ein verpfuschtes Leben hatte ein undramatisches Ende gefunden.
Bei der Nachricht hatte Stefan nachdenklich gefragt: »Warum hat sie uns nicht gesagt, dass sie so krank ist, Papi? Sie hätte doch früher schon ins Sanatorium gehen können.«
Dass er sie nicht vermisste, konnte man ihm nicht verdenken. Für Martin blieb die deprimierende Erkenntnis zurück, Jahre mit einem Menschen unter einem Dach gelebt zu haben, ohne ihn richtig gekannt zu haben. Aber Hella hatte ja nicht durchschaut werden wollen und die Täuschung war ihr gelungen, bis sie in sich selbst zerbrach.
Für Dr. Norden und seine Frau Fee waren solche Fälle nicht ungewöhnlich. Ein Arzt für Allgemeinmedizin wurde öfter damit konfrontiert als ein Unfallchirurg. Und wie sehr man einen Menschen verkennen konnte, bewies die Ehe der Hankes.
Daniel hatte Herrn Hanke ins Gebet genommen, er hatte auch den kleinen Christian besucht und ihm ganz diplomatisch klargemacht, wie schlimm es einem ergehen konnte, wenn man Schmerzen vortäuschte, die gar nicht vorhanden waren. Nun war er schon mit seiner »Mutti«, er nannte Frau Hanke jetzt tatsächlich so, auf dem Wege zur Nordsee. Er hatte es sich gewünscht, dorthin zu fahren, viel lieber als in die Berge zu seinen Großeltern. Das wäre ja immer dasselbe, hatte er gemeint.
Mit Einfühlungsvermögen und Nachsicht konnte man selbst einen Trotzkopf bekehren. Für die Nordens war es eine freudige Überraschung, dass die Hankes nun auch auf dem Wege waren, eine harmonische Familie zu werden.
Eine ganz glückliche bildete indessen längst das Ehepaar Fichte mit ihrem kleinen Daniel. Jener Freitag der Dreizehnte schien seine Schrecken verloren zu haben. Erinnern würden sich wohl alle an ihn, für die er von besonderer Bedeutung gewesen war.
Für Professor Martin Albrecht und seinen Sohn Stefan, wie auch für Kerstin Torstensen war er schicksalhaft gewesen und der Beginn zu einem neuen Leben, wenn es auch anfangs nicht so ausgesehen hatte.
Dr. Daniel Norden wurde als Trauzeuge gebeten und für die Aufgabe nahm er sich mal einige freie Stunden. Dass Fee dabei sein musste, verstand sich von selbst, und für Frau Bürkel war es die größte Ehre ihres Lebens, auch Trauzeuge zu sein, und das bei einem Professor, den sie insgeheim schon »ihren« Professor nannte.
Ein rauschendes Fest gab es nicht. Martin und Kerstin genügte es im Kreise der Menschen zu sein, die ihre Freunde geworden. Dass es festliche Stunden wurden, dafür sorgten Frau Bürkel und Lenchen, die in ihren Koch- und Backkünsten wetteiferten.
Stefan war überglücklich, dass sie alle beisammen waren, dass seine Kerstin ganz gesund war und schöner denn je.
Unendlich zärtlich klang seine Stimme, wenn er Mami sagte, und dann schenkte er seinem Papi auch immer einen strahlenden, dankbaren Blick.
Die Flitterwochen wurden verschoben bis zu den großen Ferien, denn keinen Tag wollten sie sich von Stefan trennen, dem sie eigentlich doch ihr großes Glück zu verdanken hatten, das mit einem Unglück begonnen hatte.
In ihrem neuen Wagen, den Martin ihr zur Hochzeit geschenkt hatte, fuhr Kerstin Stefan jeden Tag zur Schule. Und so sollte es auch einmal geschehen, dass ihr beinahe wieder ein kleiner Junge gedankenlos vor den Wagen lief. Aber Kerstin war ja mit ihren Gedanken immer ganz bei der Sache und stets vorsichtig. Der Junge kam mit dem Schrecken davon und Stefan mit einer neuen Weisheit.
»Der hat vielleicht auch keinen, der ihn rechtzeitig weckt und der gern eine liebe Mami haben möchte«, flüsterte er. »Aber eine so liebe wie dich gibt es ja nicht noch einmal.«
In diesem Punkt war er mit seinem Papi völlig einer Meinung, aber in erster Linie war Kerstin für ihn doch seine über alles geliebte Frau. Hätte er aber ohne Stefans Hilfe gewagt, die entscheidende Frage zu stellen?
Darüber wollten sie nicht mehr nachdenken, auch an Vergangenes wurden keine unnützen Gedanken verschwendet. Die Gegenwart gehörte ihnen, und was immer die Zukunft noch bringen sollte, wollten sie gemeinsam tragen.
Daniel und Fee aber hatten endlich wieder einmal Zeit, ein Wochenende auf der Insel der Hoffnung zu verbringen, wo sie sehr vermisst worden waren.
»Habt ihr die Grippezeit endlich hinter euch gebracht«, wurden sie von Dr. Cornelius empfangen.
»Und manches andere auch, Paps«, erwiderte Fee, und dann staunten sie, als eine blendend aussehende Isabel ihnen entgegenkam.
»Deine Grippe hat aber lange gedauert«, sagte Daniel neckend.
»Ich bin Rekonvaleszentin«, erwiderte sie heiter. »Ärztlich betreut und streng bewacht.«
Daran zweifelte allerdings niemand, als Jürgen gleich eifersüchtig Ausschau hielt, wem sie da wohl um den Hals fiel.
»Und was gibt es bei euch, Hannes?«, fragte Daniel seinen Schwiegervater.
»Glaubt nur nicht, dass es in einem Sanatorium langweilig zugeht«, erwiderte Dr. Cornelius lachend. »Aber die Grippebazillen haben sich glücklicherweise nicht zu uns vorgewagt. Unsere Patienten konnten sich richtig erholen.«
Daniel nahm seine Fee in den Arm. »Und das werden wir jetzt auch tun. Wenigstens für ein Wochenende. Hat jemand was dagegen, dass wir erst mal richtig faulenzen?«
Das Gegenteil war der Fall. Alle waren darauf bedacht, dass der himmlische Friede, den sie genossen, nicht gestört wurde.
- E N D E -