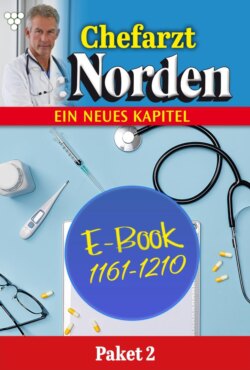Читать книгу Chefarzt Dr. Norden Paket 2 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVor der Behnisch-Klinik hielt Nadja Dannehl kurz inne. Sie sah an dem Gebäude hoch, auf der Suche nach einem bestimmten Fenster in der dritten Etage. Das musste es sein. Ein schmales, unscheinbares Fenster, an dem sie oft gesessen hatte, um das geschäftige Treiben vor dem Haus zu beobachten, in der Hoffnung, für kurze Zeit ihren großen Kummer vergessen zu können. Dreißig Jahre war es her. Nadja musste schlucken. Eine halbe Ewigkeit.
Unbewusst strich sie über die schmale, kaum sichtbare Narbe an ihrem linken Handgelenk. Nur leicht erhaben, etwas blasser als ihre Umgebung, wirkte sie unschuldig und bedeutungslos. Doch das war sie nie gewesen. Weder damals, nach dem Unfall, noch heute. Diese Narbe erinnerte sie in jeder Minute ihres Lebens daran, was das Schicksal ihr genommen hatte: Eine große Karriere als Violinistin.
Sie war Anfang zwanzig, als sie sich bei einem harmlos anmutenden Sturz das Handgelenk brach – mit gravierenden Folgen: zersplitterte Knochen, beschädigte Bänder. Ihr Handgelenk hatte dadurch einen Teil seiner Beweglichkeit unwiederbringlich verloren und zudem eine schmerzhafte Arthrose entwickelt. Für eine Violinistin mit riesigen Ambitionen eine schreckliche Katastrophe.
Dort oben, in diesem kleinen Krankenhauszimmer, hatte sie ihre großen Träume und Hoffnungen von einer ruhmreichen Karriere tränenreich begraben. Es hatte nie einen Plan B gegeben, sondern immer nur ihre Geige. Nie war ihr das Leben so trist und sinnlos erschienen wie an diesen Tagen. Wenn Horst nicht gewesen wäre …
Horst war ihr in dieser schweren Zeit kaum von der Seite gewichen. Er musste geahnt, nein, gewusst haben, wie oft sie darüber nachdachte, dieses kleine Fenster da oben zu öffnen, um ihrer Qual für immer zu entfliehen.
Irgendwann wurde es dann leichter, das Unvermeidliche zu ertragen. Und irgendwann hatte sie sich in Horst verliebt und ihn geheiratet. Als dann Sophie, ihre kleine, süße Sophie zur Welt kam, war die Trauer um ihre zerstörten Träume ausgestanden. Sie hatte eine Tochter, um die sie sich kümmern konnte und die mit dem gleichen, großartigen Talent gesegnet war wie ihre Mutter. Ihr Leben bekam nun wieder einen Sinn. Schon als Sophie mit vier Jahren die ersten Streichübungen auf ihrer winzigen Kindergeige machte, hatte Nadja gewusst, dass es ihr Engelchen weit bringen würde. Auch Sophies Geigenlehrerin hatte früh davon gesprochen, dass das kleine wissbegierige Mädchen ein Ausnahmetalent sei. Das Beherrschen des Instruments hatte ihr nie Mühe bereitet. Wie von selbst fanden ihre zarten Finger stets den richtigen Ton auf den Saiten. Es dauerte nicht lange, bis Sophie die ersten Preise gewann und aus immer bedeutenderen Wettbewerben als Siegerin hervorging. Als dann die Erfolge bei internationalen Ausscheidungskämpfen dazukamen, flatterten bald Angebote von Agenturen ins Haus. Sophie war gerade mal siebzehn, als Nadja für sie den Vertrag bei einer New Yorker Agentur unterschrieb. Schon am nächsten Tag verließen sie gemeinsam München. Jetzt, nach zehn Jahren, gehörte Sophie zu den besten Violinistinnen der Welt. Sie hatte es weit gebracht. Viel weiter als ihre Mutter, der dieser dumme Sturz die Chance auf ein erfülltes Leben genommen hatte.
Nadja betrat die Behnisch-Klinik und ging durch die lichtdurchflutete Lobby. Ihrem Vorhaben, direkt zum Chefarzt der Klinik zu gehen, widerstand sie. Sie hatte noch eine Viertelstunde Zeit bis zu ihrem Termin. Nadja konnte es nicht leiden, wenn sich die Menschen nicht an verabredete Zeiten hielten. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie zu früh oder bereits zu spät dran waren. Für beides brachte sie kein Verständnis auf.
Zügig ging sie die kleine Ladenzeile am Ende der Lobby entlang. Für die Geschäfte mit ihren hübschen Auslagen hatte sie keinen Blick übrig. Auch nicht für die Cafeteria, die sie zu ihrer rechten Seite liegen ließ. Sie kannte nur ein Ziel: den wunderschönen Klinikpark, der von der früheren Besitzerin der Klinik, Jenny Behnisch, eigenhändig angelegt worden war.
Sie trat durch die zweiflügelige Terrassentür hinaus ins Grüne und atmete tief durch. Mit dem Duft der Frühlingsblumen und der Fliederbüsche strömten auch Erinnerungen in ihren Geist. Erinnerungen an eine Zeit, in der sie hier, inmitten der üppig wachsenden Natur, lernte, den Schmerz über das Ende ihrer Karriere zu überwinden.
Wie von selbst führten sie ihre Füße einen schmalen Weg aus behauenem Granit entlang, vorbei an riesigen Strauchpäonien bis zu einer kleinen, versteckt liegenden Holzbank. Hier hatte sie mit Horst in endlos langen Stunden zusammengesessen und schließlich ihre Liebe für ihn entdeckt. Mit einem leisen, wehmütigen Seufzer sah sie sich um. Die kleinen, zarten Pflanzen waren inzwischen zu stattlichen Büschen und kräftigen Bäumen herangewachsen. Und natürlich wuchsen nicht mehr dieselben Blumen in den Beeten. Aber Nadja hätte den Garten trotzdem unter allen Gärten dieser Welt wiedererkannt, so vertraut war er ihr noch heute.
Sie schloss die Augen und hielt ihr Gesicht der wärmenden Frühlingssonne entgegen. Entrückt lauschte sie dem sanften Rauschen der Blätter, die sich in dem lauen Frühlingswind wiegten. Plötzlich wünschte sie sich, sie könnte für immer hier sitzenbleiben und einfach nur sie selbst sein. Oder ein wenig länger in ihren Erinnerungen verweilen. Erinnerungen an eine Zeit, in der sie nicht die knallharte Geschäftsfrau und Managerin ihrer berühmten Tochter war, sondern einfach nur eine liebende Mutter - und Ehefrau. Der Gedanke an Horst und an ihre Ehe, die vor vielen Jahren zerbrochen war, brachte sie in die Wirklichkeit zurück. Sie sprang auf und verließ den Park so schnell, als hätte sie Angst, nie wieder aus ihm oder ihren Erinnerungen herauszufinden.
Bevor Nadja an die Tür, die ins Vorzimmer des Chefarztes führte, anklopfte, überprüfte sie hastig den korrekten Sitz ihres eleganten Businesskostüms und kontrollierte mit flinken Handgriffen, ob der leichte Wind ihrer strengen Hochsteckfrisur geschadet hatte. Ihr gutes Aussehen war Nadja wichtig. Nicht nur, weil ihr die anerkennenden Männerblicke schmeichelten. Ein makelloses Erscheinungsbild passte zu ihrem Wunschbild von Perfektion und gediegener Eleganz.
»Mein Name ist Nadja Dannehl. Ich habe einen Termin bei Dr. Norden.« Nadja sprach kühl und ein wenig herablassend, als sie sich der Assistentin des Chefarztes vorstellte. Ihr war es recht, wenn sich Fremde von ihrem Auftreten einschüchtern ließen. Sie trat nie als Bittstellerin auf, sondern als diejenige, die forderte und keinen Widerspruch duldete. In einer Welt, die immer noch von Männern dominiert wurde, durfte sie nicht schwach wirken. Das machte sie nur angreifbar und verletzbar. Das Musikgeschäft war hart, und es überlebten nur diejenigen, die die Regeln verstanden und danach lebten. Nadja hatte früh gelernt, dass es vorteilhafter war, für eine eiskalte, gefühllose Geschäftsfrau gehalten zu werden als für ein liebenswertes Dummchen. Sie hatte ihr Verhalten so schnell angepasst, dass sie inzwischen selbst nicht mehr wusste, was davon bloße Fassade war.
»Guten Tag, Frau Dannehl«, empfing Katja Baumann, die Assistentin des Chefarztes, ihre Besucherin mit einem freundlichen Lächeln, das ehrlich und nicht aufgesetzt wirkte. »Dr. Norden wird gleich bei Ihnen sein. Er ist im Augenblick noch …« Sie brach ab, als sich die Tür öffnete und Daniel Norden hereinkam.
»Frau Dannehl!«, begrüßte er sofort seine Besucherin. »Es ist schön, Sie wiederzusehen!«
»Ja, mir geht es genauso, Dr. Norden. Sophie und ich sind nur für wenige Tage in München. Ich freue mich, dass Sie es einrichten konnten, mich zu empfangen.«
Daniel begleitete Nadja Dannehl in sein Büro und bot ihr einen Platz an. Nachdem Katja ihnen den Kaffee gebracht hatte, sagte er: »Ich hoffe, Sie sind nur der guten, alten Zeiten wegen vorbeikommen und nicht wegen gesundheitlicher Probleme.«
Nadja lächelte. »Nein, keine Sorge. Mir geht es gut. Ich wollte es mir einfach nicht nehmen lassen, meinen ehemaligen Hausarzt zu besuchen. Ich war sehr überrascht, als ich erfuhr, dass Sie inzwischen Chefarzt der Behnisch-Klinik sind. Ich hatte immer gedacht, dass Sie Ihre Praxis niemals aufgeben würden.«
»Das kam für viele sehr überraschend.« Daniel schmunzelte. »Selbst ich hätte es mir Jahre zuvor nicht vorstellen können. Aber ich liebe nun mal Herausforderungen, und die ärztliche Leitung einer Klinik zu übernehmen, stellte eine sehr große dar. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Außerdem wusste ich, wie viel Gutes ich hier bewirken kann.«
Nadja nickte verstehend. »Jeder Arzt hätte diese Chance ergriffen. Zumindest jeder, der etwas auf Prestige und Ansehen hält und ein wenig ehrgeizig ist. Der Chefarztposten ist sicherlich der höchste Punkt auf der Karriereleiter, den ein Arzt überhaupt erreichen kann.«
Das Lächeln auf Daniels Gesicht ließ deutlich nach. »Sie irren sich, Frau Dannehl, wenn Sie annehmen, dass es der Wunsch nach Ansehen oder Karriere war, der mich dazu brachte, meine Praxis abzugeben. Ich bin Arzt geworden, weil ich kranken Menschen helfen wollte. Ob in einer kleinen Hausarztpraxis oder in einer großen Klinik, hat dabei nie eine Rolle gespielt. Ich habe meine Arbeit als Hausarzt sehr geliebt und nie als gering eingeschätzt.«
»Natürlich, Dr. Norden«, erwiderte Nadja mit einem dünnen Lächeln. Sie verstand nicht, dass es einigen Menschen so schwerfiel, offen und ehrlich zuzugeben, wie wichtig ihnen Erfolg, Ruhm und Anerkennung waren. Dr. Daniel Norden mochte ruhig weiter so tun, als würde er aus edlen, uneigennützigen Motiven handeln. Sie wusste es besser.
»Sie wissen vielleicht, dass Sophie einige Auftritte in München hat«, kam sie zum eigentlichen Grund ihres Besuchs.
»Ja, sie wurden in allen regionalen Zeitungen schon vor Monaten angekündigt.« Daniel war froh, dass Nadja Dannehl das Thema wechselte. Er hatte weder die Zeit noch die Geduld, eine langwierige und wenig erfolgversprechende Diskussion über ärztliche Ethik und Moral zu führen. »Ich habe gehört, dass alle Tickets schnell vergriffen waren. Meine Frau und ich sind deshalb sehr froh, noch zwei für Sophies Auftritt im ›Gasteig‹ bekommen zu haben.«
Nadja winkte seufzend ab. »Ach, die Sache im ›Gasteig‹ ist kaum der Rede wert. Sophie ist dort nur ein Akt unter vielen anderen. Ein kurzer Auftritt von nicht mal zehn Minuten! Ich verstehe nicht, warum Sophie darauf bestanden hatte, dieses Angebot anzunehmen.«
»Vielleicht gefällt es ihr einfach, in ihrer alten Heimatstadt zu spielen?« Nachdenklich runzelte Daniel die Stirn. »War sie überhaupt jemals wieder in München, seit sie vor zehn Jahren die Stadt verlassen hat?«
»Nein! Warum sollte sie auch? München ist schon längst nicht mehr ihre Heimat. Es gibt hier nichts, was ihr etwas bedeuten könnte.«
»Ich dachte immer, dass Sophies Vater in München lebt. Außerdem hat sie doch sicher auch noch Freunde hier.«
»Nein, eigentlich nicht«, erwiderte Nadja leichthin. »Sophie hat sich ein neues, ein sehr gutes Leben aufgebaut. Da ist für alte Freundschaften kein Platz. Und was ihren Vater anbelangt …« Nadja verzog unwillig den hübschen Mund. »Er hatte nie verstanden, wie wichtig Sophies Karriere war. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass es keine enge Bindung zwischen ihm und seiner Tochter gibt. Mit der Zeit sind sie sich einfach fremd geworden.«
Am Abend erzählte Daniel seiner Frau von Nadja Dannehls Besuch. »Ich hatte mich wirklich auf ihr Kommen gefreut«, sagte er abschließend. »Aber sie hat sich sehr verändert. Nicht nur äußerlich. Ich musste schmunzeln, als ich sie sah. Es gibt nicht mehr viel, was an die bescheidene, nette Hausfrau von früher erinnert. Glanz und Gloria scheinen ihr inzwischen sehr wichtig zu sein.«
Fee stellte die Schale mit dem frischen Salat auf den Tisch und sagte: »Ich denke, diese Sachen waren ihr schon immer sehr wichtig gewesen. Sie hatte immer nach Höherem, nach etwas Besserem gestrebt. Nadjas übertriebener Ehrgeiz, den sie an ihrer Tochter auslebte, war ziemlich auffällig. Wahrscheinlich hat es Sophie deswegen so weit gebracht.«
»Vergiss nicht Sophies großes Talent. Ohne dem wäre sie bestimmt keine Stargeigerin geworden.«
»Talent ist nicht alles, mein Liebling«, erwiderte Fee und setzte sich zu ihrem Mann an den Tisch. »Es muss gefördert und gepflegt werden. Und da hat Nadja Dannehl ganze Arbeit geleistet. Ihr Ziel war es schon immer gewesen, Sophie ganz groß rauszubringen. Das ist ihr gelungen.«
Daniel gab ihr nun endlich den Umschlag, den er als kleine Überraschung dabeihatte.
»Was ist das?«, fragte Fee.
»Nadja Dannehl hat mir zwei Karten für Sophies Konzert im ›Prinzregententheater‹ gegeben.«
»Für das am nächsten Samstag?«, rief Fee freudig aus. »Das ist seit Monaten ausverkauft!«
»Ich weiß, Feelein«, erwiderte Daniel lächelnd. »Frau Dannehl meinte, sie würde sich sehr freuen, uns dort zu sehen. Natürlich nur, falls wir nichts anderes vorhaben.«
»Wir haben ganz sicher nichts anderes vor!« Fee nahm ihm den Umschlag aus der Hand und holte die Karten heraus. »Wir werden uns dieses Konzert bestimmt nicht entgehen lassen!«
*
Ein ausverkauftes Haus! Diese Nachricht löste in Sophie Dannehl keine Jubelstürme mehr aus. Seit Jahren spielte sie nur in ausverkauften Häusern. Die Menschen rissen sich darum, ihrem virtuosen Geigenspiel zu lauschen, und die Presse überschüttete sie schon im Vorfeld mit Lobeshymnen.
Sophie stand hinter dem schweren Vorhang, spähte durch einen schmalen Schlitz in den Zuschauerraum und sah zu, wie er sich stetig füllte. Ein Fehler, wie sie wusste. Es tat ihr nicht gut und steigerte nur ihr Lampenfieber. Lange hatte sie gehofft, dass ihre schreckliche Angst, vor Publikum zu spielen, nachlassen würde. Sie würde mit der Zeit routinierter und gelassener werden, hatte sie sich eingeredet. Doch statt dass es leichter wurde, nahm ihre Aufregung von Auftritt zu Auftritt zu. Nur mit dem Wissen, dass das Lampenfieber weg war, sobald sie draußen stand und den ersten Bogenstrich machte, schaffte sie es überhaupt, eine Bühne zu betreten.
»Was machst du denn hier?«, zischte Nadja Dannehl neben ihrer Tochter. »Ich suche dich schon überall!«
»Ich wollte nur mal sehen, ob ich ein bekanntes Gesicht entdecke. Schließlich spiele ich in München. Wäre doch möglich, dass jemand von früher …«
»Lass mal sehen!« Nadja schob ihre Tochter zur Seite und sah nun ihrerseits zu den Zuschauern hinaus. »Dr. Norden ist mit seiner Frau gekommen. Aber ansonsten kenne ich niemanden.« Sie trat zurück und sagte mit einem gereizten Unterton: »Und nachdem wir das nun geklärt haben, sollten wir endlich von hier verschwinden, damit du dich für deinen Auftritt vorbereiten kannst. Hast du dich schon eingespielt?«
Sophie seufzte. »Ja, Mama. Darum brauchst du dich wirklich nicht zu kümmern. Ich weiß, was ich tue.«
Nadja warf ihrer Tochter einen strengen, prüfenden Blick zu. Sophie trug ein tiefschwarzes Kleid aus schimmernder Seide mit einem weit ausgestellten Rock und einem engen, schulterfreiem Oberteil. Ihre Haare, die den gleichen satten Braunton hatten wie Nadjas, waren im Nacken zu einem locker sitzenden Knoten zusammengeschlungen. Ihr zartes, elfengleiches Gesicht mit den großen dunklen Augen war ein wenig blass und ließ die grazile, junge Frau noch zerbrechlicher wirken.
»Vielleicht solltest du noch einmal in die Maske gehen und ein wenig Rouge auftragen lassen«, sagte Nadja missbilligend. »Was sollen die Leute von dir denken, wenn du so bleich auf die Bühne trittst? Außerdem habe ich ein paar Pressefotografen entdeckt. Du willst auf den Bildern doch bestimmt nicht krank wirken. Heute siehst du besonders schlimm aus.«
»Es geht mir auch nicht so gut. Vielleicht der Jetlag...«
»Unsinn!«, entfuhr es Nadja. Dann sagte sie leiser werdend: »Wir sind seit drei Tagen in München! Wir wissen beide, was los ist! Du und dein dummes Lampenfieber! Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Kannst du dich denn nicht ein wenig zusammenreißen?«
»Das mache ich seit zehn Jahren«, stieß Sophie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Du siehst ja selbst wie super das klappt! Deine gutgemeinten Ratschläge kannst du dir also sparen!«
»Sophie!«, rief Nadja erschrocken aus. »Wie sprichst du mit mir?«
»Entschuldige, Mama«, lenkte Sophie sofort ein. »Es ist nur …« Mitten im Satz brach sie müde ab. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt für unliebsame Diskussionen. Sie sah wieder hinaus in den Zuschauersaal. Mit einer Hand strich sie sich über ihren Bauch, um den nervösen Magen zu beruhigen. Ihre Angst hatte zugenommen, der Mund war trocken, und die Luft wurde immer knapper, obwohl sie versuchte, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Sie wusste, dass das die ersten Anzeichen einer aufziehenden Panikattacke waren. So heftig wie heute war es schon lange nicht mehr gewesen. Ob es daran lag, dass sie in ihrer alten Heimat spielte? München – hier hatte alles begonnen, und hier sollte alles enden. Falls sie den Mut dafür aufbringen würde.
»Bist du nun endlich fertig?«, fragte Nadja ungeduldig.
Sophie nickte stumm und warf noch einen letzten Blick in den Saal, als ihre Augen an einer seltsam vertrauten Gestalt hängenblieben. Sofort geriet ihr Herz aus dem Takt. Das konnte unmöglich sein! Dieser Mann, der gerade hereinkam, konnte doch unmöglich Julian sein! Sie vergaß ihre wartende Mutter und sah angestrengt in seine Richtung, um einen weiteren Blick auf ihn zu bekommen. Doch er hatte ihr inzwischen den Rücken zugedreht und trat in eine der hinteren Reihen, um zu seinem Platz zu gelangen. Mehr als ein paar breite Schultern unter einem dunklen Jackett konnte sie von ihm nicht sehen. Julian war damals schmaler gewesen, fiel ihr ein. Allerdings waren seitdem zehn Jahre vergangen. Die Statur eines achtzehnjährigen Jungen war oft nicht die eines Mannes, der langsam auf die Dreißig zuging.
Sophie wurde ungeduldig. Warum dauerte es nur so lange, bis er an seinem Platz ankam? Warum sah sie von ihm nicht mehr als diese dunklen Haare, die sie so sehr an Julians erinnerten. Julian, den sie geliebt hatte und der ihr siebzehnjähriges Herz gebrochen hatte, ohne mit der Wimper zu zucken. Sollte er wirklich hergekommen sein, um sie spielen zu hören? Er hatte nie ein besonderes Interesse an ihrer Musik gezeigt. Julian hatte immer auf Hardrock gestanden. Es war also ziemlich unwahrscheinlich, dass ihn Beethoven und Brahms hergelockt haben könnten. Doch wenn es nicht die Klassiker waren, dann vielleicht sie? Sofort verwarf Sophie diesen Gedanken wieder. Nein, sie hatte ihm damals nichts bedeutet und jetzt erst recht nicht. Und wahrscheinlich war er es gar nicht, und es gab keinen Grund, über Julian nachzudenken. Julian … Sophies Gedanken drifteten erneut ab. Plötzlich war sie wieder siebzehn und zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt. Sie war so glücklich gewesen wie nie zuvor. Wenn sie an diese Zeit zurückdachte, kam sie ihr manchmal so unwirklich vor wie ein wunderschöner, zarter Traum, aus dem man am Morgen nicht erwachen mochte.
Sophie schrak zusammen, als sich die Hand ihrer Mutter um ihren Unterarm legte und sie unsanft vom Vorhang weggezogen wurde. »Sophie, was ist denn heute nur los mit dir?«, schimpfte Nadja leise, während sie Sophie zur Maske bugsierte.
»Nichts, mit mir ist alles in Ordnung«, erwiderte Sophie unwirsch und entriss ihrer Mutter den Arm. Wann würde ihre Mutter endlich aufhören, sie wie ein kleines Kind zu behandeln? «Ich bin nur etwas nervös, aber das ist ja nichts Neues.«
Nadja musterte ihre Tochter aufmerksam und mehr als beunruhigt. Was war nur mit ihrem sanftmütigen Engelchen los? Sophie machte sonst nie Probleme. Sie funktionierte so präzise und verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Schon früh hatte Sophie gelernt, dass das unerlässlich war, um eine erfolgreiche Musikerin zu werden. Doch seitdem sie in München waren, hatte sich ihre Tochter verändert, und Nadja machte sich zunehmend Sorgen deswegen.
Als sie vor der Maske ankamen und Sophie hineingehen wollte, hielt Nadja sie auf. »Ich hatte mir doch gleich gedacht, dass es keine gute Idee war, nach München zu kommen und dafür das Angebot aus Stockholm auszuschlagen. Warum du so darauf bestanden hast, werde ich wohl nie verstehen.«
Sophie schien über die Antwort erst nachdenken zu müssen. Schließlich sagte sie ruhig: »Ich dachte, es wurde mal Zeit nach Hause zu kommen.«
»Nach Hause? In München sind wir schon lange nicht mehr zu Hause.«
»Wo dann?« Sophie sah ihre Mutter direkt an. Als Nadja sie nur erstaunt ansah, wurde ihre Frage drängender: »Wenn nicht hier, wo ist dann unser Zuhause?«
»Was weiß ich denn! Überall wahrscheinlich. Die Welt ist unser Zuhause. Was soll dieses Theater?«
»Schon gut, Mama, vergessen wir das einfach.« Sophie drehte sich weg und ging in die Maske.
Nadja verharrte noch eine Weile auf dem Gang und dachte über die letzten Minuten nach. Immer mehr wuchs die Gewissheit, dass irgendetwas nicht stimmte. Ein klammes Gefühl befiel sie und die böse Vorahnung, dass das Münchner Gastspiel anders sein würde als alle anderen. Ganz anders - und das bedeutete nichts Gutes.
*
Nadja Dannehl hatte dafür gesorgt, dass Fee und Daniel Norden auf den besten Plätzen in der ersten Reihe saßen. Noch bevor das Konzert begann, war sich Fee sicher, dass dies ein ganz besonderer Abend werden würde. Sie hatte eine Schwäche für Violinkonzerte, und der Auftritt einer so grandiosen Geigerin wie Sophie Dannehl versprach einen exquisiten Hochgenuss.
Kaum betrat Sophie die Bühne, klatschte das Publikum lautstark und drückte so seine Begeisterung darüber aus, dass ihr Münchner Kindl endlich heimgekehrt war. Mit einem zarten Lächeln bedankte sich die junge Künstlerin. Nur wenig später erklang die erste, süße Note und entführte die Zuschauer in eine magische Welt von Tönen und Klängen.
Die Zeit bis zur Pause verging viel zu schnell. Fee hätte noch endlos lange diesem musikalischen Wechsel aus Hingabe, Leidenschaft und Präzision lauschen können. Das war das, was das Spiel dieser Virtuosin so einzigartig machte und ihr schon als junges Mädchen die Anerkennung der Fachwelt eingebracht hatte.
»Ist sie nicht fantastisch, Dan?«, schwärmte Fee begeistert in der Pause.
»Ja, das ist sie. Es freut mich, dass dir das Konzert genauso gut gefällt wie mir, Feelein. Ich hoffe, wir bekommen nachher noch einmal die Gelegenheit, uns für die Karten und diesen wunderschönen Abend zu bedanken.«
Fee nickte. »Ja, ich denke, dass wir uns noch lange daran zurückerinnern werden.« Sie sah sich suchend unter dem Publikum um. »Ich wundere mich, dass Horst Dannehl nicht hier ist. Man sollte meinen, dass er das Konzert seiner einzigen Tochter nicht verpassen würde.«
»Vielleicht ist er hinter der Bühne und verfolgt von dort die Aufführung«, mutmaßte Daniel.
»Ja, vielleicht«, entgegnete Fee ohne Überzeugung. »Ich würde es mir wünschen, für ihn und für Sophie. Es war bestimmt schwer für sie gewesen, den Vater hier zurücklassen zu müssen, als sie nach New York ging.«
Weil Fee bei diesem Gedanken so betrübt aussah, strich ihr Daniel tröstend über den Rücken. »Es wäre doch möglich, dass die beiden trotzdem ein sehr inniges Verhältnis haben, sich regelmäßig sehen oder ständig telefonieren.«
Fees untrügliches Gefühl sagte ihr, dass dem nicht so war. Auf ihr Bauchgefühl hatte sich Fee stets verlassen können. Sie wusste nicht, warum die Vorstellung, dass das Verhältnis zwischen Vater und Tochter zerbrochen sein könnte, sie so traurig stimmte. Womöglich lag es nur an diesen sehnsuchtsvollen Melodien, die sie so wehmütig werden ließen. Besonders jetzt, bei der Violinsonate von Brahms, mit der Sophie nach der Pause begann, meinte sie, vor Rührung zerfließen zu müssen.
Mit der Begeisterung für Sophies Spiel war Fee nicht allein. Davon zeugten der frenetische Applaus und die Standing Ovations, mit denen Sophie von den Zuschauern nach dem Verklingen des letzten Tons gefeiert wurde.
Strahlend und heftig applaudierend sah Fee zu Daniel. Erst jetzt bemerkte sie, dass er die junge Künstlerin seltsam ernst, ja, geradezu besorgt musterte. Und nun sah Fee es auch: Sophie wirkte erschöpft und war noch blasser als vor ihrem Spiel. Ihre wertvolle Violine, die sie in der linken Hand hielt, schien ihr viel zu schwer zu sein. Achtlos legte sie sie auf dem Stuhl ab. Dabei stützte sie sich mit der freien Hand an der Lehne ab. Während das Publikum lautstark nach einer Zugabe verlangte, drehte sie sich schwankend um und ging mit zittrigen Beinen von der Bühne. Sie schaffte nur wenige Meter, bis sie zusammenbrach und bewusstlos liegenblieb. Der Applaus erstarb. Alle starrten wie gebannt auf die reglose Gestalt auf der Bühne. Alle – bis auf Daniel, der sofort losgelaufen war, kaum dass Sophie zusammensackte. Und auf einmal lösten sich auch die anderen aus ihrer Starre. Noch bevor Fee bei Sophie und Daniel ankam, umringten die anderen Musiker und Bühnenarbeiter die beiden. Auch Nadja war auf die Bühne gelaufen und kniete nun neben ihrer leblosen Tochter.
»O mein Gott! Sophie, was ist mir dir? Dr. Norden, bitte, tun Sie doch irgendetwas! Was hat sie denn nur?«
»Das weiß ich noch nicht«, murmelte Daniel leise, während er hastig nach Sophies Puls suchte. Zum Glück fand er ihn rasch. Sophies Herz schlug kräftig, wenn auch etwas schnell. Ihr Brustkorb hob und senkte sich gleichmäßig. Probleme mit der Atmung gab es nicht; die Lunge schien frei zu sein. Viel mehr konnte er noch nicht feststellen. Nicht auf dieser Bühne inmitten von Schaulustigen und ohne seine Arzttasche.
»Wir müssen sie hier sofort wegbringen!«, ordnete er an.
Fast im selben Augenblick kamen zwei Männer mit einer Trage zu ihm gelaufen. Vorsichtig betteten sie die junge Frau darauf und trugen sie unter dem aufgeregten Geraune des Publikums davon.
»In ihre Garderobe!«, rief Nadja sofort, kaum dass sie hinter der Bühne waren. »Bringen Sie sie sofort in ihre Garderobe! Dort erholt sie sich bestimmt schnell.«
Daniel fand das seltsam. Von der überängstlichen, besorgten Mutter fehlte nun jede Spur. Nadja war ruhig und beherrscht, während sie die Männer anwies, ihre Tochter in die Garderobe zu bringen. In Daniel kam ein Verdacht auf. »Leidet Sophie öfter an Ohnmachtsanfällen?«, fragte er ihre Mutter so leise, dass andere ihn nicht hören konnte.
Unter seiner Frage zuckte Nadja wie ertappt zusammen.
»Nein … ja … aber ganz selten. Das war immer völlig harmlos gewesen.«
»Harmlos? Ich halte es nicht für harmlos, wenn man wiederholt in Ohnmacht fällt. Wurde die Ursache denn dafür herausgefunden?«
Nadja nagte an ihrer Unterlippe und erwiderte dann ausweichend: »Wie ich schon sagte, es ist nichts Ernstes. Das kommt schon wieder in Ordnung.«
Bevor Daniel weiter nachfragen konnte, rief jemand: »Der Rettungswagen ist gleich hier!«
»Rettungswagen?«, empörte sich Nadja. »Wieso wurde der gerufen? Das ist doch wohl unnötig!«
»Frau Dannehl, Ihre Tochter ist immer noch bewusstlos. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Natürlich musste da der Rettungsdienst gerufen werden.«
Es gefiel Daniel überhaupt nicht, wie sich Sophies Mutter benahm. Sie zeigte wenig Mitgefühl, tat nichts, um zur Klärung der Ohnmacht beizutragen, und schimpfte nun auch noch darüber, dass jemand so umsichtig gewesen war, einen Krankenwagen zu rufen. Verhielt sich so eine fürsorgliche Mutter?
»Bitte bringen Sie Sophie Dannehl nach draußen, damit sie gleich in den Rettungswagen kann«, bestimmte er.
»Aber, aber … das ist keine gute Idee!«, rief Nadja aus. »Können wir nicht etwas diskreter damit umgehen? Wenn die Presse nun davon erfährt!«
»Im Moment mache ich mir mehr Sorgen um Ihre Tochter als um die Presse«, erwiderte Daniel leicht verstimmt. »Und im Übrigen wird den Journalisten der Vorfall nicht entgangen sein. Schließlich saßen sie unter den Zuschauern.«
In diesem Augenblick schlug Sophie die Augen auf. Verwirrt blickte sie in die Gesichter der vielen fremden Leute, die sie umringten.
»Hallo, Sophie, schön, dass Sie wieder unter uns weilen«, sagte Daniel warm. »Wissen Sie, wer ich bin?«
Sophie brauchte einen Moment, bis sie antworten konnte: »Ja … ja, natürlich! Dr. Norden! Wieso … was ist passiert?«
»Sie sind nach Ihrem Auftritt ohnmächtig geworden.«
»Nach dem Auftritt?« Sophie wirkte erleichtert, als Daniel nickte. Dann überlegte sie. »War … war ich schon hinter der Bühne?«
»Nein, Sophie, du hast es nicht mehr von der Bühne geschafft«, übernahm Nadja das Antworten.
Unter ihren anklagenden Worten zuckte Sophie zusammen. Sie schloss die Augen und stöhnte gequält auf. »O nein! Das ist ja schrecklich. Es tut mir so leid.«
»Das muss Ihnen nicht leidtun«, erwiderte Daniel verwundert. »Niemand verliert absichtlich das Bewusstsein. Es zeigt vielmehr, dass leider irgendetwas nicht in Ordnung ist.«
»Sophie leidet nur unter Jetlag«, mischte sich Nadja wieder ein. »Also kein Grund zur Sorge.«
Daniel beachtete sie nicht. Inzwischen waren sie durch den Bühneneingang nach draußen gelangt, wo der Rettungswagen gerade eintraf. Daniel begrüßte die beiden Sanitäter, die er bereits von früheren Einsätzen kannte. Mit knappen, präzisen Worten informierte er sie über das, was vorgefallen war. Ohne dass weitere Anweisungen nötig waren, machten sich die beiden Rettungskräfte sofort an die Arbeit und schlossen Sophie an diverse medizinische Gerätschaften an. Die Tür des Rettungswagens hatten sie zugezogen, sodass sie mit ihrer Patientin und Daniel Norden allein waren.
»Hundert zu sechzig«, sagte ein Sanitäter nach der Blutdruckmessung. »Puls bei neunzig.«
»Haben wir schon ein EKG?«
»Kommt sofort.«
Ruhig und routiniert tat Daniel Norden das, was er am liebsten tat und wofür er geboren wurde: Menschen in ihrer Not zu helfen. Und dass Sophie seine Hilfe brauchte, daran hatte er keinen Zweifel.
»Wie geht es Ihnen jetzt?«, fragte er sie.
»Besser. Ich denke, ich kann wieder aufstehen und auch zurückgehen.«
»Bitte bleiben Sie noch einen Moment liegen, Sophie. Sie waren ein paar Minuten bewusstlos. Da sollte man nicht einfach aufstehen und weitermachen, als wäre nichts gewesen. Sie wollen doch sicher auch, dass der Grund für Ihre Ohnmacht herausgefunden wird. Ihre Mutter meinte, dies sei nicht Ihre erste gewesen.«
Sophie nickte. »Ja, ein paar Mal kam das schon vor. Aber nie auf der Bühne. Bisher hatte ich es immer noch gerade rechtzeitig in die Garderobe geschafft, sodass niemand etwas mitbekam.«
»Außer Ihre Mutter.«
»Ja, natürlich. Sie ist ja immer bei mir.«
›Wie ein Wachhund‹, schoss es Daniel unwillkürlich ein, und sofort bedauerte er diesen Gedanken. Er kannte weder Sophie noch Nadja gut genug, um sich ein Urteil über das Verhältnis der beiden Frauen bilden zu dürfen. Wahrscheinlich schätzte er Nadja falsch ein. Sie war nicht nur Sophies Managerin, sondern auch ihre Mutter, die dafür sorgte, dass ihr in dem mitunter rauen Geschäft kein Haar gekrümmt wurde. Immerhin war Sophie noch sehr jung gewesen, als sie mit ihrer Karriere begonnen hatte. Wie schnell hätte sie unter die Räder geraten können, wenn ihre Mutter kein wachsames Auge auf sie geworfen hätte.
»Ihr Blutdruck ist etwas niedrig, Sophie.« Daniel stutzte kurz und lächelte. »Tut mir leid, wenn ich in alte Gewohnheiten verfalle und Sie immer noch beim Vornamen nenne, Frau Dannehl.«
»O nein! Bitte sagen Sie weiter Sophie zu mir. Sie und Ihre Frau haben mich ja quasi aufwachsen sehen. Wenn Sie jetzt Frau Dannehl zu mir sagen, komme ich mir entsetzlich alt vor. Und was den niedrigen Blutdruck angeht: Darunter leide ich schon seit einigen Jahren. Meine Mutter meint, dass das bei uns in der Familie liegt. Es ist ziemlich lästig, aber wohl nicht weiter gefährlich. Ein hoher Blutdruck soll viel schlimmer sein.«
»Das stimmt. Allerdings kann einem der niedrige auch das Leben schwer machen. Besonders, wenn man deswegen bewusstlos wird. Obwohl …« Daniel zögerte kurz. Er wusste einfach zu wenig über Sophies Krankengeschichte, um eine abschließende Diagnose stellen zu können. »Sophie, ich bin mir nicht sicher, ob der niedrige Blutdruck der alleinige Grund für Ihre Ohnmacht ist. Dafür kann es auch viele andere, zum Teil auch sehr ernsthafte Gründe geben. Die Möglichkeiten für eine umfassende Diagnostik sind hier, im Rettungswagen, natürlich sehr beschränkt. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber ich würde Sie gern in die Behnisch-Klinik bringen, damit Sie dort gründlich untersucht werden können.«
»Sie meinen jetzt gleich?«
Zu Daniels Verwunderung klang Sophie nicht entsetzt oder erschrocken. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn es nicht so absurd wäre, könnte er fast annehmen, dass sie über die Aussicht, in die Klinik zu kommen, hocherfreut war.
»Ja«, bestätigte er ihre Vermutung. »Wir sollten damit nicht bis morgen warten. Es ist wichtig, dass einige Tests zeitnah gemacht werden. Bis morgen oder übermorgen haben sich die Werte, die im Moment vielleicht auffällig sind, schon wieder normalisiert, und wir tappen dann im Dunkeln. Ich kann verstehen, dass das sehr plötzlich für Sie kommt und Sie erst mal darüber nachdenken wollen. Wahrscheinlich möchten Sie das auch erst mit Ihrer Mutter besprechen.«
»Nein!«, warf Sophie hastig ein. »Wenn Sie sagen, dass es notwendig ist, verlasse ich mich natürlich auf Ihr Urteil als Mediziner. Von mir aus können wir sofort losfahren.«
Daniel nickte. Er hatte sich nicht getäuscht. Sophie Dannehl schien wirklich froh zu sein, in die Klinik zu kommen. Warum das so war, konnte er nur erahnen. Um sie danach zu fragen, war jetzt nicht der richtige Moment. Jetzt wollte sie nur fort von hier, und Daniel konnte das nur recht sein.
»Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung, Sophie«, sagte er lächelnd zu seiner Patientin. »Dann werde ich jetzt Ihre Mutter darüber informieren. Oder möchten Sie das lieber übernehmen?«
»Nein!«, entfuhr es Sophie nervös. »Ich … äh … Dr. Norden, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es machen würden. Ich fühle mich doch ein wenig angeschlagen.«
Zu angeschlagen, um mit ihrer Mutter zu sprechen? Der Fall wurde immer merkwürdiger.
Daniel wandte sich an die beiden Rettungssanitäter: »Also dann, meine Herren, bitte eine kurze Spritztour in die Behnisch-Klinik. Ich fahre hier bei der Patientin mit, muss aber noch kurz mit der Mutter reden.«
Er sprang aus dem Wagen und ging zu Nadja Dannehl, die zusammen mit Fee in der Nähe wartete. Als er ihr von der Absicht, Sophie in die Klinik zu bringen, berichtete, nahm sie das nicht so gelassen oder erfreut auf wie ihre Tochter.
»Aber das muss doch wirklich nicht sein, Dr. Norden!«, protestierte sie energisch. »Sophie ist nicht krank, nur weil sie einen kleinen Schwächeanfall hatte!«
»Ob es nur ein kleiner Schwächeanfall war, muss noch geklärt werden, Frau Dannehl«, erwiderte Daniel unnachgiebig. »Ich habe mit Ihrer Tochter darüber gesprochen, und sie ist einverstanden, in die Klinik zu fahren. Es gibt für mich also keinen Grund, noch länger zu warten.«
»Dann komme ich aber mit!«
Mit einem höflichen Lächeln wies Daniel ihr Anliegen zurück. »Dafür ist es im Rettungswagen leider zu eng, Frau Dannehl. Außerdem gibt es nichts, was Sie dort für Ihre Tochter tun könnten.«
Bevor Nadja darauf etwas erwidern konnte, kam ihr Fee zuvor. »Wahrscheinlich werden Sie hier noch einige Dinge klären müssen. Ich weiß, dass die Presseleute auf ein Statement warten. Außerdem müssen Sie wohl auch ein paar Sachen zusammenpacken, die Sophie in der Klinik benötigen wird. Lassen Sie uns das doch in Ruhe erledigen, und dann fahre ich Sie mit meinem Wagen zu Ihrer Tochter. Bis wir dort sind, liegen vielleicht schon ein paar Befunde vor.«
»Sehr gute Idee, Fee«, sagte Daniel. Er beugte sich zu seiner Frau hinunter, gab ihr einen Kuss auf die Wange und raunte ihr ein leises Dankeschön zu, bevor er schnell wieder in den Rettungswagen sprang und die Tür hinter sich zuzog. Er hatte es eilig, von hier zu verschwinden. Und das nicht, weil Sophie dringend in die Klinik musste. Nein, vielmehr wollte er weg von Nadja Dannehl, für die er immer weniger Sympathie empfand.
*
Es dauerte fast zwei Stunden, bis Fee mit Nadja Dannehl in der Behnisch-Klinik eintraf. Der Veranstalter hatte sie länger aufgehalten als geplant. Dann musste Nadja für die wartenden Journalisten eine kurze Erklärung abgeben und Sophies Garderobe leerräumen. Anschließend war Fee mit ihr ins Hotel gefahren, um für Sophie eine kleine Reisetasche zu packen. Fee hatte es dabei nicht eilig gehabt. Sie gönnte Sophie und den Ärzten der Behnisch-Klinik ihre Ruhe. Eine dominante, aufgeregte Mutter, die dort für einigen Wirbel sorgen würde, konnte niemandem von Nutzen sein.
»Endlich!«, sagte Nadja leicht verstimmt, als sie in der Klinik ankamen. »Das Ganze hat ja ewig gedauert. Wer weiß, was inzwischen mit Sophie geschehen ist.« Aus ihren Worten hörte Fee die echte Sorge einer liebenden Mutter heraus. Nach außen mochte Nadja Dannehl zwar kühl und distanziert erscheinen, aber Fee besaß genug Erfahrung, um hinter die Fassade eines Menschen blicken zu können. Und auch wenn Nadja vielleicht nicht als warmherzige und liebenswerte Frau erschien, empfand Fee nun doch Mitleid mit ihr. Sie war selbst Mutter und wusste nur zu gut, wie sehr die Frau an ihrer Seite gerade litt.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Dannehl«, versuchte sie nun, Nadja zu beruhigen. »Ihre Tochter ist hier in den besten Händen, und es geht ihr bestimmt gut. Bei Problemen hätte mich mein Mann längst informiert. Lassen Sie uns in die Aufnahme gehen. Dort werden wir bestimmt Genaueres erfahren.«
Nadja nickte stumm und folgte Fee in die Notaufnahme der Behnisch-Klinik. Dort wartete Daniel bereits auf sie.
»Wir haben Sophie vorhin auf die Innere gebracht, und inzwischen schläft sie tief und fest. Einige Befunde liegen uns schon vor, sodass wir sicher sagen können, dass im Moment keine akute Gefahr für Ihre Tochter besteht. Deshalb gönnen wir Sophie erst mal ihren Schlaf und machen morgen mit der Diagnostik weiter.«
»Sie wollen Sie noch länger hierbehalten?«, fragte Nadja bestürzt.
»Das halte ich für das Beste. Solange wir nicht sicher sagen können, was hinter Sophies Ohnmachtsanfällen steckt, können wir auch schwere Erkrankungen nicht ausschließen. Ich bin mir sicher, dass es auch Ihnen wichtig ist, Gewissheit zu bekommen.«
Nadja hatte gehofft, Sophie mit sich nehmen zu können. Doch das war nun nicht mehr möglich. Sophie schlief, und es blieb ihr nun nichts anderes übrig, als sie bis morgen hierzulassen.
»Ich hätte doch mit dem Rettungswagen mitfahren sollen«, sagte sie ärgerlich. »Dann würde Sophie sicher längst in ihrem Hotelbett liegen und nicht in einer Klinik.« Sie sah auf die Reisetasche in ihrer Hand. »Nun gut, so wie es aussieht, kann ich es jetzt nicht mehr ändern. Ich habe ein paar Sachen für Sophie zusammengesucht, die sie morgen, wenn ich sie von hier abhole, anziehen kann. Sie kann ja schlecht im Abendkleid die Klinik verlassen.«
Daniel nahm ihr die Tasche ab. »Ich kümmere mich darum, dass Sophie sie erhält. Allerdings ist es noch nicht sicher, ob Sophie morgen schon entlassen werden kann. Wir müssen erst die Testergebnisse abwarten und …«
»Nein!«, unterbrach ihn Nadja so laut, dass Fee an ihrer Seite kurz zusammenzuckte. »Meine Tochter wird morgen die Klinik verlassen, Dr. Norden!«
»Frau Dannehl, ich bitte Sie, Ihre Lautstärke zu drosseln«, mahnte Daniel sofort. »Wir sind zu nachtschlafender Zeit in einem Krankenhaus und sollten auf die Patienten, die auf einen erholsamen Schlaf angewiesen sind, Rücksicht nehmen. Und was die Entlassung ihrer Tochter anbelangt … » Daniel stockte und überlegte kurz, wie er das Nächste möglichst diplomatisch sagen könnte. »Ich denke, wir sollten erst mal sehen, was der morgige Tag uns bringen wird. Ich sehe mir die Befunde an, die bis dahin vorliegen werden, und spreche mich im Anschluss mit Sophie ab. Danach entscheidet allein Ihre … Ihre erwachsene Tochter, wie es weitergehen soll.«
Nadja hob den Kopf noch ein Stück höher und kniff bei Daniels Worten verärgert die Augen zusammen. »Meine Tochter mag zwar erwachsen sein, aber ich bin ihre Mutter und ihre Managerin. Sophie hat bisher immer auf mein Urteil vertraut und ist damit stets bestens gefahren. Oder meinen Sie, dass sie es sonst so weit gebracht hätte? Noch treffe ich allein die Entscheidungen, und daran wird sich so schnell nichts ändern! Sophie wird das machen, was ich für richtig halte, und sich meinen Wünschen fügen!«
»Frau Dannehl!«, entfuhr es Fee fassungslos. »Das kann unmöglich Ihr Ernst sein!«
Nadja blinzelte kurz irritiert. Für einen kurzen Moment begriff sie nicht, warum Fee Norden so entrüstet war.
»Sie können das nicht verstehen«, sagte sie dann beinahe trotzig. »Ohne mich wäre Sophie völlig hilflos. Sie ist froh, dass ich ihr alles abnehme. Wenn ich mich nicht um alles gekümmert hätte, würde sie jetzt bestimmt in irgendeinem armseligen Provinzorchester spielen.«
»Wenn Sie das sagen«, sagte Daniel nur und warf seiner Frau einen Blick zu, den sie auch ohne Worte verstand. Er wollte es für den Moment dabei belassen und keine Diskussion vom Zaun brechen. Doch er hatte bei Nadja Dannehl einen wunden Punkt berührt. Sie hatte plötzlich das Bedürfnis, ihr Handeln zu rechtfertigen.
»Sie haben ja kein hochbegabtes Kind!«, rief sie anklagend. »Sie wissen gar nicht, wie das ist, wenn man sein eigenes Leben zurückstellen muss, weil das Kind etwas Besonderes ist.«
»Ist nicht jedes Kind etwas Besonderes?« Fee konnte es nicht verhindern, dass sie sich über Nadjas Bemerkung ärgerte. Sie dachte an ihre eigenen fünf Kinder, die vielleicht nicht so ein außergewöhnliches musikalisches Talent besaßen wie Sophie Dannehl, aber trotzdem einzigartig waren. »Und sollten wir nicht alles dafür tun, dass sie lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Wir erweisen Ihnen keinen guten Dienst, wenn wir ihnen das nehmen. Mögen die Motive dafür auch noch so selbstlos sein.«
In Nadjas Gesicht arbeitete es, und sie schien ernsthaft über das, was Fee Norden gesagt hatte, nachzudenken. Doch mit ihren nächsten Worten zerstörte sie diese Illusion. Herablassend sagte sie: »Sie können es wirklich nicht verstehen.« Mit einem knappen Kopfnicken wandte sie sich ab und ging zum Ausgang.
»Frau Dannehl, bitte warten Sie!«, rief Fee ihr nach. Sie wollte nicht, dass dieser Abend so unschön endete.
Und tatsächlich drehte sich Nadja zu ihr um.
»Lassen Sie uns nicht so auseinandergehen«, sagte Fee mit einem versöhnlichen Lächeln. »Wir beide können in der Lobby warten, während mein Mann die Tasche Ihrer Tochter abgibt, und noch ein wenig reden. Später setzen wir Sie dann an Ihrem Hotel ab.«
»Das wird nicht nötig sein, Frau Norden«, gab Nadja unterkühlt zurück. »Ich nehme mir ein Taxi. Morgen um acht bin ich wieder hier, um meine Tochter abzuholen.«
Fee unternahm keinen weiteren Versuch, Nadja aufzuhalten, als diese nun die Klinik verließ. Nachdenklich sah sie ihr nach. »Ich verurteile zwar die Art und Weise, wie sie mit ihrer Tochter umgeht und über deren Leben bestimmt, aber trotzdem empfinde ich Mitleid mit ihr.« Sie seufzte theatralisch auf. »Ich frag mich manchmal wirklich, was mit mir nicht stimmt.«
Daniel zog sie leise lachend in seine Arme und gab ihr einen Kuss. »Du hast ein mitfühlendes Herz, mein Liebling. Das ist des Rätsels Lösung.«
»Ich bin immer wieder beeindruckt, wie treffsicher und schnell du eine Diagnose stellen kannst, mein Schatz. Allerdings befürchte ich, dass du dich bei mir angesteckt hast. Ich habe nämlich ganz genau gesehen, dass dir Nadja Dannehl auch leidtat. Obwohl du sie nicht besonders magst.«
Daniel sah zur Tür, durch die Nadja in die Nacht verschwunden war. »Sie wirkte so verloren ohne ihre Tochter. So, als würde ihr Leben nur durch ihre Tochter einen Sinn bekommen.«
»Wahrscheinlich ist es auch so«, stimmte Fee ihm zu. »Sie hat ihr eigenes Leben völlig zurückgestellt und sich nur noch auf Sophies Karriere konzentriert. Das hat keinem der beiden gutgetan.« Fee löste sich aus Daniels Armen, um ihn ansehen zu können. »Erzählst du mir nun endlich, was du im Beisein von Nadja nicht sagen wolltest?«
»Du kennst mich wirklich gut, Feelein. Ich habe tatsächlich etwas für mich behalten, auf Sophies ausdrücklichem Wunsch. Sie hat mich gebeten, die Nacht hier verbringen zu dürfen. Sie wollte nicht mit ihrer Mutter ins Hotel fahren. Sie meinte, sie brauche unbedingt etwas Ruhe.«
»Ruhe? Vor wem? Ihrer Mutter?«
Daniel zuckte die Schultern. »Das hat sie nicht gesagt, und ich wollte nicht weiter nachfragen. Auf mich hat sie einen sehr erschöpften Eindruck gemacht, und es sprach nichts dagegen, ihr ein Bett anzubieten. Außerdem kann es nicht schaden, wenn wir sie hierbehalten, um sie gründlich durchzuchecken. Ich habe ein wenig Sorge, dass wir etwas Wichtiges übersehen könnten, wenn wir ihren Zustand nur auf eine allgemeine Erschöpfung und den Jetlag schieben.«
*
Horst Dannehl war ein Frühaufsteher. Sobald die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster in sein Zimmer fielen, stand er auf und ging in die Küche, um die Kaffeemaschine einzuschalten. Dann duschte er, zog sich an, holte die Zeitung aus dem Briefkasten und setzte sich an den Küchentisch, den er schon am Vorabend gedeckt hatte. Horst führte ein ruhiges und beschauliches Leben. Er war gesund und kannte dank einer guten Beamtenpension keine finanzielle Not. Nur wenige wussten, dass er an diesem Leben keine Freude hatte. Dass er an jedem einzelnen Tag das betrauerte, was er vor vielen Jahren verloren hatte.
Betrübt sah Horst zu dem Küchenschrank hinüber, auf dem die Eintrittskarte lag, die er vor einigen Monaten erstanden hatte. Dafür hatte er alle Hebel in Bewegung gesetzt, nachdem er von Sophies geplantem Gastspiel in München erfahren hatte. Nur um die Karte dann verfallen lassen.
Horst war nicht zum Konzert gegangen, aber er hatte gestern an nichts anderes denken können und seine Entscheidung immer wieder infrage gestellt. Sein größter Wunsch war es gewesen, Sophie wiederzusehen – und auch Nadja. Doch er hatte Angst gehabt, die Fassung zu verlieren, wenn er sein Kind auf der Bühne sehen würde, zum Greifen nah, aber doch unerreichbar für ihn.
Sie waren damals nicht im Guten auseinandergegangen. Horst hatte nie ein Hehl daraus gemacht, was er von Nadjas ehrgeizigen Plänen hielt. Als das Angebot aus New York kam, wollte er nicht, dass Sophie - oder besser Nadja - es annahm. Seine Kleine sollte in München bleiben, ihre Schule beenden und eine unbeschwerte Jugend erleben. Doch vor allem wollte er weder sie noch Nadja verlieren. Denn dass das geschehen würde, war ihm von Anfang an klargewesen. An dem Tag, an dem Nadja mit Sophie ins Taxi stieg, um zum Flughafen zu fahren, verlor er nicht nur seine Frau, sondern auch sein einziges Kind. Hilflos hatte er an der Haustür gestanden und auf ein großes Wunder gehofft. Aber das Wunder war nicht geschehen. Die beiden Menschen, die er mehr liebte als sein Leben, waren in das Taxi gestiegen, ohne sich noch einmal zu ihm umzudrehen.
Seitdem hatte er sie nie wiedergesehen. Er telefonierte hin und wieder mit Nadja, aber nie mit Sophie. Sie wollte nicht mit ihm sprechen. Zumindest behauptete das Nadja. Und so bestanden die wenigen Kontakte zu seiner Tochter aus den Briefen, die er ihr zum Geburtstag und zu Weihnachten schrieb, und die er an die Adresse der New Yorker Agentur schickte. In den Wochen darauf wartete er dann sehnsüchtig auf eine Antwort, bis er das Warten irgendwann aufgab und sein gewohntes Leben weiterführte.
Unwirsch fuhr sich Horst mit einer Hand über die Augen, als er die Feuchte in seinen Augenwinkeln spürte. Diese sentimentalen Rührseligkeiten halfen ihm nicht weiter. Sie würden ihm das Leben nur noch schwerer machen. Es wurde Zeit, sich endlich mit dem Schicksal zu arrangieren und sich damit abzufinden, dass er als Vater und Ehemann versagt hatte. Und wieder sah er zu dem schmalen, bunt bedruckten Stück Papier auf dem Schrank hinüber. Vielleicht hätte er doch hingehen sollen?
Horst trank von seinem Kaffee, um die Traurigkeit hinunterzuspülen, und griff dann zum Lokalteil der Tageszeitung. Ihm stockte der Atem, als ihm sofort die große Schlagzeile ins Auge sprang: ›Stargeigerin Sophie Dannehl bei ihrem Konzert zusammengebrochen‹.
Die Zeitung immer noch in den Händen haltend, stürzte er zum Telefon und wählte Nadjas Handynummer. Während er darauf wartete, dass sie abnahm, überflog er hektisch den Rest der knappen Nachricht. Sophie, seine kleine Sophie, war bei dem gestrigen Konzert ohnmächtig geworden. Weiter las er, dass Nadja in einer kurzen Stellungnahme angegeben hätte, dass es Sophie gutginge und sie nur an den Folgen des Jetlags leide. ›Blödsinn!‹, dachte Horst sofort, und seine Sorgen wuchsen.
Endlich nahm Nadja ab. »Horst«, sagte sie distanziert. »Was gibt’s denn?«
»Das fragst du noch?« Nur mühsam gelang es Horst, seine Aufregung zu drosseln. »Sophie liegt seit gestern Abend in der Klinik, und ich muss das aus der Zeitung erfahren! Hast du unsere Vereinbarung vergessen? Du hast mir versprochen, mich über Sophies Leben auf dem Laufenden zu halten, wenn ich mich im Gegenzug aus allem heraushalte! Ich habe meinen Teil eingehalten! Du nicht!«
»Erwartest du ernsthaft, dass ich dich bei jeder Kleinigkeit anrufe?«, höhnte Nadja.
»Kleinigkeit?«, fuhr er sie an. »Wenn meine Tochter während eines Konzerts das Bewusstsein verliert und in die Klinik gebracht wird, handelt es sich nicht um eine Kleinigkeit! Du hättest mich sofort anrufen müssen!«
»Mach doch nicht so ein Drama daraus! Sophie geht es gut, ihr fehlt nichts. Ein kleiner Schwächeanfall, nichts Besonderes. Ich werde nachher in die Behnisch-Klinik fahren, um sie abzuholen.«
Horst überlegte schnell und fasste dann einen Entschluss.
»In Ordnung. Wir treffen uns dort. Ich mache mich sofort auf den Weg.«
»Horst! Nein …«, hörte er sie noch entsetzt rufen, dann legte er auf. Nur fünf Minuten später saß er in seinem Auto und fuhr in die Münchner Innenstadt. Nichts und niemand würde ihn davon abhalten können, nach seiner Tochter zu sehen. Er wollte sich nicht mehr nur auf das verlassen, was ihm Nadja erzählte. Er war Sophies Vater, und es wurde Zeit, dass er sich auch so benahm. Seine Kleine brauchte ihn jetzt. Und es spielte keine Rolle, dass sie längst eine erwachsene Frau war und sie sich ein Jahrzehnt nicht gesehen hatten. Oder dass sie ihn vor langer Zeit aus ihrem Leben verbannt hatte und nichts mehr von ihm wissen wollte.
*
Halb acht. Erstaunt sah Sophie auf das Display ihres Handys. Schnell überschlug sie, dass sie gestern gegen elf eingeschlafen war. Sie hatte also mehr als acht Stunden durchgeschlafen! Das war viel. Sehr viel sogar. Normalerweise wachte sie spätestens nach drei oder vier Stunden auf und wälzte sich dann ruhelos in ihrem Hotelbett umher, unfähig, wieder in den Schlaf zurückzufinden. Doch in dieser Nacht hatte sie so gut und fest geschlafen wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Sie fühlte sich wunderbar erholt und streckte sich genüsslich in ihrem Bett aus. Mit einem zufriedenen Lächeln sah sie sich in dem hübschen Privatzimmer um. Wenn sie es nicht besser wüsste, hätte sie es auch für ein gediegenes Hotelzimmer halten können. Die Möbel waren aus einem hellen, freundlichen Naturholz, an den Wänden hingen bunte Landschaftsbilder. Vor der großen Fensterfront gab es eine kleine Sitzgruppe mit einem gemütlich aussehenden Sofa und zwei Sesseln. Eine Tür an der gegenüberliegenden Wand führte ins Badezimmer, das Sophie schon am Vorabend inspiziert hatte. Es gefiel ihr hier. Sehr sogar und nicht nur wegen der luxuriösen und geschmackvollen Einrichtung.
Lächelnd beglückwünschte sie sich im Nachhinein zu ihrer Idee, die Nacht in der Behnisch-Klinik zu verbringen. Dr. Norden hatte sie zwar anfangs etwas überrascht angesehen, aber dann hatte er ihrer Bitte zugestimmt und ihre sofortige Aufnahme veranlasst.
›Vielleicht sollte ich öfter in einer Klinik übernachten‹, überlegte Sophie grinsend. ›Andere Leute fahren für zwei Wochen in den Urlaub, und ich gönne mir eben eine ruhige Nacht in einer schicken Privatklinik.‹
Es klopfte an der Tür, und augenblicklich musste Sophie an ihre Mutter denken. Ihre gute Stimmung verflog. Es war dumm zu glauben, dass sie hier wirklich ihre Ruhe finden könnte. Doch es war nicht Nadja Dannehl, die hereinkam, sondern eine Schwester, und Sophie atmete auf.
»Guten Morgen, Frau Dannehl«, wurde sie mit einem freundlichen Lächeln begrüßt. »Ich bin Schwester Lore. Haben Sie gut geschlafen?«
»Ja, sehr gut und viel länger als erwartet. Hier herrscht eine himmlische Ruhe.«
Lore zwinkerte ihr verschwörerisch zu. »Das liegt daran, dass Dr. Norden dafür gesorgt hat, dass Sie dieses abseitsliegende Zimmer am Ende der Station bekommen haben. Hier hört man kaum etwas von dem, was sich auf dem Flur abspielt. Ich hoffe nur, dass ich Sie jetzt nicht geweckt habe.«
»Nein, nein«, versicherte Sophie schnell. »Ich war schon wach. Ich mochte bloß noch nicht aufstehen.«
»Tut mir leid, aber das wird sich nun wohl nicht mehr vermeiden lassen. Dr. Norden wird in einer halben Stunde hier sein, um mit Ihnen zu sprechen, und Sie möchten sich bestimmt noch etwas frisch machen.« Lore wies auf die Reisetasche, die auf einem Stuhl stand. »Ihre Mutter hat gestern noch ein paar Sachen für Sie abgegeben. Die werden Sie sicherlich gebrauchen können.« Lore schmunzelte. »Es sei denn, Sie möchten Ihr todschickes Abendkleid wieder anziehen.«
»Nein, ganz bestimmt nicht«, erwiderte Sophie lachend. Sie sprang aus dem Bett, als Schwester Lore sie alleinließ, nahm ihre Waschutensilien aus der Reisetasche und lief ins angrenzende Bad. Sie hatte kaum geduscht und das Kliniknachthemd gegen ihre eigene Garderobe eingetauscht, als es erneut klopfte und Dr. Norden zu ihr kam.
»Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Nacht«, sagte er, nachdem sie in der bequemen Sitzgruppe Platz genommen hatten.
»Ja, ich habe selten so gut geschlafen wie hier«, schwärmte Sophie. »Allein dadurch geht es mir so gut wie schon lange nicht mehr. Ich denke, Sie können mich als geheilt entlassen.«
Daniel lachte leise. »Wenn es immer so einfach wäre, die Leute gesund zu machen, hätten wir wohl mehr Hotels und weniger Krankenhäuser.« Er zwinkerte ihr zu. »Und ich wäre dann der nette Nachtportier.« Dann wurde er ernster. »Aber in Ihrem Fall ist es mit ein paar Stunden Schlaf wohl doch nicht getan.«
»Das hört sich gar nicht gut an.«
Daniel schüttelte den Kopf. »Es besteht kein Grund, sich große Sorgen zu machen. Soweit kann ich Sie schon mal beruhigen. Es wurden ja bereits gestern Abend ein paar Untersuchungen gemacht. Dramatisches konnte auf die Schnelle nicht festgestellt werden. Das EKG ist unauffällig, und die meisten Blutwerte liegen im Normbereich.«
»Die meisten?«, fragte Sophie nach.
»Ja, allerdings ist der Hämoglobin-Wert ausgesprochen niedrig. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff. Er ist für den Transport des Sauerstoffs im Blut zuständig. Je weniger Hämoglobin vorhanden ist, umso weniger Sauerstoff wird vom Blut zu den Organen gebracht. Das kann dann zu körperlichen Beschwerden führen, wie Sie sie erlebt haben: Schwindel, eine ungesunde Hautblässe, Müdigkeit, körperliche Schwäche und Benommenheit. Auch eine Synkope, also eine kurzeitige Ohnmacht, kann dann vorkommen.«
Sophie nickte. »Diese Beschwerden, die Sie genannt haben, passen alle zu mir. Ich fühle mich sehr schwach und bin kaum noch belastbar.«
»Haben Sie nie versucht herauszufinden, woran das liegt?«, fragte Daniel nach. »Ihre Mutter meinte, dass Sie schon häufiger ohnmächtig geworden sind.«
»Ja, vor vier oder fünf Wochen passierte es zum ersten Mal und nur für ein paar Sekunden. Seitdem kam es noch zweimal vor, aber es war nie so lange gewesen wie gestern.«
»Und was sagen Ihre Ärzte dazu? Sie waren mit Ihren Beschwerden doch sicher bei einem Arzt.«
»Nun ja, nicht direkt wegen dieser Synkopen«, druckste Sophie ein wenig herum. »Seit einem Jahr geht es mir ja schon schlecht. Ich kann nicht schlafen, bin aber ständig müde und fühle mich immer am Ende meiner Kräfte. Deswegen bin ich dann zum Arzt gegangen. Er meinte, dass mein Eisenwert zu niedrig sei, und hat mir Tabletten verschrieben, die ich nun ständig einnehme. Geholfen haben sie aber nicht. Mir ging es immer schlechter, bis ich dann vor ein paar Wochen sogar ohnmächtig wurde.«
»Warum haben Sie sich keine ärztliche Hilfe gesucht, Sophie?«, fragte Daniel und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie wenig Verständnis er dafür aufbrachte. Eine plötzliche Bewusstlosigkeit konnte lebensbedrohend sein. Vor allem, wenn die Ursache unklar war.
»Es war ja nie so schlimm wie gestern. Außerdem waren wir in den letzten Wochen auf der großen Asientournee. Ich mochte nicht zu einem fremden Arzt gehen. Meine Mutter meinte, es wäre besser zu warten, bis ich wieder in New York bin. Dann könnte ich meinen Hausarzt aufsuchen.«
»Das war sehr unvernünftig, Sophie. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich so direkt bin, aber Sie sind sehr fahrlässig mit Ihrer Gesundheit umgegangen.«
»Meinen Sie denn, dass etwas Ernstes dahintersteckt?«
»Das kann ich erst nach einer umfangreichen Diagnostik sicher feststellen. Meine Vermutung ist, dass es wirklich nur an dem Eisenmangel liegen könnte. Eisen ist für den Körper sehr wichtig. Es ist an vielen lebenswichtigen Körperfunktionen beteiligt. So sorgt das Eisen auch dafür, dass genügend Hämoglobin gebildet wird. Wenn Eisen fehlt, besitzen wir auch zu wenig von dem roten Blutfarbstoff. Zwischen Ihrem niedrigen Hämoglobinwert und dem Eisenmangel gibt es also einen direkten Zusammenhang. Sie haben eine Eisenmangelanämie.«
»Also muss ich weiter meine Eisentabletten nehmen, und das Problem ist erledigt?«
»So einfach wird es wohl nicht sein. Sie sagten ja, dass Sie diese Methode schon erfolglos ausprobiert hätten. So wie es aussieht, hat Ihr Körper Schwierigkeiten, das Eisen über die Nahrung aufzunehmen und zu verwerten. Warum das so ist, müssen wir erst noch herausfinden.«
»Bedeutet das, ich darf noch länger Gast in Ihrem Hause sein?«, fragte Sophie so glücklich, dass Daniel lachen musste.
»Es kommt äußerst selten vor, dass diese Aussicht meine Patienten in Entzücken versetzt. Die letzte Nacht muss wirklich himmlisch gewesen sein.«
»Das war sie, und ich freu mich schon auf die nächste.« Sophies gute Stimmung schwand, als sie seufzend hinzufügte: »Es ist nicht nur der tolle Schlaf. Auch sonst … Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist schön, mal frei von allen Verpflichtungen zu sein.« Dann brach sie verlegen ab, als hätte sie schon viel zu viel von sich preisgegeben.
»Ich stelle mir Ihr Leben sehr anstrengend vor«, sagte Daniel mitfühlend. »Immer unterwegs zu sein, keinen richtigen Rückzugsort zu haben … Wenn Sie irgendwann mal darüber sprechen möchten, werde ich Ihnen gern zuhören.«
»Danke«, erwiderte Sophie lächelnd. »Vielleicht komme ich darauf zurück. Aber im Moment würde ich es lieber dabei belassen und wäre einfach nur froh, wenn ich in der Behnisch-Klinik bleiben dürfte, bis alle Untersuchungen abgeschlossen sind.«
»Natürlich, Sophie. Wie lange sind Sie eigentlich in München? Wie viel Zeit haben wir für die Diagnostik?«
»Ich weiß nicht … Äh, vielleicht eine Woche oder so. Planmäßig soll es nächsten Sonntag weitergehen. Aber ich …« Sophie wand sich nervös unter Daniels Blicken. »Also eine Woche, denke ich«, sagte sie schließlich unsicher.
Daniel wunderte sich, dass seine einfache Frage die junge Frau so durcheinanderbrachte. Noch mehr wunderte er sich darüber, dass sie nicht genau zu wissen schien, wann sie aus München aufbrechen würde. Doch das ließ er sich nicht anmerken. Er würde schon irgendwann herausbekommen, was ihm Sophie verschwieg.
Lächelnd, als wäre das Thema für ihn damit beendet, sagte er: »Dann haben wir nun eine Woche Zeit, um Sie gründlich zu untersuchen und die Ursache für den Eisenmangel zu finden. Wir sollten sofort mit den Untersuchungen beginnen, um die Zeit, die wir dafür haben, so effizient wie möglich zu nutzen.« Er stand auf und ging zur Tür. Daniel war schon fast draußen, als ihm noch etwas einfiel: »Was ist eigentlich mit den restlichen Auftritten, die Sie hier in München haben? Ich empfehle Ihnen dringend, sie abzusagen, auch wenn es schwerfällt. Sie sollten sich jetzt voll und ganz auf Ihre Genesung konzentrieren.«
»Selbstverständlich, Dr. Norden. Das sehe ich auch so.« Sie wirkte dabei so ruhig und entspannt, dass sich Daniel nun noch mehr wunderte. Mit Sophies Reaktion hatte er nicht gerechnet. Es schien ihr tatsächlich überhaupt nichts auszumachen, aufs Spielen zu verzichten oder in der Klinik bleiben zu müssen. Ob ihre Mutter das auch so locker sah?
*
Das sollte Daniel schneller erfahren, als er erwartet hätte. Er hatte kaum Sophies Zimmer verlassen, als er Nadja Dannehl auf sich zukommen sah. Zu seiner großen Überraschung war sie nicht allein. Horst Dannehl begleitete seine Ex-Frau.
»Guten Morgen, Dr. Norden«, begrüßte ihn Sophies Vater. »Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern …«
»Natürlich, Herr Dannehl. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, wenn es um meine ehemaligen Patienten geht. Es ist schön, Sie wiedersehen, auch wenn der Anlass weniger erfreulich ist.«
»Wie geht es Sophie?«, fragte Horst sofort besorgt nach. »Ich habe heute früh aus der Zeitung erfahren, dass sie auf der Bühne zusammengebrochen ist.«
Nadja schob sich an ihm vorbei. Mit spitzer Zunge sagte sie: »Dr. Norden, bevor Sie irgendetwas sagen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sophies Vater kein Recht hat, Auskunft über den Gesundheitszustand seiner Tochter zu verlangen. Sophie ist volljährig.«
»Das ist mir bewusst, Frau Dannehl«, erwiderte Daniel frostiger, als er eigentlich wollte. »Deshalb werde ich weder mit Ihnen noch mit Sophies Vater darüber sprechen.« Daniel wusste selbst nicht, was ihn geritten hatte, so auf Nadjas Worte zu reagieren. Ihn brachte niemand so schnell aus der Ruhe. Für seine Engelsgeduld im Umgang mit schwierigen Patienten und Angehörigen war er bekannt. Aber Nadja Dannehl hatte etwas an sich, was ihn seine guten Manieren fast vergessen ließ.
»Aber …« Nadja schnappte empört nach Luft und sah aufgebracht zu Horst, der keine Miene verzog.
»Tut mir leid, Frau Dannehl, aber so sind nun mal die Vorschriften«, sprach Daniel ungerührt weiter. »Warum gehen Sie nicht einfach zu Ihrer Tochter und lassen sich von ihr alles erzählen? Viel Zeit wird sie aber wahrscheinlich nicht für Sie haben. Wir wollen nachher mit den Untersuchungen beginnen.«
»Untersuchungen? Was soll das?«, fragte Nadja ungehalten. »Das klingt ja gerade so, als würde Sophie noch hierbleiben. Ich bin gekommen, um sie abzuholen!«
»Wie ich schon sagte, das Beste wird sein, Sie besprechen das mit Ihrer Tochter. Ich darf Ihnen leider keine Auskunft geben.«
Da Nadja nun beleidigt schwieg, wandte sich Daniel an Horst Dannehl: »Warum gehen Sie nicht zu Sophie und überzeugen sich persönlich davon, wie es ihr geht? Sie kann Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen.«
Horst schüttelte traurig den Kopf. »Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das Verhältnis zwischen Sophie und mir …« Horst musste erst schlucken, bevor er weitersprechen konnte. »Es … es ist nicht das beste. Wahrscheinlich will sie mich gar nicht sehen.«
»Natürlich will sie das nicht«, blaffte Nadja ihn an. »Ich fasse es nicht, dass du überhaupt hergekommen bist. Du hast dich doch früher auch nicht um sie gekümmert.«
»Weil du es nicht zugelassen hast. Du hast doch alles getan, um uns zu entfremden. Wer weiß, welche Lügen du ihr über mich aufgetischt hast.«
»Das ist ja wohl die Höhe!« Nadjas Stimme klang laut und schrill, und für Daniel wurde es nun Zeit einzuschreiten.
»Jetzt reicht’s!«, sagte er so energisch, dass beide Parteien sofort verstummten. »Sie befinden sich in einem Krankenhaus, und ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Zwistigkeiten hier austragen. Sollten Sie sich nicht augenblicklich zusammenreißen, werde ich Sie auffordern müssen zu gehen!«
»Ich bitte um Entschuldigung«, fasste sich Horst als Erster. »Es war … es war dumm von mir, überhaupt herzukommen. Ich denke, ich sollte jetzt …« Plötzlich verstummte er. Mit großen, wehmütigen Augen sah er an Daniel vorbei. Als Daniel sich umdrehte, entdeckte er Sophie, die der Lärm auf den Flur hinausgelockt hatte und die noch blasser war als sonst.
»Sophie …«, flüsterte Horst tonlos und machte einen Schritt auf sie zu. Wie gern hätte er seine geliebte Tochter, auf die er zehn Jahren verzichtet hatte, jetzt in seine Arme geschlossen. Doch Sophie machte auf den Absatz kehrt und stürmte zurück in ihr Zimmer. Für Horst war das wie ein Schlag in die Magengrube, und es tat genauso weh. Daniel sah, wie sehr dieser Mann unter der Zurückweisung durch seine Tochter litt.
»Herr Dannehl«, begann er mitfühlend, aber Horst ließ ihn nicht ausreden.
»Schon gut, Dr. Norden. Das hatte ich verdient.« Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte er sich um und ging davon.
Voller Mitgefühl blickte ihm Daniel nach. Er mochte sich gar nicht vorstellen, was in diesem Vater jetzt vor sich ging. Selbst Nadja Dannehl wirkte erschüttert. Und noch etwas anderes meinte Daniel in ihrem Gesicht zu lesen: Schuldgefühle. Doch noch bevor er sich dessen sicher sein konnte, hatte Nadja zu ihrer gewohnten herablassenden Art zurückgefunden. »Also dann, ich gehe jetzt zu meiner Tochter. Vielleicht kann sie mir ja sagen, wie es nun weitergehen soll.«
*
»Das kann doch wohl nicht wahr sein!«, regte sich Nadja auf, nachdem Sophie ihre kleine, gut einstudierte Rede beendet hatte. »Du hast dich von den Ärzten bequatschen lassen und bleibst nun hier? Das kommt nicht infrage! Das erlaube ich nicht! Du wirst auf gar keinen Fall deine Auftritte absagen, nur weil dein Eisenspiegel zu niedrig ist.«
»Es geht nicht nur um den Eisenwert. Dr. Norden will mich gründlich untersuchen und nach der Ursache forschen.«
»Dr. Norden! Dr. Norden!«, giftete Nadja. Sie ärgerte sich noch immer über sein Verhalten auf dem Stationsflur. Was hatte sie ihm denn getan, dass er sich so ungalant ihr gegenüber benahm? Zu Horst war er viel freundlicher gewesen als zu ihr. »Dr. Norden spielt sich doch nur auf! Wahrscheinlich geht es ihm nur darum, die Behnisch-Klinik in die Schlagzeilen zu bringen und von deinem Ruhm zu profitieren.«
»Das stimmt nicht!«, protestierte Sophie. »Und überhaupt, der Vorschlag hierzubleiben, um gründlich durchgecheckt zu werden, kam von mir. Ich möchte nämlich wissen, warum ich so häufig bewusstlos werde.«
»Häufig?«, schnaubte Nadja. »Du übertreibst! Und es ist albern und verantwortungslos, sich wegen so einer Bagatelle in die Klinik zu begeben und deswegen alle Auftritte abzusagen! Wir waren uns doch einig, dass dein Zustand an deinem labilen Nervenkostüm liegen muss!«
»Einig?«, spöttelte Sophie. »Das war ganz allein deine Meinung gewesen und nicht meine. Und so wie’s aussieht, sind wir uns auch diesmal nicht einig. Ich bleibe hier, und wenn du meine beiden Auftritte nicht absagst, mache ich es eben.«
Es war lange her, dass Sophie einmal so mit ihrer Mutter gesprochen hatte. So lange, dass Nadja eine ganze Weile brauchte, um sich daran erinnern zu können. Sophie war damals siebzehn gewesen und hatte sich bis über beide Ohren in diesen Jungen aus der Nachbarschaft verliebt. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, ihre Karriere für ihn zu opfern und nicht nach New York zu gehen. Zum Glück war es Nadja gelungen, ihr diese Dummheit auszureden. Es war nicht einfach gewesen, aber die Mühe hatte sich zum Schluss gelohnt. Sophie hatte dem Vertrag zugestimmt und sich seitdem immer auf das Urteil ihrer Mutter verlassen. Bis heute. Nadja musterte ihre Tochter und versuchte, in ihrem Gesicht zu lesen. Was war bloß los mit ihr? War es nur eine Phase, die wieder verging? Oder steckte mehr dahinter? Ein Mann? Nein, das war unmöglich. Im Leben ihrer Tochter gab es keinen Mann. Davon hätte sie gewusst. War sie etwa ernstlich krank? Sie war tatsächlich erschreckend blass, und diese Ohnmachtsanfälle könnten durchaus einen ernsthaften Hintergrund haben. Bei diesem Gedanken bekam Nadja schreckliche Angst. Ihrem kleinen Mädchen durfte nichts geschehen! Sie hatte doch nur noch sie! Nadjas Knie gaben auf einmal nach, und sie musste sich hinsetzen.
»Was ist denn los, Mama?«, fragte Sophie besorgt. »Geht es dir nicht gut?«
»Doch, doch, mein Engel«, erwiderte Nadja schnell. »Mir geht es bestens. Um dich mache ich mir Sorgen, und deshalb wäre es wirklich das Vernünftigste, wenn du hierbleibst. Was machen schon ein paar Auftritte, die wir absagen? Du weißt ja, dass München sowieso nicht meine erste Wahl gewesen ist.«
»Ja, das weiß ich«, seufzte Sophie leise. »Du wirst ja nicht müde, mir ständig vorzuhalten, dass ich die Konzerte eigenmächtig geplant habe, ohne sie mit dir abzusprechen.«
»Erklär mir endlich, was du dir dabei gedacht hast!« Nadja hörte sich deswegen immer noch beleidigt an.
»Vielleicht wollte ich einfach mal München wiedersehen«, erwiderte Sophie müde. »Ich bin viel zu lange fortgewesen.« Sie trat ans Fenster und sah hinaus. Sie hatte gehofft, mehr von der Stadt sehen zu können, doch vor ihr breitete sich nur der Klinikpark aus.
»Was wollte Papa eigentlich hier?«, wagte sie nun, die Frage zu stellen, die sie beschäftigte, seit sie ihren Vater gesehen hatte.
»Er wollte hören, wie es dir geht. In der Zeitung standen ein paar Artikel zu dem kleinen Zwischenfall von gestern. Er hat sich wohl Sorgen gemacht.«
»Das ist sehr … nett von ihm.«
»Mag sein. Aber lass uns nicht mehr über ihn reden. Wir sollten lieber überlegen, wie wir das mit dem Üben hinbekommen. Du kannst unmöglich eine ganze Woche hier sein, ohne zu spielen.«
»Doch! Doch, ich glaube, das kann ich«, erwiderte Sophie schroff. Sie wollte jetzt nicht über ihre Musik reden, sondern über ihren Vater. Doch ihre Mutter ließ das nicht zu. Sie ließ das nie zu. Sophie drehte sich zu ihr um und sagte bissig: »Hast du Angst, ich weiß nicht mehr, wie man einen Bogen führt, wenn ich eine Woche lang keinen in der Hand halte? Befürchtest du, ich könnte dann ins Mittelmaß abgleiten?«
»Sophie!«, rief Nadja entsetzt aus. »Du weißt doch genau, dass ich etwas anderes meine! Es geht mir nicht um deine Spieltechnik. Ich hatte gedacht, dass du nicht ohne deine Geigen sein könntest. Du liebst sie doch! Sie sind dein Leben und bedeuten dir alles!«
›Nein, sie bedeuten dir alles‹, hätte Sophie am liebsten geantwortet. Doch stattdessen sagte sie nur ruhig: »Sicher, Mama. Aber im Moment sind meine beiden Geigen im Hotelsafe besser aufgehoben als hier.«
Nadja nickte. »Stimmt. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht sollte ich mal mit Dr. Norden sprechen. Es wäre doch möglich, dass es auch hier einen großen Tresor gibt, wo wenigstens eins deiner Instrumente Platz hätte. Ich würde mich natürlich erst mal gründlich davon überzeugen, dass die Sicherheit hier gewährleistet ist und keine Unbefugten darauf zugreifen können.« Nadja dachte angestrengt nach. »Ideal wäre es natürlich, wenn nur wir einen Schlüssel dafür hätten.«
»Mama, ich will dir ja nicht jede Hoffnung nehmen, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.« Sophie merkte, dass es ihr inzwischen Mühe bereitete, ruhig zu bleiben. Alles, was ihre Mutter sagte oder tat, regte sie plötzlich auf. Im Moment wünschte sie sich nichts sehnlicher, als dass Nadja endlich schweigen würde. Oder noch besser: dass sie sie allein ließ. Sie brauchte jetzt Ruhe, um über alles nachdenken zu können. Noch immer saß ihr der Schreck in den Gliedern, wenn sie an den Augenblick zurückdachte, als sie ihrem Vater so unverhofft gegenübergestanden hatte. Warum war er in die Klinik gekommen, aber nicht zu ihrem Konzert? Wo war er jetzt? Wieso hatte sie es nicht geschafft, sich ihm zu stellen, sondern war sofort in ihr Zimmer geflüchtet? Sie wollte ihn doch wiedersehen!
Mit einer Hand massierte sie ihren verspannten Nacken und spürte, wie ein bohrender Kopfschmerz einsetzte, je länger sie ihrer Mutter zuhören musste.
»Warum sollte das eigentlich nicht funktionieren?«, schwadronierte Nadja unaufhörlich weiter. »Es gibt hier ganz sicher einen Tresor oder Safe. Ich weiß nämlich, dass in einer Klinik bestimmte Medikamente in einem Tresor gelagert werden müssen.«
»Ja, und deshalb wird es dort keinen Platz für einen Geigenkasten geben«, erwiderte Sophie gereizt. »Lass es einfach gut sein. Glaub mir, ich werde es schon eine Woche aushalten, ohne zu spielen. Außerdem denke ich nicht, dass es gern gesehen wird, wenn ich hier stundenlang übe und damit die Ruhe störe.«
»So ein Blödsinn! Sie können sich alle glücklich schätzen, in den Genuss deines Spiels zu kommen!«
»Du vergisst, dass wir in einer Klinik sind und es hier kranke Menschen gibt, die ihre Ruhe brauchen.«
Als Nadja erneut dagegenhalten wollte, wurde Sophie energischer: »Nein, Mama! Hör endlich auf! Ich werde nicht üben! Egal, was du sagst!«
Unter diesen lauten Worten zuckte Nadja zusammen. Was war nur aus ihrem duldsamen und sanften Liebling geworden? Wie hatte sie sich nur so verändern können, kaum dass sie in München angekommen waren? Nadja wurde klar, dass sie aufpassen musste. Sophie drohte, ihr zu entgleiten. Diese Stadt hatte keinen guten Einfluss auf ihre Tochter.
Nadja stand beleidigt auf. »Nun gut, wenn du meinst, dass meine Meinung nicht mehr zählt, kann ich ja auch genauso gut gehen. Anscheinend bin ich hier unerwünscht, und dass, was ich in den ganzen Jahren getan habe, zählt nicht mehr.«
»Mama, bitte entschuldige«, sagte Sophie um einiges versöhnlicher, und Nadja atmete sofort erleichtert auf. Es war noch nicht zu spät. Noch gelang es ihr, Sophie wieder zur Vernunft zu bringen. Noch war sie ihre Mutter.
Doch Sophie war noch nicht fertig. Mit ruhiger Stimme sprach sie weiter: »Ich hätte dich nicht so anfahren dürfen. Dafür bitte ich dich um Verzeihung. Aber du hast recht: Es wäre tatsächlich besser, wenn du jetzt gehen würdest. Ich bin schrecklich müde und würde mich gern noch ein wenig hinlegen, bevor die ganzen Untersuchungen beginnen.«
Nadja sah ihre Tochter irritiert an. »Du … du willst, dass ich gehe?«, stammelte sie fassungslos.
Entschlossen nickte Sophie. »Ja, Mama. Bitte geh jetzt. Ich möchte gern allein sein.«
Wie unter Schock stand Nadja auf, griff nach ihrer Handtasche und ging langsam, mit schweren Schritten zur Tür.
»Warte!«, hielt Sophie sie auf, und sofort ging es Nadja besser. Mit einem hoffnungsvollen Lächeln drehte sie sich um.
»Mama, du brauchst heute nicht noch mal herzukommen. Mach dir einfach einen schönen Tag. Wir können ja später telefonieren, wenn du magst.«
Das Lächeln in Nadjas Gesicht erstarb. Sie nickte stumm und ging hinaus. Kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, sank Sophie völlig erschöpft aufs Bett. Dieses Gespräch mit ihrer Mutter hatte ihr alles abverlangt. Und sie wusste, das war erst der Anfang. Der eigentliche, ungleich schwerere Kampf stand ihr erst noch bevor, und er machte ihr entsetzliche Angst. Doch im Moment wollte sie nur an den kleinen, süßen Sieg denken, den sie gerade errungen hatte und der unglaublich berauschend war.
Sie lag auf den Rücken und starrte an die weiße Zimmerdecke. Ihr Atem ging schnell, und ihr Herz raste, als würde es aus ihrer Brust springen wollen. Es war das erste Mal seit zehn Jahren, dass sie sich gegen ihre Mutter behauptet hatte. Zum ersten Mal nach zehn Jahren fühlte sie sich frei und unglaublich stark. Und so erschöpft, dass sie einschlief, kaum dass sie ihre Augen geschlossen hatte.
*
Nur eine halbe Stunde später wurde sie von Schwester Lore geweckt, die bei ihr Blut abnehmen wollte. Nachdem Lore fertig war, gab sie ihrer Patientin einen Zettel.
»Hier stehen Ihre Termine für die nächsten Tage drauf. Sie sehen, es wartet ein volles Programm auf Sie: CT, Ergometer, Sonografie, Gastroskopie und so weiter.«
»Puh, das ist wirklich heftig.«
Schwester Lore nickte. »Ja, aber nur so kann Ihren Beschwerden auf den Grund gegangen werden. Sie wollen doch sicher wieder völlig gesund werden.«
Sophie nickte. Die vielen Untersuchungen machten ihr etwas Angst, aber sie wusste, dass sie nötig waren.
Als Schwester Lore fort war, ging sie die Liste noch einmal durch. In einer Stunde musste sie in die Radiologie zum CT. Sie hatte keine Lust, bis dahin in ihrem Zimmer zu bleiben. Deshalb griff sie nach ihrer Handtasche und einer leichten Jacke und verließ die Station.
Mit dem Fahrstuhl fuhr sie hinunter ins Erdgeschoss. In der Empfangshalle herrschte ein geschäftiges Treiben. Menschen kamen und gingen, Lieferanten brachten Pakete, Patienten wurden auf Rollstühlen oder Tragen herein- oder hinausgeschoben. Sophie warf einen Blick zu den eleganten Sitzgruppen hinüber, in denen einige Leute Platz genommen hatten. Kurz überlegte sie, ob sie sich dazusetzen sollte. Einfach nur dazusitzen und das Treiben um sich herum zu beobachten, könnte sie vielleicht so sehr ablenken, dass sie ihre Probleme eine Zeitlang vergaß. Doch dann entschied sie sich dagegen. Ihr stand der Sinn nach Ruhe, und die würde sie hier nicht finden.
Am Ende der Lobby begann eine bezaubernde Ladenzeile. Neben einem kleinen Beautysalon gab es einen Zeitungskiosk mit einem gut sortierten Angebot an Büchern, Postkarten und Zeitschriften. Sophie ging hinein und kaufte sich ein Taschenbuch, dessen Cover sie ansprach. Für die nächste Stunde, bis ihr CT-Termin anstand, würde dieses Buch sie bestimmt gut unterhalten.
Die Einkaufspassage endete an einer großen Glastür, die in den Klinikpark hinausführte. Schon bei ihrem ersten Schritt hinaus ins Freie hatte Sophie das Gefühl, einen verzauberten, magischen Garten zu betreten. Nichts erinnerte mehr an die hektische Betriebsamkeit eines Krankenhauses. Verzückt blieb sie einen Moment stehen und ließ diesen ersten Eindruck auf sich wirken, bevor sie andächtig weiterging.
Sie setzte sich auf eine freie Bank und sah sich fasziniert um. Genau so stellte sie sich das Paradies vor. Dieser Park berührte alle Sinne auf das Angenehmste. Die farbenprächtigen Blumen, die vom satten Grün der Sträucher und Büschen umrahmt wurden, waren eine Wohltat für ihre Augen. Das Konzert aus vielstimmigen Vogelkehlen, das zu ihr hinüberklang, brachte mehr Freude in ihr Herz, als es jedes Sinfonieorchester vermocht hätte. Von dem berauschenden Duft der unzähligen Blüten wurde ihr fast schwindelig. Sanft spürte sie den Wind auf ihrer Haut und meinte, den Geschmack von süßem Nektar auf ihren Lippen zu schmecken. Achtlos legte Sophie das gerade erstandene Buch neben sich auf die Bank. Sie schloss die Augen und glaubte, sich schon seit Ewigkeiten nicht mehr so unbeschwert gefühlt zu haben wie in diesem Augenblick.
Mit jeder Minute, die verrann, fühlte sie sich leichter und beschwingter. Sie war sich sicher, hier könnte sie den Rest ihres Lebens verbringen. Hier war kein Raum für Sorgen und Ängste. Doch dann wurde sie angesprochen:
»Sophie? Sophie, bist du es?«
Unwillig über die Störung sah sie auf und war sofort hellwach, als sie in zwei blaue Augen sah, die ihr seit Jahren in ihren Träumen begegneten.
»Julian«, flüsterte sie fassungslos.
»Hallo, Sophie«, gab er mit einem warmen Lächeln zurück. »Ich bin froh, dich hier zu treffen.«
»Mich treffen? Warum? Was machst du hier? Bist du krank?« Die Fragen purzelten wie von allein aus ihrem Mund, ohne dass sie Sophie bewusst wurden. In ihrem Kopf herrschte ein heilloses Durcheinander. Es gab nur ein Wort, das es schaffte, sich in dem Chaos zu behaupten und zu ihr durchdrang: Julian.
»Nein, ich bin nicht krank.« Julians Lächeln verschwand. »Aber du anscheinend. Ich war gestern auf deinem Konzert und habe gesehen, wie du zusammengebrochen bist. Ich habe mir Sorgen gemacht und wollte nach dir sehen.«
»Du warst auf dem Konzert?« Sophie stand noch immer unter Schock und schaffte es kaum, einen klaren Gedanken zu fassen. Also war es doch gewesen! »Ich dachte, du magst nur Hardrock«, platzte sie heraus und ärgerte sich darüber. Warum gelang es ihr nicht, abgeklärt und ruhig mit seinem Auftauchen umzugehen? Warum brachte Julian sie immer noch so aus dem Konzept?
Julian lachte leise. »Hardrock? Das ist Jahre her, Sophie. Ich bin keine achtzehn mehr. Die Menschen ändern sich.«
Sophie nickte und merkte, wie sich der vertraute Schmerz wieder einstellte. Sie hieß ihn willkommen, denn er erinnerte sie an das, was Julian getan hatte. Es gab keinen Grund, ihn wie einen verliebten Teenager anzuhimmeln. Sie war immer noch wütend auf ihn. Wütend und unfassbar verletzt. Sie schenkte ihm einen eisigen Blick und ätzte dann: »Ja, dir stand schon immer der Sinn nach schnellen Veränderungen. Nichts ist so beständig wie der Wandel, nicht wahr?«
Julian sah sie stirnrunzelnd an. Er schien über ihre kryptische Bemerkung nachzudenken. Das gab Sophie die Gelegenheit, ihn eingehender zu mustern. In den vergangenen Jahren war aus dem Jungen, den sie geliebt hatte, ein Mann geworden. Er war noch immer schlank und athletisch, wirkte aber muskulöser und breiter als früher. Sein dunkles Haar war immer noch dicht und sah immer noch so aus, als müsste es dringend geschnitten werden. Sie erinnerte sich daran, wie sehr sie es geliebt hatte, mit ihren Fingern durch sein Haar zu fahren, während er sie zärtlich küsste.
»Möchtest du mir das vielleicht etwas näher erklären?«, fragte Julian jetzt. »Ich werde nämlich den Eindruck nicht los, dass du aus irgendeinem Grund sauer auf mich bist.«
»Gratuliere, Einstein«, blaffte Sophie, griff nach ihrem Buch und stand auf. Sie wollte nicht eine Sekunde länger mit ihm zusammen sein, denn sie wusste nicht, wie lange es ihr noch gelingen würde, den Schmerz und die Enttäuschung zu verbergen. Julian sollte nie erfahren, wie sehr sie sein Verrat getroffen hatte und wie weh er ihr noch immer tat.
»Willst du mich jetzt einfach stehenlassen?«, fragte er fassungslos, als sie an ihm vorbeigehen wollte. »Sollten wir nicht wenigstens darüber reden?«
Sophie blieb neben ihm stehen und funkelte ihn wütend an. All ihre guten Vorsätze, vernünftig und souverän mit der Situation umzugehen, waren vergessen. »Ich werde mit dir miesem Verräter kein einziges Wort mehr reden. Kaum zu fassen, dass du hier überhaupt aufgekreuzt bist, nach dem, was du getan hast.«
Als er bei diesen Worten nach ihrer Hand griff, entriss sie sie ihm und stürzte davon.
»Was soll ich denn getan haben?«, rief er aufgebracht. »In meiner Erinnerung warst du es nämlich, die mich im Stich gelassen hat!«
Ruckartig blieb Sophie stehen und drehte sich zu ihm um. »Ich habe dich im Stich gelassen?«, fuhr sie ihn entrüstet an. »Du spinnst doch wohl!«
Als Julian zu einer Erklärung ansetzen wollte, ließ sie das nicht zu. »Ich will nichts mehr von dir hören. Ich würde dir sowieso kein einziges Wort glauben können.«
»Irgendwann wirst du es hören wollen! Wir müssen uns endlich aussprechen, Sophie! Du weißt genau wie ich, dass die Sache mit uns noch nicht vorbei ist!«
»Das mit uns ist seit zehn Jahren vorbei.« Ihre Stimme überschlug sich vor Wut. »Und daran wird auch eine Aussprache nichts ändern können. Ich will deine Lügen nicht hören! Geh mir einfach aus dem Weg und besuch mich hier nie wieder!«
»Unsere Liebe lässt sich nicht einfach ausradieren, als wäre sie nie geschehen«, rief ihr Julian hinterher, doch Sophie hörte ihn längst nicht mehr.
*
Als würde ihr Leben davon abhängen, rannte sie aus dem Park, fort von Julian. Sie lief an den kleinen Geschäften vorbei und ignorierte die Menschen, die ihr in der Lobby begegneten und die der verzweifelt weinenden Frau neugierig oder mitfühlend nachblickten. Erst am Fahrstuhl blieb sie stehen und drückte immer wieder auf den Knopf, der ihn für sie rufen sollte. Sie wollte hier nur noch weg und irgendwo einen Platz finden, an dem sie ihren Tränen und ihrem Kummer freien Lauf lassen konnte.
Endlich kam der Fahrstuhl. Als sich seine Türen öffneten und sie die Frau erkannte, die gerade aussteigen wollte, wäre sie am liebsten fortgelaufen. Niemand sollte sie in diesem aufgewühlten Zustand sehen. Auch nicht Frau Norden.
Doch bevor Sophie die Flucht antreten konnte, hatte Fee schon reagiert. Sie griff nach Sophies Arm und zog sie sanft, aber bestimmt zu sich in den Fahrstuhl. Dann drückte sie auf irgendeinen Knopf, damit sich die Türen schnell wieder schlossen und sie so den Blicken der schaulustigen Menge entkommen konnten.
Fee legte einen Arm um Sophies Schultern und zog sie zu sich heran, um ihr Halt zu geben. »Wir gehen in mein Büro«, sagte sie warm.
»Aber ich …, ich muss … muss zum CT …«, schluchzte Sophie unter heftigen Weinkrämpfen.
»Ja, Sophie, aber nicht jetzt. Ich rufe dort an und sag Bescheid, dass Sie nicht kommen werden. Es gibt Wichtigeres als ein Termin beim Radiologen.«
In ihrem Büro angekommen, drückte Fee die noch immer weinende Sophie in einen weichen Sessel. Dann stellte sie eine Box mit Papiertaschentüchern und ein Glas Wasser auf den kleinen runden Tisch.
»Sie müssen jetzt nicht darüber reden, Sophie«, sagte sie teilnahmsvoll. »Manchmal ist weinen nämlich besser als reden. Lassen Sie Ihren Kummer raus. Sie haben hier alle Zeit der Welt dafür. Einverstanden?«
Sophie nickte unter Tränen und vergrub dann ihr Gesicht in ihren Händen. Sie bekam nicht mit, dass Fee zu ihrem Schreibtisch ging, in der Radiologie anrief und sich dann an ihren Computer setzte. Erst als nach langer Zeit Sophies Tränen versiegten und sie ruhiger wurde, sah Fee von ihrer Arbeit auf.
»Geht es jetzt wieder, Sophie?«, fragte sie warm.
Sophie nickte stumm und wischte sich die letzten Tränenspuren aus ihrem verweinten Gesicht. »Es tut mir leid, Frau Dr. Norden«, sagte sie leise. »Ich weiß wirklich nicht, was mit mir los war. Ich weine sonst nie.«
»Nie?« Fee lächelte. »Ich denke, dann wurde es höchste Zeit. Wahrscheinlich hat sich da so einiges bei Ihnen angestaut. Manchmal reicht dann ein kleiner, unbedeutender Anlass, um alles hervorbrechen zu lassen, was über Jahre unterdrückt wurde. Ich denke, wir sollten viel öfter mal unseren Gefühlen freien Lauf lassen und uns ihrer nicht schämen. Weinen kann wirklich befreiend sein. Finden Sie nicht auch, dass es Ihnen jetzt viel besser geht?«
Unsicher zuckte Sophie die Schultern. »Ich glaube, dazu braucht es mehr als ein paar Tränen«, entschied sie dann.
»Wollen Sie mir verraten, wie es zu diesem kleinen Ausbruch gekommen ist?«
»Ich würde lieber nicht darüber sprechen, Frau Dr. Norden.«
Fee nickte verstehend. »Wenn Sie es nicht möchten, werde ich Sie nicht bedrängen, Sophie. Sie sollen nur wissen, dass ich jederzeit für Sie da bin, wenn Sie vielleicht doch noch Ihr Herz ausschütten möchten.«
»Danke«, murmelte Sophie leise und wandte ihre Augen ab. Sie sah auf ihre Hände, in denen ein zerknülltes, feuchtes Taschentuch lag. Julian hatte ihr mal gesagt, dass sie die schönsten Hände der Welt hätte. Als sie ihrer Mutter davon erzählte, hatte diese laut aufgelacht. »Du hast eher die begnadetsten Hände der Welt, mein Engel. Und sicher auch die wertvollsten, wenn du erst mal ein großer Star bist.« Das war sie jetzt, doch es hatte sie nicht glücklich gemacht.
»Ich war vorhin im Klinikpark«, begann Sophie unvermittelt zu sprechen, und sofort sah Fee von ihrem Computerbildschirm auf. »Ich bin dort Julian begegnet.«
»Julian?« Fee runzelte die Stirn und dachte nach. »Julian Hentschel? Ich erinnere mich an ihn. Waren Sie nicht eine Zeitlang mit ihm zusammen gewesen?«
»Ja, er war meine erste große Liebe«, brachte Sophie stockend heraus. Würde es irgendwann leichter werden, über ihn zu sprechen? »Meine einzige Liebe, um ehrlich zu sein. Es hatte nach ihm nie wieder eine ernsthafte Beziehung gegeben.«
»Dann muss er wirklich etwas Besonderes für Sie gewesen sein. Schade, dass aus dieser Liebe nichts wurde.« Fee dachte kurz an Daniel. Wieder einmal wurde ihr bewusst, wie viel Glück sie gehabt hatte. Ihre große Liebe war noch immer an ihrer Seite, und daran würde sich nie etwas ändern. »Was wollte Julian von Ihnen?«, fragte sie dann behutsam nach.
»Keine Ahnung.« Sophie stieß hörbar die Luft aus. »Sehen, wie es mir geht. Mit mir reden.«
»Und wollten Sie das Gleiche?«
»Natürlich nicht! Nicht nach dem, was er mir angetan hat!« Sophie spürte, wie ihr wieder die Tränen in die Augen schossen. »Ich habe ihn geliebt, Frau Norden! Das war nicht nur eine kleine, unbedeutende Schwärmerei, wie meine Mutter immer behauptet hat. Ich habe ihn tief und innig geliebt! Und er …« Sie schluchzte laut auf. »Er hat mich betrogen. Während ich von einer gemeinsamen Zukunft träumte, war er mit einer anderen zusammen!«
»Sind Sie sich da sicher?«, fragte Fee erstaunt. »Julian hatte auf mich immer sehr ehrlich und verlässlich gewirkt. Ich hatte wirklich den Eindruck gehabt, dass er ihre Liebe tief und aufrichtig erwidern würde.«
»Ja, das dachte ich auch«, erwiderte Sophie bitter. »Ich war so dumm und naiv gewesen!«
»Sie waren verliebt, Sophie«, korrigierte Fee mit einem nachsichtigen Lächeln.
Sophie nickte und wischte sich mit einem Taschentuch die letzten Tränen fort. »Sag ich doch: dumm und naiv.«
Fee kam um ihren Schreibtisch herum und setzte sich zu Sophie. »Nicht immer hält die erste Liebe ein Leben lang. Für viele Menschen endet sie mit Enttäuschung, Trauer, manchmal auch mit Wut und Verzweiflung. Aber sie kommen darüber hinweg, verlieben sich neu und können ohne großen Schmerz daran zurückdenken. Besonders dann, wenn schon so viele Jahre vergangen sind wie bei Ihnen und Julian. Ich weiß, wie schlimm diese Erfahrung damals für Sie gewesen sein muss. Dass Sie noch immer so heftig darunter leiden, zeigt mir, dass Sie nie darüber hinweggekommen sind.«
»Ich wollte ja, aber es ist mir nicht gelungen«, sagte Sophie leise schniefend. »Es ist, als würde ich irgendwie feststecken und nicht von ihm loskommen. Die schrecklichen Erinnerungen an damals verblassen einfach nicht, so sehr ich es mir auch wünsche.«
»Erinnerungen sind etwas Schönes, doch nicht, wenn sie uns behindern und wir uns nicht für etwas Neues öffnen können. Es ist sehr, sehr wichtig für Sie, dass Sie endlich mit der Vergangenheit abschließen. Nur so können Sie sich an der Gegenwart erfreuen und Ihr Leben genießen.«
»Das mache ich doch«, erwiderte Sophie tapfer, aber selbst sie konnte hören, wie unglaubwürdig sie klang.
»Vielleicht wäre es gut gewesen, mit Julian zu sprechen«, sagte Fee bedächtig. »Sie hätten ihn zur Rede stellen und ihm sagen können, wie sehr er sie verletzt hat. Wahrscheinlich werden Sie nur so endlich mit dieser Sache abschließen können.«
Als Sophie dazu schwieg, fuhr Fee fort: »Ich habe mich gestern ein wenig mit Ihrer Mutter unterhalten können, während Sie mit dem Rettungswagen herfuhren. Sie erzählte mir, dass es Ihr Wunsch gewesen sei, nach München zu kommen.«
»Ja, sie ist deswegen immer noch sauer auf mich. Aber ich musste einfach kommen.«
»Hatten Sie Sehnsucht nach der Heimat?«
»Ja, auch«, sagte Sophie stockend und sah wieder auf ihre Hände. Dann sagte sie das, was seit vielen Wochen wie ein Mantra durch ihren Kopf zog: »Hier hat alles angefangen und hier soll es auch enden.«
»Enden?«, fragte Fee sofort nach und konnte nur mit Mühe ihr Entsetzen verbergen. Hatte diese junge Frau etwa vor …? Nein, Fee weigerte sich, diesen Gedanken zu vollenden. Sophie Dannehl mochte zwar etwas durcheinander und verzweifelt sein, aber sie hatte ganz sicher nicht vor, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Wäre es anders, hätte Fee die Zeichen längst erkannt. Sie war schon zu lange Psychiaterin, als dass ihr so etwas entgehen könnte. Fee hatte eine ganz andere Vermutung, und sie hoffte, dass Sophie es endlich aussprechen würde. Es war nicht gut, dass sie dieses Problem allein mit sich ausmachte. Sie musste unbedingt darüber reden.
»Sophie, was meinen Sie damit? Was soll hier enden?«
»Mein Leben«, flüsterte Sophie, und sofort stockte Fee der Atem. Sophie hob den Kopf und sah Fee aus traurigen Augen an. »Mein Leben als Musikerin. Ich will es nicht mehr. Ich will einfach nur ein ganz normales Leben führen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie es aussehen wird.«
Fee war froh, sich nicht getäuscht zu haben. Sophie wollte leben. Wenn auch ohne ihre Musik.
Ein feines Lächeln umspielte Fees Mund. »Ich vermute, Sie haben schon ein paar vage Vorstellungen von Ihrem zukünftigen Leben. Das reicht für den Anfang. Es ist nicht nötig, vorher alles bis ins kleinste Detail durchzuplanen. Manchmal reicht auch eine grobe Richtung, um beginnen zu können. Oft ergibt sich der Rest dann von ganz allein. Eins kommt zum anderen, und die Teile fügen sich wie in einem Puzzle zusammen.«
Erstaunt fragte Sophie: »Sind Sie denn gar nicht entsetzt darüber, dass ich meine Karriere beenden will?«
»Was haben Sie erwartet? Dass ich Ihnen sage, wie furchtbar es ist, dass Sie Ihr außergewöhnliches Talent vergeuden? Tut mir leid, wenn ich Sie enttäusche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das noch zu hören bekommen werden, aber ganz bestimmt nicht von mir. Ich freue mich einfach, dass Sie endlich zu wissen scheinen, wie Sie Ihr Leben nicht führen möchten. So wie es aussieht, möchten Sie nicht länger vor einem großen Publikum auf der Bühne stehen und Geige spielen. Großes Talent hin oder her. Es kann nicht gut oder gesund sein, sich ständig verbiegen zu müssen und Sachen zu machen, die man gar nicht will.«
Sophie gelang ein zaghaftes Lächeln. »Vielen Dank, Frau Dr. Norden. Es war sehr schön, endlich darüber reden zu können. Noch weiß niemand, was ich vorhabe. Und wenn ich an meine Mutter denke …« Sie seufzte. »Ich befürchte, sie wird es nicht so locker sehen wie Sie. Wahrscheinlich bricht für meine Mutter eine Welt zusammen. Sie hat doch so viele Hoffnungen in mich gesetzt. Was soll sie denn machen, wenn ich aufhöre?«
»Tief durchatmen, nach vorn schauen und weitermachen«, erwiderte Fee schmunzelnd. »Was sonst? Ist es nicht das, was wir alle machen, wenn uns Widrigkeiten begegnen? Sie sind nicht verantwortlich für das Leben Ihrer Mutter, Sophie. Sie müssen endlich Ihr eigenes führen.«
Sophie nickte, und Fee sprach weiter: »Doch zuerst müssen Sie es in Ordnung bringen. Es gibt da noch ein paar Altlasten, die Sie bedrücken und die Ihnen Kraft rauben. Und dabei denke ich nicht nur an Julian Hentschel.«
»Sondern an meinen Vater, nicht wahr?«
Fee lächelte. »Sophie Dannehl, Sie sind wirklich eine sehr kluge junge Frau.«
Sophie wusste, dass Fee Norden recht hatte. Sie musste ihr Leben in Ordnung bringen. Schließlich war das der Grund, weshalb sie nach München gekommen war. Alles sollte sich jetzt ändern.
Sie hatte den restlichen Tag in der Radiologie, bei der Sonografie und Ergometrie verbracht. Ganz schön viel für einen Tag, und dennoch fühlte sie sich nicht gestresst. Sie hatte zwischendurch immer wieder genügend Zeit gehabt, um das vorzügliche Krankenhausessen zu genießen, die Füße hochzulegen, zu lesen, zu schlafen und nachzudenken.
Am späten Nachmittag kam Nadja vorbei.
»Ich hatte dir doch gesagt, dass du nicht herkommen musst«, wurde sie von Sophie so freudlos begrüßt, dass es Nadja wehtat. »Falls es noch etwas zu besprechen gibt, hätten wir das auch telefonisch regeln können.«
»Darf ich nicht sehen, wie es meiner Tochter geht?«, fragte Nadja spitz zurück. »Betrachte mein Kommen einfach als Krankenbesuch einer besorgten Mutter und nicht als Geschäftstermin mit deiner Managerin.«
»Tut mir leid«, lenkte Sophie ein. Der psychische Stress, unter dem sie derzeit stand, machte sie ungerecht und launisch. »Du weißt doch, dass ich das nicht so meine.«
»Nun, um ehrlich zu sein, weiß ich seit einiger Zeit nicht mehr, was du eigentlich willst. Du hast dich verändert und verhältst dich ziemlich merkwürdig.«
»Liegt vielleicht daran, dass ich krank bin.«
»Sophie, bitte. Du weißt genauso gut wie ich, dass es nicht daran liegt. Irgendetwas geht hier doch vor! Denkst du wirklich, ich merke das nicht?«
Sophie verschränkte die Arme vor der Brust und schwieg. Noch war sie nicht bereit, die Wahrheit auszusprechen. Für ihre Mutter war sie so schrecklich, dass sie sie wahrscheinlich umbringen würde.
»Julian hat mich heute besucht«, sagte sie, um das Thema zu wechseln und von sich abzulenken. Dass ihr das gelungen war, sah sie an dem schockierten Gesichtsausdruck ihrer Mutter.
»Julian?«, stieß Nadja hervor. »Was wollte er denn?«
»Wie ich schon sagte, mich besuchen. Er war gestern auch auf dem Konzert gewesen und hat meine Ohnmacht mitbekommen. Er wollte nur sehen, wie es mir geht.«
»Und sonst? Habt ihr …« Nadjas Stimme klang seltsam belegt, und sie musste sich erst umständlich räuspern, um wieder klar sprechen zu können. Sophie begann, sich Gedanken darüber zu machen, warum Julians Besuch ihrer Mutter so nahe ging. »Habt ihr noch über andere Dinge gesprochen? Über früher?«
»Ja, natürlich. Schließlich haben wir uns lange nicht gesehen«, log Sophie und beobachtete dabei ihre Mutter ganz genau. Täuschte sie sich oder wurde sie gerade noch eine Spur blasser? »Warum fragst du? Geht es dir gut? Du siehst ein wenig mitgenommen aus.«
»Ja, alles bestens.« Nadja sprang auf und zog sich ihre Jacke an. »Ich bin nur müde. Das war ein anstrengender Tag gewesen. Ich habe stundenlang am Laptop gesessen und telefoniert, um deine Termine für diese Woche abzusagen. Und um die Auftritte für die nächsten Monate musste ich mich auch noch kümmern. Du weißt schon, Flüge buchen, Hotelzimmer reservieren. All das, worum du dich nicht zu kümmern brauchst.«
»Danke, Mama«, murmelte Sophie automatisch und dachte panisch darüber nach, wie und wann sie ihrer Mutter sagen sollte, dass sie nicht vorhatte, München je wieder zu verlassen.
»Ich werde mich dann mal auf den Weg machen und vom Hotel aus noch ein paar Telefonate führen. Ich komme morgen wieder vorbei.«
»Mama, das ist wirklich nicht nötig«, sagte Sophie hastig. »Du kannst hier nichts für mich tun. Gönn dir doch mal ein wenig Freizeit. Triff dich mit alten Freunden, bummle durch die Stadt. Mach einfach die Sachen, zu denen du sonst nicht kommst.« Sie gab ihrer Mutter einen flüchtigen Wangenkuss und dirigierte sie dann zur Tür. »Ich jedenfalls werde diese Zwangspause nutzen und nur das machen, worauf ich Lust habe oder wozu mich die Ärzte zwingen.«
»Nun gut, wenn du meinst.« Nadja war schon halb zur Tür raus, als sie stoppte und sich noch einmal umdrehte.
»Sophie, mein Engel, ich möchte, dass du eins weißt …«
»Ja?«, fragte Sophie nach, als Nadja nicht weitersprach.
»Alles … alles, was ich getan habe, war nur zu deinem Besten. Bitte vergiss das nicht, ja? Ich liebe dich doch und hatte immer nur dein Wohl im Sinn. Glaubst du mir das?«
»Vielleicht solltest du mir einfach sagen, wovon du redest«, erwiderte Sophie hellhörig.
Nadja schüttelte den Kopf. »Nichts, es geht um nichts Bestimmtes. Lass dir bloß nichts einreden, ja? Ich hab dich lieb, Engelchen. Vergiss das bitte nicht.« Dann ging sie und ließ eine nachdenkliche Sophie zurück, die sich fragte, ob die Bemerkung ihrer Mutter mit Julians Auftauchen zusammenhängen könnte.
*
Nadja Dannehl saß in ihrer Hotelsuite und wusste nichts mit sich anzufangen. Wieder einmal wurde ihr bewusst, wie sehr sich ihr eigenes Leben um das von Sophie drehte. Ohne Sophie fühlte sie sich seltsam leer und einsam.
Sie sah sich in der großen Suite mit den gediegenen, teuren Möbeln aus edlem Nussbaum und den Vorhängen aus schwerem Brokat um. Ein Zuhause auf Zeit, in dem sie sich nicht heimisch fühlen konnte, ohne einen Menschen, der ihr etwas bedeutete.
War sie jemals so lange von Sophie getrennt gewesen? Natürlich war sie auch sonst nicht rund um die Uhr mit ihrer Tochter zusammen. Sophie hatte durchaus eigene Verabredungen oder Termine, bei denen Nadja nicht dabei war. Doch das war etwas anderes. Nadja wusste dann immer ganz genau, wo sich ihr Mädchen aufhielt oder mit wem sie sprach. Die totale Kontrolle, hatte Sophie dies einmal in einem kurzen Moment der Auflehnung genannt.
Kontrolle … Nadja hatte das untrügliche Gefühl, dass ihr diese allmählich entglitt. Nicht erst seit heute. Es hatte schon vor einigen Monaten angefangen. Sophie hatte sich verändert. Sie hatte viel von ihrer Unbekümmertheit verloren und war grüblerisch geworden. Diese eigensinnige Münchenreise war nur die Spitze des Eisbergs, befürchtete Nadja. Irgendetwas Schlimmes, das sie nicht beeinflussen konnte, kam unaufhaltsam auf sie zu. Julians Besuch hatte ihr das besonders deutlich vors Auge geführt. Wenn sie wenigstens wüsste, worüber die beiden geredet hatten …
Das Zimmertelefon klingelte, und Nadja sprang auf, froh über diese Ablenkung. Vielleicht war es ja Sophie, die sich noch mal melden wollte.
Doch es war nicht Sophie, sondern Horst.
»Du?«, fragte Nadja völlig verblüfft. »Mit dir hätte ich jetzt nicht gerechnet.«
»Warum nicht? Ist es so seltsam, wenn ich nachfragen möchte, ob es schon Neuigkeiten aus der Klinik gibt?«
»Ja, das ist es in der Tat. Du hast dich sonst auch nicht täglich nach Sophies Wohlbefinden erkundigt.«
»Sonst lag Sophie auch nicht in einem Krankenhaus«, gab Horst mürrisch zurück. Dann schlug er einen freundlicheren Ton an. »Lass uns jetzt bitte nicht wieder streiten, Nadja. Wir könnten uns stattdessen mal zur Abwechslung wie zivilisierte Menschen benehmen, die es schaffen, vernünftig mit ihrer Trennung umzugehen. Zum Beispiel indem sie bei einem netten Abendessen über alte Zeiten plaudern.«
Nadja vergaß vor Überraschung das Luftholen und das Sprechen. Als ihr Schweigen zu lange anhielt, fragte Horst am anderen Ende der Leitung nach: »Nadja? Bist du noch dran?«
»Ja … ja, natürlich. Ich …« Nadja straffte ihre Schultern und stellte sich aufrechter hin. So überwand sie den letzten Rest von Unsicherheit. Als sie weitersprach, hatte sie zu ihrer gewohnten Lässigkeit zurückgefunden. »Das mit dem netten Abendessen nehme ich dir nicht ab«, sagte sie kühl. »Also, warum rufst du an?«
»Wie ich schon sagte: ich möchte wissen, wie es meiner Tochter geht, und ich wollte dich zum Essen einladen. Ich bin in deinem Hotel und habe im Restaurant einen Tisch für uns reserviert. Ich werde dort genau eine Viertelstunde auf dich warten. Wenn du nach Ablauf der Viertelstunde nicht unten bist, gehe ich wieder. Aber … aber ich würde mich sehr freuen, wenn das nicht nötig wäre.« Dann legte er auf.
Mit dem Hörer in der Hand stand Nadja neben dem Telefon und starrte ins Leere, unfähig einen klaren Gedanken zu fassen. Horst wollte mit ihr zusammen sein. So wie früher. Nadja schluckte, als sie an früher dachte. Sie hätte so glücklich sein können. Sie wurde geliebt, hatte eine süße kleine Tochter, ein schönes Heim, kannte keine finanziellen Sorgen. Und trotzdem hatte sie immer das Gefühl gehabt, dass es noch etwas anderes in ihrem Leben geben müsste. Etwas, bei dem sie vergessen konnte, dass ein einziger, dummer Sturz ihren Erfolg als Violinistin zerstört hatte. Es hatte nicht an Horst gelegen, dass es sie immer von ihm fortgezogen hatte. Es waren ihre zerplatzten Träume und die Sehnsucht nach einem anderen, aufregenderen Leben gewesen, die zum endgültigen Bruch geführt hatten. Manchmal, in Momenten wie diesen, fragte sich Nadja, ob sie nun wirklich glücklicher war als früher.
Verwundert berührte sie die feuchte Spur auf ihrer Wange. Weinte sie etwa? Wie lange stand sie hier eigentlich schon rum und trauerte vergangenen Zeiten nach? Seit dem Anruf waren doch bestimmt schon … Nadja schluckte, als sie auf die Uhr sah. Die Viertelstunde war längst vorbei. Sie hatte tatsächlich zwanzig Minuten herumgestanden, Löcher in die Luft gestarrt und dem, was verloren war, nachgetrauert. Selbst wenn es ihre Absicht gewesen wäre, die Einladung zum Essen anzunehmen, war es dafür nun zu spät. Horst war weg!
Plötzlich kam Bewegung in Nadja. Sie schmiss den Hörer aufs Telefon, rannte zum kleinen Sofa, auf dem ihre Handtasche lag, und war schon fast aus dem Zimmer raus, als sie kehrtmachte und ins Bad lief. Ein kurzer, kritischer Blick in den Spiegel, ein paar rasche Handgriffe, um die Haare zurückzustreichen, bevor sie mit zitternden Fingern frischen Lippenstift auftrug und aus der Suite stürzte.
Mit dem Fahrstuhl hatte sie Glück. Er hielt in ihrer Etage, kaum dass sie den Knopf gedrückt hatte. Ihr Herz raste so schnell wie nie zuvor, und es gelang ihr nicht, den Blick von dem kleinen erleuchteten Display abzuwenden, das ihr anzeigte, wie weit der Fahrstuhl noch von der Lobby entfernt war. Warum dauerte das bloß so lange?
Endlich hielt er, und Nadja stürzte hinaus, kaum dass sich die Türen öffneten.
»Hoppla!«, rief Horst Dannehl leise lachend und fing sie auf, als sie ins Stolpern kam. »Du scheinst es ja sehr eilig zu haben.«
Verlegen wand sich Nadja aus seinen Armen und strich sich nervös eine Haarsträhne zurück, die sich aus ihrem Knoten gelöst hatte. »Du bist noch hier«, stellte sie dann etwas zittrig fest.
»Ja, ich dachte, du bekommst noch ein paar zusätzliche Minuten«, entgegnete Horst mit einem amüsierten Lächeln und zwinkerte ihr zu. »Für eine Frau, die sich für ein Rendezvous zurechtmacht, ist eine Viertelstunde wirklich viel zu knapp bemessen.«
»Rendezvous?«, schnaubte Nadja entrüstet und verfluchte sich für den frischen Lippenstift auf ihrem Mund. »Das hier ist ganz sicher kein Rendezvous, und die Zeiten, in denen ich mich für dich zurechtmache, sind endgültig vorbei.«
»Natürlich, Nadja«, sagte Horst weiterhin lächelnd, aber in seinen Augen flackerte ein kurzer Schmerz auf, der sofort wieder verschwand. Während Nadja noch darüber nachdachte, ob das, was sie dort gesehen hatte, nur ihrer Fantasie entsprungen war, führte Horst sie in das elegante Hotelrestaurant zu ihrem Tisch in einer lauschigen Ecke.
»Es ist schön hier«, bemerkte Nadja nüchtern.
»Wahrscheinlich nicht schöner als die anderen Hotels, in denen ihr sonst seid.«
»Kennst du eins, kennst du alle«, sagte Nadja gelangweilt. »Sie ähneln sich. Kein Wunder, oft gehören sie zu ein und derselben Hotelkette. Die Zimmer sehen dann alle gleich aus.«
»Tja, das ist dann ja fast so, als würde man nach Hause kommen«, bemerkte Horst ironisch. »Ich dachte, dein Leben wäre aufregender. Das war es doch, was du dir so sehnlich gewünscht hast.«
Nadja warf ihm einen gekränkten Blick zu. »Ich wollte vor allem, dass unsere Tochter die Chance bekommt, etwas aus ihrem besonderen Talent zu machen. Sie sollte nicht so enden wie …«
»Wie du?«, fragte Horst verletzt, als Nadja verstummte. »Hattest du Angst, dass sie so ein langweiliges und unzufriedenes Leben führen könnte wie du? Mit einem langweiligen Ehemann in einem langweiligen Haus …«
»Hör auf!«, zischte sie ihn aufgebracht an. »Was soll das jetzt? Wollen wir uns hier wirklich über Dinge streiten, die keine Bedeutung mehr haben? Hast du mich deswegen hergebeten?«
Als sie aufspringen wollte, legte Horst schnell eine Hand auf ihren Unterarm. »Bitte, Nadja, bleib«, bat er sie zerknirscht. »Es tut mir leid. Ich wollte keine alten Wunden aufreißen, sondern nur ein paar nette Stunden mit dir verbringen und mit dir zu Abend essen. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich davon angefangen habe. Verzeih mir bitte.«
Nadja nickte nach kurzem Zögern und griff zur Speisekarte. Sie kannte Horst gut genug, um zu wissen, dass er seine Entschuldigung ernst meinte und dass der restliche Abend deswegen angenehmer verlaufen würde. Doch es war nicht so leicht, eine ungezwungene Unterhaltung in Gang zu bringen. Beide passten auf, was sie sagten und wogen jedes Wort vorsichtig ab, weil sie ahnten, wie dünn und zerbrechlich das Eis war, auf dem sie sich bewegten.
Erst nach dem Essen, bei der zweiten Flasche Wein wurden sie lockerer, und die Anspannung ließ nach.
Horst lauschte beeindruckt, wenn Nadja von den aufregenden Reisen um den Globus berichtete und von den vielen Galaempfängen, auf denen sie Gast gewesen waren, schwärmte. Er erzählte von dem alten Pfirsichbaum, den sie so geliebt hatte und den er im letzten Jahr fällen musste, weil ein hartnäckiger Pilzbefall zum Absterben des Baumes geführt hatte.
»Kein Baum in der Nachbarschaft hatte so große, süße Früchte wie unser«, seufzte Nadja. »Rita von nebenan hatte sich jedes Jahr eine große Kiste geholt, um Marmelade einzukochen.«
»Damit hat Rita schon vor Jahren aufgehört. Nach der Scheidung von ihrem Manfred lagen ihre Interessen woanders.«
»Aha, lass mich raten: Sie ging wieder auf Männerfang.«
Horst lachte. »Und das äußerst erfolgreich. Im letzten Sommer hat sie wieder geheiratet.«
»Zum fünften Mal!«, rief Nadja gleichzeitig entsetzt und fasziniert aus.
Horst schüttelte grinsend den Kopf. »Eigentlich ist er die Nummer Sechs. Es gab da noch einen Optiker aus Stuttgart. Von ihm ließ sie sich vor vier Jahren scheiden. Dann folgten ein paar kurzlebige Bekanntschaften, nichts Ernstes, bis sie dann Bertram kennenlernte und sie ein halbes Jahr später zum Standesamt gingen.«
»Kurzlebige Bekanntschaften?«, fragte Nadja und griff nach ihrem Weinglas. Sie versuchte, ihr Interesse zu verbergen, als sie nachhakte: »Gehörtest du je dazu?«
»Wie bitte?«, fragte Horst konsterniert nach.
Nadja merkte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. »Oh … entschuldige. Das geht mich natürlich nichts an. Ich dachte nur … Ach, vergiss es einfach. Ich hätte nicht fragen sollen.«
»Nun hast du es aber gemacht. Also, erzähl, warum möchtest du wissen, ob ich bei der schönen Rita schwach geworden bin?«
»Schöne Rita?« Nadja lachte humorlos auf. »Keine Ahnung, was ihr Männer nur an dieser billigen Monroe-Kopie findet!«
Horst lachte. »Das musst du diejenigen fragen, die ihr erlagen. Ich gehörte jedenfalls nie dazu.«
»Gut!«, entfuhr es Nadja, dann ruderte sie schnell zurück. »Es wäre mir natürlich völlig egal, wenn es anders wäre. Schließlich bist du ein freier Mann und kannst dich abgeben, mit wem du willst.«
»Ja, genau wie du«, erwiderte Horst leise. Er wusste nicht, mit wie vielen Männern Nadja seit ihrer Scheidung zusammen gewesen war. Oder ob es überhaupt je einen nach ihm gegeben hatte. Obwohl das mehr als wahrscheinlich war. Immerhin war Nadja eine sehr attraktive Frau. Noch immer war sie eine auffallende Erscheinung, nach der sich die Männer umsahen, wenn sie den Raum betrat. Nur wenige ahnten, dass sie die Fünfzig längst überschritten hatte. Sie wäre leicht für Anfang vierzig durchgegangen und hatte nichts von der Schönheit jüngerer Jahre eingebüßt. Horst hatte sich oft gefragt, wie es ihm eigentlich gelungen war, sie zu erobern. Seit sie damals ein Paar geworden waren, hatte er immer befürchtet, dass er ihr nicht genügen könnte und dass sie ihn irgendwann verlassen würde. Als es dann tatsächlich geschah, hatte es ihn nicht sonderlich überrascht. Trotzdem hatte ihn der Verlust so heftig getroffen, dass er lange Zeit dachte, er würde sich nie wieder davon erholen.
»Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast«, sagte Horst, als sie sich zu sehr später Stunde vor dem Fahrstuhl in der Lobby verabschiedeten.
»Ja, ich auch«, erwiderte Nadja mit einem aufrichtigen Lächeln.
*
Daniel Norden hatte auf dem kleinen Sofa in Sophies Zimmer Platz genommen und ihre Akte und ein Tablet neben sich abgelegt. Schmunzelnd sah er sich um. »Nur zwei Blumensträuße?«, fragte er. »So wie es derzeit auf der Station aussieht, dachte ich, dass Ihr Zimmer eher einem Blumenladen ähneln würde. Sie haben eine sehr große Fangemeinde.«
»Ich konnte nicht alle Blumen, die mir geschickt wurden, hier unterbringen«, erwiderte Sophie lächelnd. »Die Schwestern waren so freundlich, die meisten Sträuße auf der Station zu verteilen.«
»Und warum nicht diese beiden? Kann es sein, dass diese Blumen nicht von den üblichen Fans kommen, sondern eine persönliche Bedeutung haben?«
Sophie nickte. »Ja, sie kommen von zwei Menschen, die mir sehr wichtig waren oder immer noch sind.«
Es waren keine extravaganten oder teuren Blumen, die in zwei Porzellanvasen auf dem Tisch und der kleinen Kommode standen. Da hatte Daniel vorhin auf dem Stationsflur und im Schwesternzimmer prachtvollere Arrangements gesehen. Doch diese hier hatten etwas an sich, was Sophie immer wieder dazu brachte, einen liebevollen Blick in ihre Richtung zu werfen oder – so wie jetzt – an ihnen zu schnuppern.
»Duftende Freesien«, schwärmte Sophie mit einem verträumten Gesichtsausdruck. »Kein noch so teures Parfüm kann sich dagegen behaupten.«
Daniel nickte. »Da gebe ich Ihnen recht. Ich mag Freesien auch sehr gern. Leider riechen die meisten gezüchteten Sorten kaum noch. Es ist nicht so einfach, duftende Freesien aufzutreiben. So wie’s aussieht, hat sich da jemand ganz besonders viel Mühe gegeben.«
»Sie sind von Julian Hentschel«, sagte Sophie mit einem wehmütigen Lächeln. »Ich bin mir nicht sicher, ob Sie von ihm wissen … Vielleicht hat Ihnen Ihre Frau von meiner Beziehung zu Julian erzählt.«
»Ich kenne ihn. Vor allem seine Eltern. Sie waren Patienten in meiner Praxis. Und dass Sie mit ihm befreundet waren, ist mir auch noch bekannt. Und der andere Strauß? Verraten Sie mir auch, von wem der ist?«
Sophie sah zu den bunten Frühlingsblumen hinüber, die auf dem Schränkchen standen. »Mein Vater hat sie mir geschickt. Ich … ich habe mich dafür noch nicht mal bei ihm bedankt. Und bei Julian auch nicht.«
»Sie müssen nichts überstürzen, Sophie. Lassen Sie sich Zeit. Im Moment ist sowieso Ihre Gesundheit das Wichtigste.«
»Ja, natürlich, Dr. Norden.« Sophie sah zu den Unterlagen, die Daniel Norden mitgebracht hatte. »Ich nehme an, Sie können mir inzwischen sagen, was mir fehlt.«
»Ja, das kann ich. Wir haben Sie ja durchs ganze Haus geschickt und Sie ständig auf Trab gehalten, damit wir alle Befunde zusammenbekommen. Die letzten drei Tage waren sicher sehr anstrengend für Sie.«
Sophie lachte leicht belustigt. »So schlimm war das gar nicht, Dr. Norden. Um ehrlich zu sein, im Vergleich zu dem Arbeitspensum, das ich sonst absolvieren muss, war das hier die reinste Erholung. Ich glaube, ich habe schon seit ewigen Zeiten nicht mehr so gut und vor allem so viel geschlafen wie in der Behnisch-Klinik.« Sophie meinte jedes Wort genau so, wie sie es sagte. Seit sie als Patientin auf der Inneren lag, fühlte sie sich unglaublich erholt und ausgeruht. Sie wunderte sich nur, dass Dr. Norden darüber nicht so glücklich aussah wie sie.
»Das freut mich natürlich«, sagte Daniel ungewöhnlich ernst. »Aber es bereitet mir auch Sorgen. Ihre Worte und auch die Befunde lassen nämlich vermuten, dass Sie sich in den letzten Jahren zu viel zugemutet haben und Ihre Gesundheit darunter gelitten hat.«
Das Lächeln auf Sophies Gesicht erstarb augenblicklich. »Wie schlimm ist es?«, fragte sie erschüttert. »Bin ich ernsthaft krank?«
»Es ist nichts, was sich nicht mit der richtigen Behandlung und einer gesunden Lebensweise in Ordnung bringen ließe«, beruhigte Daniel sie. »Wir haben jetzt alle Befunde zusammen und wissen mit ziemlicher Sicherheit, woher Ihre Eisenmangelanämie kommt. Manchmal sind chronische entzündliche Darmerkrankungen die Ursache. Oder versteckte innere Blutungen, zum Beispiel bei Magengeschwüren. Das konnten wir bei Ihnen zum Glück alles ausschließen. Ihr Körper nimmt schlichtweg nicht genügend Eisen mit der Nahrung auf.«
Sophie blinzelte ihn verwirrt an. »Ja, aber das wusste ich doch bereits. Deswegen nehme ich doch das Eisenpräparat.«
»Eigentlich sollte das nicht nötig sein. Der Körper kann zwar selbst kein Eisen bilden, er ist darauf angewiesen, dass es zugeführt wird. Wenn wir gesund leben und uns ausgewogen ernähren, reicht das, was wir an Eisen über unsere Nahrung aufnehmen, völlig aus. Doch bei vielen Menschen, die unter einem Eisenmangel leiden, kommen ein paar ungünstige Faktoren zusammen, die die Eisenaufnahme erschweren oder hemmen. So wie bei Ihnen.«
»Welche Faktoren?«, wollte Sophie sofort wissen.
»Sie erwähnten ja bereits Ihr großes Arbeitspensum mit viel zu wenigen und zu kurzen Erholungsphasen. Das, was Sie jeden Tag leisten, mit stundenlangem Üben, den vielen Proben, Auftritten, Umherreisen entspricht dem Stresslevel eines Hochleistungssportlers. Ich war entsetzt, als ich Ihren Terminplan vom letzten Jahr gesehen habe. Es gab nicht einen Tag, an dem Sie mal gar nichts taten und sich einfach ausgeruht haben.«
Sophie schüttelte stumm den Tag. »Das geht nicht«, sagte sie leise. »Selbst wenn ich keinen Auftritt habe oder nicht im Flieger sitze, muss ich üben und mich vorbereiten. Das gehört nun mal zu meinem Leben dazu.«
»Dann ist es gut, dass Sie endlich angefangen haben, dieses Leben auf den Prüfstand zu stellen, Sophie«, erwiderte Daniel behutsam. Von Fee wusste er bereits, dass Sophie vorhatte, ihre Karriere zu beenden. »Sie haben jahrelang Raubbau an Ihrem Körper betrieben. Eine Zeit lang verkraftet er solch außergewöhnliche Belastungen. Aber dass dem jetzt nicht mehr so ist, merken Sie daran, dass Sie sich schwach und energielos fühlen oder gar in Ohnmacht fallen. Sie brauchen unbedingt Pausen und müssen sich vernünftig ernähren. Die vielen Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, die Sie jeden Tag prophylaktisch einnehmen, sind nämlich kein vollwertiger Ersatz dafür. Ganz im Gegenteil. Viele dieser Präparate enthalten Calcium oder Magnesium. Auch die braucht ihr Körper, aber leider behindern sie gleichzeitig die Eisenaufnahme. Ihr Körper nimmt das Eisen aus Ihrem Essen oder den Eisentabletten dann nicht in ausreichender Menge auf.«
»Und was kann ich dagegen machen?«
Daniel gab ihr eine kleine Mappe. »Unsere Ernährungsärztin hat Ihnen eine Liste mit Lebensmitteln, die sehr eisenhaltig sind, zusammengestellt. Achten Sie darauf, dass Sie sie regelmäßig zu sich nehmen und mit einem ausreichenden zeitlichen Abstand zu Ihren Vitaminpräparaten, damit diese die Eisenaufnahme nicht hemmen können. Noch besser wäre es natürlich, Sie würden auf diese künstlichen Zusatzstoffe verzichten, weil Sie sich von nun an gesund ernähren und krankmachenden Stress aus Ihrem Leben verbannen.«
Sophie sah auf die Papiere in ihren Händen und nickte. »Ich glaube, das bekomme ich hin. Jetzt, da ich weiß, wie wichtig es für meine Gesundheit ist.«
Daniel griff nach seinem Tablet und öffnete eine Datei. »Nun kommen wir zu Ihrem zweiten Problem, Sophie.«
Er drehte sein Tablet so, dass Sophie die Bilder darauf sehen konnte. »Das sind Aufnahmen, die wir während Ihrer Gastroskopie gemacht haben.« Mit einem Stift zeigte er auf einige tiefrote Areale. »Die Schleimhaut Ihrer Speiseröhre ist stark angegriffen und entzündet, Sophie. In Ihrem Magen sieht es nicht besser aus. Sie leiden sehr häufig unter Sodbrennen, bei dem die Magensäure immer wieder in ihre Speiseröhre fließt. Refluxkrankheit nennen wir das.«
»Darunter leiden doch viele, und deswegen nehme ich auch meine Säureblocker ein.«
»Sie helfen gut bei kurzzeitigen Problemen, sollten aber kein Dauerzustand sein. Das sind leider keine Bonbons, die Sie da jeden Tag mehrfach zu sich nehmen. Sie enthalten sehr viel Aluminium, Calcium und Magnesium, die ihrerseits auch die Eisenaufnahme hemmen. Und leider verhindern Sie nicht sicher das Entstehen von Schleimhautentzündungen, wie Ihre Aufnahmen beweisen.«
»Und was soll ich sonst tun?«, fragte Sophie kleinlaut.
»Der Ursache für Ihre übermäßige Säureproduktion auf den Grund gehen. Oft liegt es wirklich nur an ungünstigen Nahrungsmitteln, oft aber auch an Stress, Leistungsdruck und psychischen Problemen. Ich vermute, dass bei Ihnen alles davon zutrifft.«
Sophie nickte betrübt. »Dass mich meine Musik so krank macht, hätte ich nicht gedacht.«
»Ist es wirklich die Musik?«
»Nein, nicht direkt. Meine Musik und das Geigenspiel liebe ich aus tiefstem Herzen. Aber genauso intensiv hasse ich es, vor Publikum aufzutreten. Dann leide ich besonders intensiv unter meinen Magenproblemen. Früher hatte ich gehofft, dass sich mein großes Lampenfieber irgendwann legen würde, aber stattdessen wird es immer schlimmer.«
»Nicht jeder ist fürs Rampenlicht geschaffen. Seit wann wissen Sie, dass es so nicht weitergehen kann?«
»Seit einem Jahr. Aber erst jetzt bin ich so weit, einen Schlussstrich zu ziehen. Nun muss ich nur noch den Mut aufbringen, es meiner Mutter zu sagen. Ich muss gestehen, ich habe riesige Angst davor. Es ist nicht so einfach, sein Leben umzukrempeln, wenn andere darunter zu leiden haben.«
»Dann leiden Sie also lieber selbst und nehmen in Kauf, davon krank zu werden?«
Kopfschüttelnd antwortete Sophie auf Daniels Frage: »Nein, nicht mehr. Das gehört der Vergangenheit an. Ich will unbedingt mein Leben zurückhaben. Ich will das haben, was für andere Menschen selbstverständlich ist: Freunde, eine Familie, ein Sonntagsausflug ins Grüne, ein Tag am See … ich will einfach nur glücklich sein.«
*
Horst hatte das Küchenfenster weit geöffnet. Ein leichter Frühlingswind spielte mit den schneeweißen Gardinen über der Spüle und brachte den süßen Duft von Kirschblüten ins Haus.
Auf einem runden Tablett standen die Kaffeekanne, eine Tasse und ein kleiner Teller mit frischem Gebäck. Es war heute ein besonders schöner und sonniger Tag, der dazu einlud, den Nachmittagskaffee im Garten zu trinken.
Doch das Klingeln an der Haustür hielt Horst davon ab, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Als er die Tür schwungvoll öffnete, erstarrte er sofort.
Seit Sophie vor vielen Jahren das Haus verlassen hatte und mit ihrer Mutter in dieses Taxi gestiegen war, hatte er gehofft, dass sie eines Tages einfach so vor seiner Tür stehen würde. Aber er hatte es nicht erwartet, und deshalb stand er jetzt nur sprachlos da und sah sie an.
»Darf ich hereinkommen?«, fragte Sophie, noch bevor er sich wieder sammeln konnte.
»Ja, ja … bitte, Sophie, komm rein.« Er sprang zur Seite und ließ sie vorbeigehen, obwohl er sie viel lieber in seine Arme gezogen hätte.
Sophie ging den schmalen Flur entlang, der direkt in die große Küche führte. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, ins Wohnzimmer zu gehen. Das Leben der Familie Dannehl hatte immer in der Küche stattgefunden. Hier wurde gekocht und gegessen, gelacht und gestritten, Hausaufgaben gemacht und geplaudert. Sophie strich mit einer Hand über den leuchtendblauen Stoff einer Stuhllehne und sah sich um. Es hatte sich kaum etwas verändert. Es war noch fast alles so wie in ihrer Erinnerung.
»Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist«, begann ihr Vater stockend. »Du siehst gut aus, erholt. Geht es dir wieder besser?«
»Ja, danke.« Sophie ärgerte sich, dass sie miteinander umgingen wie flüchtige Bekannte, die sich nichts zu sagen hatten. Die Mauer, die die Zeit zwischen ihnen aufgebaut hatte, ließ sich nicht einfach niederreißen. Diese Erkenntnis tat weh, und plötzlich wünschte sie sich sehnsüchtig, alles wäre so wie früher. Dann würden sie sich nicht wie zwei Fremde gegenüberstehen, dann wüssten sie genau, was sie tun müssten, damit alles wieder in Ordnung käme.
»Du wolltest gerade Kaffee trinken?« Sophie blieb vor dem Tablett mit dem Kaffeegeschirr stehen, das ihr Vater auf dem Tisch abgestellt hatte.
»Ja …«, sagte Horst mit belegter Stimme. »Das Wetter ist heute so schön. Da wollte ich mich nach draußen setzen. Es … es wäre schön, wenn du mir Gesellschaft leisten würdest.«
»Gern. Danke.«
Als Horst eine zweite Tasse aus dem Schrank holen wollte, wehrte sie ab: »Für mich bitte nur ein Glas Wasser. Ich trinke keinen Kaffee.«
Horst lächelte. »Du hast es dir also nie angewöhnt. Früher hast du zu deinen Keksen immer ein Glas Milch getrunken. Eiskalt musste sie sein, aus dem Kühlschrank.«
»So mag ich sie immer noch am liebsten.« Auch Sophie lächelte jetzt, und plötzlich begann das Eis zu schmelzen. Als ihr Vater zum Kühlschrank ging und fragend die Milchpackung hochhielt, nickte sie. Und als sie sich unter dem alten Birnbaum gegenübersaßen, stürzten die Erinnerungen an eine wundervolle, glückliche Kindheit so heftig auf Sophie ein, dass ihr die Tränen in die Augen schossen.
Horst griff über den Tisch nach ihrer Hand und streichelte sie. »Es tut mir so leid«, sagte er leise. »So unsagbar leid, meine Kleine. Ich hätte dich nie gehenlassen dürfen.«
»Warum hast du es dann trotzdem getan?«, fragte Sophie schluchzend. »Warum hast du mich nicht aufgehalten? Ich war doch deine Tochter!«
Hilflos zog Horst seine Hand zurück. Seine Schultern sanken hinunter. »Ich wollte dir und deiner Karriere nicht im Wege stehen. Du solltest dein Glück machen dürfen, ohne auf deinen Vater Rücksicht nehmen zu müssen.«
»Ich wäre geblieben, wenn du mich darum gebeten hättest.«
»Und deshalb habe ich es nicht getan, meine Kleine. Ich wollte nicht, dass du mir irgendwann mal vorwirfst, ich hätte dein Leben ruiniert und dich um eine große Chance gebracht. Kannst du das nicht verstehen?«
Sophie nickte bekümmert. »Doch, das kann ich verstehen. Und eigentlich müsste ich dir für deinen Großmut, mich einfach gehenzulassen, sogar dankbar sein. Aber ich habe mir trotzdem jeden Tag gewünscht, du hättest es nicht getan.«
Bestürzt sah Horst seine Tochter an. »Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, dir gefällt dein Leben so, wie es ist. Ich dachte immer, dass es das ist, was du wolltest.«
Traurig schüttelte Sophie den Kopf. »Nein, das ist das, was Mama wollte. Ich war nur zu schwach gewesen, um mich gegen sie aufzulehnen. Außerdem war ich damals gerade so verletzt und traurig gewesen. Ich wollte einfach nur allem davonlaufen.«
»Mit allem meinst du Julian, nicht wahr?«, fragte Horst einfühlsam. »Du hast nie darüber gesprochen, was zwischen euch vorgefallen war. Ihr seid doch eine Zeit lang so glücklich gewesen.«
»Ja, bis er sich auch für andere Mädchen interessierte.« Sophie seufzte unglücklich auf. »Mama hat ihn dabei erwischt, wie er eine Freundin von mir geküsst hat. Sie meinte, es sei ein offenes Geheimnis, dass Julian Hentschel immer zweigleisig fahre.«
»Hm, deine Mutter hat dir das also erzählt … » Eine steile Falte erschien auf seiner Stirn, als er angestrengt über die Worte seiner Tochter nachdachte. Ein schrecklicher Verdacht kam plötzlich in ihm auf. »Hast du je mit Julian darüber gesprochen und dir seine Version der Geschichte angehört?«
»Nein«, gab Sophie etwas kleinlaut zu. Merkwürdig, dass sie sich deswegen so schuldig fühlte. »Ich war am Boden zerstört, und als Mama mir dann anbot, einfach den nächsten Flieger zu nehmen und die Stadt zu verlassen, habe ich zugegriffen.«
»Heißt das, du hättest das Angebot von dieser New Yorker Agentur ausgeschlagen, wenn Julian dich nicht hintergangen hätte?«
»Ja, ich hatte mich eigentlich schon entschieden, bei ihm zu bleiben und meine Schule abzuschließen. Doch so … ich wollte einfach nur noch weg.«
Horst griff wieder nach Sophies Hand. »Liebes, ich weiß, es steht mir nicht zu, dir irgendwelche Ratschläge zu geben, aber du solltest unbedingt mit Julian darüber reden.«
»Ja, vielleicht mache ich das. Ich hatte selbst schon darüber nachgedacht. Weißt du, ob er immer noch hier in der Nähe lebt?«
»Du wirst ihn da finden, wo du ihn zurückgelassen hast, nur fünf Minuten von hier entfernt. Er wohnt immer noch in dem alten Haus in der Wiesenstraße. Übrigens allein, nachdem seine Eltern vor einigen Jahren zu ihrer Tochter nach Südafrika gezogen sind.«
»Er ist also nicht …« Sophie wand sich verlegen. »Ist er verheiratet oder mit jemandem zusammen?«
»Bis gestern war er es noch nicht. Aber warum fragst du ihn nicht einfach? Bei diesem herrlichen Wetter wird dir ein kleiner Spaziergang sicher guttun.«
Sophie lächelte. »Das ist eine gute Idee, Papa.«
Es war das erste Mal, dass seine Kleine ihn wieder Papa nannte, und Horst gelang es nur mühsam, die Tränen der Rührung zurückhalten. Als Sophie dann auch noch aufstand, um ihn zu umarmen, war es um seine Fassung geschehen.
»Papa?«, fragte er leise schniefend. »Du nennst mich immer noch Papa? Heißt das, du verzeihst mir?«
»Es gibt nichts, was ich dir verzeihen muss. Letztendlich hatte ich die Entscheidung getroffen, alles aufzugeben und München zu verlassen. Deshalb mache ich weder dir noch Mama Vorwürfe. Und das Leben, das ich in den vergangenen zehn Jahren geführt habe, war nicht nur schlecht. Es war auch sehr schön, aufregend und schillernd. Diese Erfahrungen möchte ich nicht missen. Aber nun wird es Zeit für Veränderungen.«
»Veränderungen?«, fragte Horst erstaunt. »Heißt das etwa, du trittst von der Bühne ab?«
Sophie nickte. »Ja, du weißt, dass ich das Rampenlicht schon als kleines Mädchen gehasst habe. Das hat sich nie geändert. Ich bin es leid, Dinge zu tun, die ich verabscheue und die mich krank machen.«
»Weiß deine Mutter schon davon?«
»Nein.« Sophie stöhnte verhalten auf. »Ich fürchte, das wird sie schwer treffen. Ich werde später versuchen, es ihr so schonend wie möglich beizubringen. Aber jetzt …« Sie lächelte ihren Vater an. »Jetzt mache ich erst mal einen Spaziergang.«
*
Der Weg bis zu Julians Haus fühlte sich für Sophie noch immer so vertraut an, als wäre sie ihn erst gestern gegangen. Sie war unzählige Male auf diesen Pflastersteinen entlanggelaufen, um den Jungen, dem sie ihr Herz geschenkt hatte, zu sehen. Obwohl er nur zwei Straßen entfernt von ihr wohnte, war ihr der Weg zu ihm immer endlos lang vorgekommen. Sie hatte diesen Moment, in dem sie endlich in seine Arme sinken konnte, nie erwarten können. Doch diesmal war es anders. Diesmal wünschte sie sich, ihr wäre mehr Zeit geblieben, um sich auf das Wiedersehen mit ihm vorzubereiten. Viel zu schnell war sie vor dem kleinen Häuschen, in dem er wohnte, angekommen.
Unschlüssig blieb sie an der Gartenpforte stehen. Ihr Mut hatte sie verlassen, und sie wusste nicht mehr, weshalb sie überhaupt hier war. Wahrscheinlich wollte er sie gar nicht sehen, nach all den Jahren. Aber warum war er dann zu ihr in die Klinik gekommen? Und seine Blumen! Er hatte nicht vergessen, wie sehr sie den Duft von Freesien liebte. Das musste doch etwas bedeuten. Wenn sie ihm völlig gleichgültig geworden wäre, hätte er sich bestimmt nicht an ihre Lieblingsblumen erinnert. Dann fiel ihr ein, dass sie eigentlich allen Grund hatte, auf ihn wütend zu sein. Schließlich hatte er sie damals hintergangen und betrogen. Und trotzdem war sie hier. Sie musste einfach mit ihm reden, wollte aus seinem Mund hören, was damals vorgefallen war. Erst dann würde sie mit diesem schmerzlichen Kapitel abschließen und ihn endlich vergessen können.
»Hast du vor, irgendwann hereinzukommen?«
Sophie fuhr zusammen und sah zum Haus hinüber. Dort stand Julian mit verschränktem Armen im Türrahmen und beobachtete sie. Er trug ein graues Shirt, Jeans und Sneakers. Seine Haut war leicht gebräunt und verriet, dass er sich viel im Freien aufhielt. Obwohl es mehrere Meter vom Gartenzaun bis zu seiner Haustür waren, konnte Sophie erkennen, dass ein warmes Lächeln in seinen Augen lag. Das gab ihr den Mut, die kleine Pforte aufzustoßen und entschlossen auf ihn zuzugehen. Kurz bevor sie ihn erreichte, drehte er sich um und ging ins Haus.
»Komm rein«, rief er ihr über die Schulter zu, ohne auf sie zu warten.
Sophie folgte ihm durch den Flur hindurch ins Wohnzimmer und von dort auf die Terrasse. Sie sah ihm zu, wie er sich auf einem Stuhl fallenließ und die langen Beine ausstreckte.
»Bist du endlich bereit, mit mir zu sprechen?«, fragte er und zeigte auf den freien Platz auf der anderen Seite des Tisches.
Sophie setzte sich nach kurzem Zögern, vermied es aber, ihn anzusehen. Stattdessen wanderte ihr Blick über den gepflegten Rasen, zu den bunten Blumenrabatten und den akkurat angelegten Gemüsebeeten, auf denen der erste Salat heranwuchs.
»Es sieht toll aus!«, entfuhr es ihr erstaunt. »Hast du einen Gärtner?«
Julian lachte leise, und Sophie merkte, wie sehr sie sein tiefes, sonores Lachen vermisst hatte.
»Nein, ich habe keinen Gärtner«, antwortete er amüsiert auf ihre Frage. »Ich bin Gärtner.«
»Du …« Sophie riss erstaunt den Mund auf.
»Gartenbaumeister, um genau zu sein. Ich habe seit zwei Jahren eine eigene Firma, die sich mit dem Anlegen und Planen von Gärten und Parks beschäftigt und sehr gut läuft.«
»Das freut mich für dich«, sagte Sophie ehrlich beeindruckt und sah ihm endlich in die Augen. Ein großer Fehler, wie ihr sofort klar wurde. Denn plötzlich waren all diese verwirrenden Gefühle wieder da, die sie tief in ihrem Innern vor langer Zeit vergraben hatte. Es waren schon immer Julians Augen gewesen, die ihr Herz schneller schlagen ließen und die dafür sorgten, dass sie an nichts anderes denken konnte als an ihn. Dass sie immer noch so heftig auf ihn reagierte, wunderte sie nicht. Sie hatte gewusst, dass sie nie aufgehört hatte, ihn zu lieben. Doch sie wunderte sich, dass es ihm anscheinend nicht anders ergangen war – wenn sie dieses heiße Brennen in seinem Blick richtig deutete.
»Warum bist du damals einfach fortgegangen?«, fragte er, und Sophie meinte herauszuhören, wie verletzt er deswegen war. Das stand ihm nicht zu. Sie war diejenige, die verletzt wurde, nicht er.
»Warum?«, fragte sie bitter zurück. »Sollte ich etwa bleiben, nachdem du dich mit anderen Mädchen amüsiert hast? Ich hatte dir vertraut, und du … du hast mich verraten!«
»Was soll dieser Unsinn? Ich war dir immer treu! Für mich hat es nie eine andere gegeben! Du musst hier keine Geschichten erfinden, nur um dein Verschwinden zu rechtfertigen!«
»Ich erfinde gar nichts!«, empörte sich Sophie. »Meine Mutter hat gesehen, wie du Anja geküsst hast.«
Julians Gesicht verdüsterte sich. »Deine Mutter! Aha!«, sagte er trocken. »Hätte ich mir ja gleich denken können.«
Sofort musste Sophie daran denken, dass auch ihr Vater so merkwürdig reagiert hatte, als sie ihre Mutter erwähnt hatte. Und auf einmal fügten sich alle Teile zusammen, und für Sophie wurde es furchtbare Gewissheit: Ihre Mutter hatte sich Julians Untreue nur ausgedacht, um sie aus München und von dem Jungen, den sie liebte, fortzulocken. Der Schock darüber traf sie so tief, dass sie die Fassung verlor.
»O mein Gott!«, stieß sie hervor. »Ich kann nicht glauben, dass sie uns das angetan hat.« Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann zu weinen.
Julian sprang auf und eilte zu ihr. Er ging vor ihr in die Hocke, zog sacht ihre Hände hinunter und strich ihr zärtlich über die tränennassen Wangen.
»Nicht weinen, Sophie«, versuchte er, sie zu trösten. »Nun ist doch alles gut. Bitte weine nicht mehr. Jetzt weißt du doch, dass ich dir immer treu war. Du musst nun nicht mehr weinen.«
»Aber …, wir …«, schluchzte sie leise. »Sie hat uns auseinandergerissen! Sie hat unsere Liebe zerstört!«
»Hat sie das? Hat sie es wirklich geschafft, unsere Liebe zu zerstören?«
Sophie sah ihn überrascht an und versuchte, den Sinn seiner Worte in seinem Gesicht abzulesen. Konnte es tatsächlich sein, dass er sie noch immer liebte?
Julian nickte, als hätte sie ihre Frage laut ausgesprochen. »Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Und ich weiß, dass du nicht anders empfindest. Ich kann es spüren, und ich kann es in deinen Augen sehen. Du liebst mich, genauso wie ich dich liebe.«
Sophie war ihm so nah, dass sie seinen Atem auf ihrer Haut spüren konnte. Und sie meinte, sein Herz zu hören, das so schnell und laut schlug wie das ihre.
»Bitte sag, dass du mich liebst, Sophie. Sag mir, dass die Trennung nichts an deinen Gefühlen für mich ändern konnte.«
»Nein«, hauchte Sophie und sah, wie er unter diesem harmlosen Wort zusammenzuckte. Sie strich ihm sanft über das Gesicht und sagte voller Liebe: »Nein, das konnte sie nicht. Weder sie noch meine Mutter. Ich liebe dich, Julian.«
Als Julians Lippen ihren Mund berührten, verschwanden auch die letzten Zweifel. Sie vertraute ihm und glaubte an seine Liebe. Niemand würde es je wieder schaffen, sie auseinanderzureißen. Weder ihre Mutter noch ihre Musik. Julian war ihre wahre und einzige Liebe.
»Was wird nun passieren?«, fragte Julian später, als sie in seinen Armen lag. »Wann wirst du München verlassen?«
Sophie schüttelte den Kopf. »Gar nicht. Ich bleibe hier.«
»Und deine Konzerte?«, fragte Julian atemlos.
»Ich habe sie alle abgesagt. Sie sind nicht gut für mich, und sie bedeuten mir nichts. Das haben sie nie.«
»Ich will ehrlich sein: Ich freue mich über deine Entscheidung. Aber selbst, wenn sie anders ausgefallen wäre, hätten wir diesmal eine Möglichkeit gefunden zusammenzubleiben. Es gibt nichts, was uns noch einmal trennen könnte.«
»Auch nicht meine Mutter«, ergänzte Sophie seufzend. »Ich hatte seit Wochen Angst davor gehabt, mit ihr über mein Karriereende zu reden. Seitdem ich weiß, was sie getan hat, ist die Angst weg. Ich bin viel zu sauer auf sie, um auch noch Angst haben zu können. Ich werde mit ihr reden. Heute noch.«
»Wenn du Verstärkung brauchst, bin ich für dich da.«
Dafür hatte er sich einen Kuss verdient. »Danke, Julian«, sagte Sophie weich. »Aber das werde ich allein schaffen. Ich bin keine siebzehn mehr.«
*
Nadja ließ die Tür ihrer Suite hinter sich zufallen. Noch während sie in ihr Schlafzimmer hinüberging, streifte sie ihre Jacke ab und ließ sie achtlos auf den Boden gleiten. Sie schlüpfte aus ihren Schuhen und fiel bäuchlings auf das breite Doppelbett. Dort lag sie mehrere Minuten reglos und hoffte, dass es ihr endlich gelingen könnte, den Verlust und ihre herbe Niederlage gebührend zu beweinen. Doch so sehr sie sie auch herbeisehnte, die Tränen blieben aus.
Irgendwann gab sie auf und erhob sich. Auf müden Beinen schlurfte sie zurück in den großen Wohnraum und steuerte die Minibar an. Nadja war keine Frau, die zur Flasche griff, um ihren Kummer im Alkohol zu ertränken. Doch diesmal war es anders. Sie wollte wenigstens testen, ob er ihr über den Verlust ihrer Tochter hinweghelfen könnte. Sie holte das Stärkste, das sie fand, aus dem Kühlschrank und öffnete den Schraubverschluss der Flasche, als es an der Tür klopfte.
Mit dem Wodka in der Hand ging sie zur Tür und riss sie auf. Als sie Horst sah, verzog sie zynisch den Mund.
»Na, bist du gekommen, um dich an meinem Unglück zu weiden?«
»Nein, ich bin hier, weil Sophie mich angerufen hat. Sie meinte, du könntest vielleicht etwas Trost und Beistand gebrauchen.«
»Oh, wie rücksichtsvoll«, höhnte Nadja. »Erst bricht sie mir das Herz, trampelt auf meinen Gefühlen herum, und dann ruft sie ausgerechnet dich an, damit du mich wieder aufrichtest.«
»Wenn sie dir das Herz gebrochen hat, kann ich nur sagen: Geschieht dir recht! Immerhin hattest du vor zehn Jahren keine Skrupel gehabt, deiner Tochter das Gleiche anzutun, indem du die Lügen über Julian verbreitet hast.«
Entrüstet riss Nadja den Mund auf, bereit für eine scharfe Erwiderung. Doch dann schloss sie ihn wieder und zuckte nur mit den Schultern. »Das war doch wohl etwas ganz anderes gewesen! Diese kleine Verliebtheit hätte ohnehin nicht gehalten. Sie war noch fast ein Kind!«
»Nun, so wie es aussieht, hast du dich da gründlich geirrt.« Horst ging an ihr vorbei zur Minibar. Er prüfte kurz das Angebot und entschied sich für ein helles Bier. »Allein trinken macht einsam«, sagte er dann grinsend und prostete ihr zu. Er setzte sich auf die Couch und nahm einen großen Schluck direkt aus der Flasche. Dann sagte er: »Was ist? Erzählst du mir nun, was vorgefallen ist? Sophie meinte nur, ihr hättet euch unterhalten, und sie hätte ein paar grundlegende Entscheidungen getroffen, über die du sehr verärgert seist.«
Nadja hätte es nie zugegeben, aber sie war froh, dass Horst gekommen war. Ganz allein hätte sie ihren Kummer nicht ertragen. Noch nicht mal mit Alkohol. Sie stellte den Hochprozentigen auf dem Tisch ab und nahm sich auch ein Bier aus dem Kühlschrank.
»Setz dich endlich und erzähl mir, was vorgefallen ist«, forderte Horst sie auf, als sie ihr Bier im Stehen trinken wollte.
»Also gut«, sagte Nadja und setzte sich zu ihm. »Ich war vorhin in der Behnisch-Klinik, um Sophie zu besuchen. Sie war gerade dabei, ihre Sachen einzupacken, um die Klinik zu verlassen. Julian Hentschel war bei ihr.« Nadja lachte bitter auf. »Du kannst dir sicher vorstellen, was ich mir anhören musste. Die Sache mit Julian nimmt sie mir so richtig übel. Ich sei eine skrupellose Intrigantin, hat sie gesagt.«
»Ganz unrecht hat sie damit ja wohl nicht, oder?«
»Komm schon. Es ist doch ziemlich albern, mir das ewig vorzuhalten. Es war nur eine harmlose kleine Notlüge.«
»Für die beiden ganz sicher nicht. Ach, Nadja, weißt du denn wirklich nicht, was du da angerichtet hast? Und wofür? Nur um dir deinen Traum von der großen Bühne zu erfüllen?«
»Mein Traum?«, empörte sich Nadja. »Es ging doch um Sophies Karriere! Die hiermit übrigens ganz offiziell beendet ist. Sophie hat bereits alle geplanten Auftritte abgesagt und ist von sämtlichen Verträgen zurückgetreten.« Immer noch fassungslos schüttelte Nadja den Kopf. »Sie hat keine Ahnung, welche Lawine sie damit losgetreten hat. Mal davon abgesehen, dass wir wahrscheinlich bei einigen Veranstaltern saftige Vertragsstrafen zahlen müssen, wird sie wahrscheinlich nie wieder jemand engagieren wollen.«
Die Empörung war aus Nadjas Stimme verschwunden. Sie hörte sich jetzt nur noch traurig und erschöpft an. Es fiel Horst schwer, sie nicht in seine Arme zu schließen.
»Ich glaube, dass sie das gar nicht möchte«, sagte er. »Das Leben als Violinistin hat sie nicht glücklich gemacht. Sie musste es deshalb beenden.«
»Und was ist mit mir? Hat sie dabei auch nur eine Sekunde an mich gedacht?«
»Nadja, es dreht sich nicht immer alles um dich. Hier geht es ausnahmsweise mal nur um Sophie. Hör bitte endlich auf, über das Leben deiner Tochter bestimmen zu wollen. Gönn ihr doch einfach ihr Glück mit dem Mann, den sie liebt!«
In Nadjas Augen glitzerte es verdächtig feucht. »Meinst du denn wirklich, dass ihr das auf Dauer reichen wird? Was ist, wenn er sie nur unglücklich macht?«
»So wie ich es bei dir getan habe?«
»Nein!«, rief Nadja entrüstet aus. »Du hast mich nicht unglücklich gemacht! Das habe ich ganz allein geschafft!«
»Wie bitte?«, fragte Horst verblüfft.
Nadja seufzte. »Du konntest nichts dafür, dass ich oft unzufrieden und niedergeschlagen war. Ich habe das, was ich hatte, nicht zu schätzen gewusst und nur meiner vermeintlichen Karriere als Stargeigerin nachgetrauert. Und als ich dann gesehen habe, wie talentiert Sophie war, nahm ich an, dass ich alles tun müsste, damit sie diesen Traum leben kann.«
»Es war dein Traum, nicht ihrer.«
»Das weiß ich doch längst. Mir ist das ziemlich schnell klargeworden. Aber da steckten wir schon zu tief drin in dieser Tretmühle. Außerdem hatte sich Sophie nie beschwert. Ich dachte irgendwann wirklich, dass es das ist, was sie möchte.«
»Und was möchtest du, Nadja? Was wünschst du dir von deinem Leben, jetzt, da du dich nicht mehr um das von Sophie kümmern kannst?«
»Was ich mir wirklich wünsche?«, fragte Nadja traurig. »Ich habe mir oft gewünscht, die Zeit zurückdrehen zu können. Diesmal würde ich alles anders machen. Ich würde keinen verpatzten Gelegenheiten nachtrauern oder mit meinem Schicksal hadern, sondern mich einfach über das, was ich besitze, freuen und dafür dankbar sein.«
»Und würde ich in diesem Leben auch eine Rolle spielen?«
Nadja sah ihn ernst an. »Ja, die Hauptrolle. Aber leider ist es dafür nun zu spät.«
»Wer behauptet denn so etwas?«, fragte Horst grinsend. Er gab Nadja nicht die Gelegenheit, darauf eine Antwort zu finden, sondern zog sie endlich in seine Arme, um sie zu küssen. Als sie seinen Kuss sofort erwiderte, hätte er am liebsten laut aufgejubelt. Doch im Moment hatte er dafür keine Zeit. Jetzt galt es nur, die Frau, die er ein Leben lang geliebt hatte, davon zu überzeugen, dass es immer eine zweite Chance gab und es für einen Neuanfang nie zu spät war.