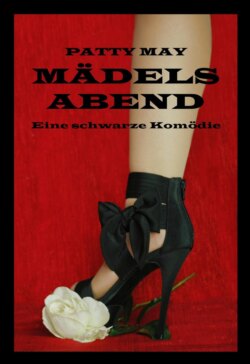Читать книгу Mädelsabend - Patty May - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеHeiß und brennend schien die Sonne herab. Die Luft stand flimmernd über dem schmalen goldfarbenen Strand. Vereinzelt wuchsen Palmen nahe der Wasserlinie, ihre langen Blattwedel wiegten sich sacht im Wind, nicht weit dahinter begann die Grenze der dicht gewachsenen Vegetation.
Eine flache Bambushütte schmiegte sich an diese Front und verschmolz in Perfektion mit den grauen Stämmen des Palmenhaines, dessen lange Schatten sich schützend über die Behausung legten. Schwere Teakholzstühle mit sandfarbenen Kissen standen einladend auf der Veranda des Hauses, die jedem Gast einen freien Blick auf das Meer erlaubte.
Lose Enden des eng verflochtenen Blätterdaches hingen weit über der Terrasse der Hütte herab und bewegten sich leise raschelnd in der steten Brise, die über die See bis zum Land hinaufzog. Etwas weiter zum Strand hinunter spannte sich eine einsame Hängematte zwischen zwei Baumstämmen.
Verträumt blickte ich auf den Ozean hinaus, glitzernde Wellen tanzten auf dem azurblauen Wasser, Gischt spritzte auf, als sie sich donnernd am vorgelagerten Riff brachen und wenig später, fast zahm, schäumend über das Ufer rollten. Sie brachten Steine und Muscheln mit, zogen sie wieder in die Tiefe zurück, um sie Sekunden später erneut auf den Strand zu werfen.
Der Klang des Meeres wirkte betörend schön.
Insekten, kleine Krabben und allerlei Getier suchten den Wassersaum gründlich nach Nahrung ab, und zwei zänkische Vögel stritten um einen besonders lohnenswerten Happen.
Alles war vollkommen.
Der Klang kräftiger Schritte ließ mich zur Hütte hinaufblicken. Sonnengebleichte Haare wehten im Wind, bronzefarbene Haut überspannte das Spiel harter Muskeln, die sich bei jeder kleinsten Bewegung an der bis auf die Shorts entblößten Statur des Mannes zeigten.
Wohlwollend sah ich zu, wie er das weiße Surfbrett unter den Arm klemmte und zum Strand hinunterschlenderte.
Jeder seiner Schritte strotze vor Kraft und Selbstbewusstsein.
Makellos wie Michelangelos David schritt der Adonis lächelnd an mir vorbei und stürzte sich in die Fluten. Sein athletischer Körper schwang sich mit der Anmut eines trainierten Sportlers aufs Brett hinauf und bezwang mühelos den Tanz der Meereswogen.
Verlockend winkte er mir zu, ich folgte der Einladung, trug mein Brett ins Wasser und legte mich bäuchlings darauf. Kraulend ließ ich mich vom Board aufs offene Meer hinaustragen, Gischt spritzte mir ins Gesicht, und meine Lippen schmeckten das Salz, Wasser strömte mein Haar herab, während ich mit Leichtigkeit durch die Wellen glitt.
Unbändiges Glück durchströmte mich, die Vorfreude, mit dem Ritt auf den Wellen den Naturgewalten zu strotzen, sich ihrer beeindruckenden Macht zu widersetzen und ihre Stärke mit der meinen zu messen.
Mutig sprang ich auf das Brett.
Plötzlich trug das Meer eigenartige Klänge mit sich, ich suchte nach dem Ursprung, als mich eine gigantische Welle erwischte.
Mit der Kraft einer riesigen Faust fegte sie mich vom Surfboard, spülte mich hinfort und zog mich hinab in die dunkle unendliche Tiefe.
Strampelnd versuchte ich zurück an die Oberfläche zu kommen. Schlug wild um mich, voll panischer Angst zu ertrinken.
Ein letztes Aufbäumen.
Mit zuckenden Gliedern und weit aufgerissenen Augen fuhr ich hoch und brauchte einen Moment, die visuellen Bilder richtig zu verarbeiten, die da auf mich einströmten.
Die Konturen eines großen Schrankes, die matte Reflektion eines Spiegels und dunkle Wände, von denen ich sofort wusste, dass diese orangerot gestrichen waren, schälten sich aus der Dunkelheit. Mein Schlafzimmer.
Schwer atmend und erschöpft sank ich in weiche Kissen zurück.
In meinen Ohren rauschte das Echo des tosenden Meeres, fast glaubte ich noch den Geschmack des Salzes auf meiner Zunge zu spüren, so real war mir diese Traumwelt erschienen.
Musik tröpfelte in mein Hirn, unpassend und an den Nerven zerrend, veranlassten mich die Misstöne mit geradezu übermenschlicher Anstrengung zu einer Reaktion. Widerwillig und immer noch arg benommen schielte ich mit einem Auge in die Richtung der vermutlichen Störquelle.
Neonfarbene Ziffern wiesen mir den richtigen Weg im Halbdunkel, unkontrolliert schlug ich mit der flachen Hand auf den Wecker ein und hoffte einfach, dabei den richtigen Knopf zu erwischen.
Endlich erstarb David Hasselhoffs Stimme und sein in grenzenloser Freude geträllertes Lied. Mann, ich bin ein ausgesprochener Morgenmuffel, ausgelassene Heiterkeit zu dieser frühen Stunde löst bei mir eher eine ausgewachsene Aggression aus. Und welcher Radiomoderator hatte es ernsthaft gewagt, diese Schnulze wieder auszugraben? Ausgerechnet „Looking For Freedom“, als wäre allein das Aufstehen nicht bereits schlimm genug!
Zufrieden mit der eintretenden Stille kuschelte ich mich zurück in meinen warmen Kokon.
Sieben Uhr dreißig.
Ich konnte mir ruhig zwei weitere Minuten in paradiesischer Abgeschiedenheit gönnen. Schließlich hatte ich noch ein Date mit dem umwerfenden blondgelockten Helden.
Angestrengt versuchte ich sein Abbild aus meinen Traum hervorzuzaubern. Die Statur seines Äußeren nachzuzeichnen, gelang mir mühelos, aber die Gesichtszüge ließen sich nicht so leicht manifestieren und blieben vor meinem geistigen Auge verschwommen. Höchst kreativ ersetzte der Verstand die fehlerhafte Retrospektive mit dem markanten Gesicht eines Schauspielers, aus der ihm zur Verfügung stehenden Datenbank meiner Erinnerungen.
Voll Sehnsucht projizierte ich mich an den Strand zurück, wo der Mann meiner Träume dem Meer entstieg, stattlich wie der göttliche Poseidon höchstselbst.
In freudiger Erwartung blickte ich ihm entgegen, wie er mit federnden Schritten auf mich zueilte, unbeirrbar und magnetisch angezogen, als wäre ich der Mittelpunkt seiner ganzen Welt. Bei mir angekommen, blieb er ruhig stehen, versenkte den Blick blauer Augen tief in den meinen, bis ich glaubte, er wolle darin all meine intimsten Gedanken lesen.
In leidenschaftlicher Hast wurde ich auf bärenstarke Arme gehoben, die mich sicher und ohne ein Zeichen der Anstrengung bis zur Hütte hinübertrugen. Ganz vorsichtig, als wäre ich zerbrechlich, legte der Hüne mich auf der weichen Lagerstatt ab, von der ich ungehindert über den Strand und das wogende Meer hinausblicken konnte.
Weit und breit waren wir die einzigen menschlichen Seelen.
Liebevoll sah ich zu, wie auch seine allerletzte Hülle fiel. Mutter Natur hatte ihn wirklich reichlich gesegnet.
Irgendetwas beunruhigte mich plötzlich, störte empfindlich die gerade entflammende Leidenschaft. Da war ein Gedanke, den ich nicht zu fassen bekam, das alarmierende und intensiver werdende Gefühl, dass etwas nicht stimmte. So, als hätte ich etwas Wichtiges vergessen.
Adrenalin schoss siedend heiß durch meinen Körper, und noch bevor ich die Augen öffnete und zur Uhr sah, war mir alles klar. Ich hatte verschlafen.
Acht Uhr dreißig zeigte die grüne Leuchtdiode an.
Mir fehlte eine ganze Stunde!
Mit einem Satz jagte ich aus dem Bett und prompt verhedderten sich die Füße in der zerwühlten Decke. Schwungvoll rutschte ich bäuchlings und mit dem Kopf voran, über die Bettkante hinaus, während meine Arme ganz von selbst den ungebremsten Sturz abfingen. Die instinktiven Reflexe bewahrten mein hübsches Gesicht vor dem sonst unvermeidlich folgenden und sicher reichlich unsanften Bodenkontakt.
Eine Handbreit Platz zwischen dem Teppich und meinem Kinn.
Aufatmend schickte ich ein Stoßgebet gen Himmel, als Dank, der drohenden Verunstaltung entgangen zu sein, denn die Leistungen eines Schönheitschirurgen in Anspruch nehmen zu müssen, passten gerade nicht ins Budget.
Etwas vorsichtiger, aber durchaus mit genügend Wut, drehte ich mich auf den Rücken, strampelte kräftig mit den Beinen und versuchte so die tuchenen Fesseln von den Knöcheln zu streifen.
Mit einem Ruck kam ich schließlich frei und spurtete ins Bad.
Die eiskalte Dusche sorgte für den nächsten Schock.
Meine Dachwohnung lag im vierten Stock eines altehrwürdigen Backsteingebäudes, die bald nach dem Krieg eiligst hochgezogen und seit Mitte der Siebziger weder nennenswert saniert noch modernisiert worden waren, dafür aber erschwingliche Mieten boten.
Ersatzweise musste man die Buden nicht lüften, ich nenne das meine vollautomatische Umwälzung. Ein stetiger leichter Luftzug durchzog den Aufgang, drang durch kleinste Ritzen der verschlossenen Haustür in die Wohnung ein und zog über den Flur an meinem Küchenfenster wieder hinaus.
Schätzungsweise müsste ich mir niemals Sorgen über ein Gasleck machen.
Die Leitungen ächzten und schnauften, sobald ich den Duschkopf aufdrehte, und es dauert eben, bis das Heißwasser aus der Kelleranlage hier oben ankam. Aber es fehlte mir an der nötigen Zeit, und bibbernd ertrug ich die eisige Folter.
Dafür war ich innerhalb von zwei Minuten fertig.
Eine weitere Minute ging fürs Zähneputzen drauf, dann raste ich atemlos zurück ins Schlafzimmer. Auf meinem Weg zum Schrank erwischte ich tragischerweise den eisernen Eckpfosten meines Bettgestells.
Rasend glühend heißer Schmerz durchfuhr den kleinsten Zeh, und jaulend vollführte ich einige sehr gewagte einbeinige Sprünge zwecks Leidminderung. Es half.
Für Sekundenbruchteile durchströmte mich pure Glückseligkeit, nur weil die Qual ein wenig nachließ. Behutsam testete ich den Gebrauch der Gliedmaßen, der Zeh bewegte sich kein Stück, schien aber keineswegs gebrochen.
Hoffentlich kam ich heute Abend in meine Pumps.
Rachedurstig schielte ich meine bis dato geliebte Schlafstatt an. Dieses verdammte Bett konnte von Glück reden, dass ich keine Eisensäge hatte, um daraus Kleinholz zu machen. Ich verzichtete ausnahmsweise darauf, mit meinem anderen, noch heilen Fuß dagegenzutreten.
Übel gelaunt zog ich mich an und stellte mir ganz theoretisch die Frage, was an diesem Scheißmorgen eigentlich noch alles schiefgehen könnte?
Umgehend erhielt ich Antwort, als mein Blick in den Kleiderschrank fiel.
Kein Uniformhemd in Sicht!
Erfolglos durchforstete ich die Bügel. Jeder Angestellte des Geschäftes besaß sechs Garnituren, drei Sommerblusen, drei Winterpullover, und war verpflichtet worden, die einheitliche Dienstkleidung bei der Arbeit zu tragen. Tja, und wie es aussah, waren die meinen im Wäschesack.
Schon seit mehreren Abenden wollte ich die Klamotten reinigen, erfand aber stets neue sehr gute Gründe, nicht runter in den gruseligen Waschraum zu müssen. Unseren Gemeinschaftskeller mied ich wie die Pest.
Unter dem Haus zog sich ein gesamtes Labyrinth an schummrigen Gängen und finsteren Zellen entlang.
Es roch modrig, wie der Tod.
Selbst wenn ich alle Lichter anknipste, fühlte ich mich keinen Deut sicherer. Da unten hatte ich eine Höllenangst, und jedes kleinste Geräusch genügte, damit ich alles fallen ließ und sofort die Flucht ergriff.
Vor kurzem hatte ich mir sogar eine Pistole zugelegt, einzig zur Abschreckung des im Untergrund lauernden Horrors.
Die Knarre hatte ich am Bahnhof gekauft, kostete mich zehn Euro, und wenn ich sie nicht gerade zur Dämonenabwehr benutzte, konnte man mit dem Ding die Kerzen anzünden oder unliebsame Rechnungen verbrennen.
Natürlich weiß ich, wie lächerlich sich das alles anhört, und trotzdem wurde dieser Keller zu meinem ganz persönlichen Gomorrha.
Aber wen interessierte schon, wovor ich mich fürchtete? Ohne Montur brauchte ich meinem Chef erst gar nicht unter die Augen zu treten.
Beherzt wühlte ich in der Dreckwäsche und zerrte die Uniformblusen hervor. Die waren alle ziemlich zerknittert, doch erst die Geruchsprobe zerschmetterte meine Hoffnungen auf erneute Tragbarkeit endgültig.
Einfach eklig!
Blieb nur der Pullover. Fieberhaft kramte ich ihn zwischen den Wintersachen heraus und zog mir die dicke Baumwolle über den Kopf.
Wie, um mich zu verspotten, drang ein gleißend heller Sonnenstrahl durchs Fenster. Die dünne Wolkendecke löste sich allmählich auf.
Gestern lagen die Temperaturen weit über zwanzig Grad und das erste Mal, seit ich in Hamburg lebte, wünschte ich mir inständig Regen. Der Blick zum klaren azurblauen Himmel genügte, um einen derben Fluch über die Lippen zu bringen. Dabei regnet‘s immer in Hamburg, gefühlt dreihundert Tage im Jahr, sodass ich manchmal befürchtete, mir müssten eigentlich Schwimmhäute und Kiemen wachsen.
Der Pulloverbund kratzte am Hals, und ich spürte unangenehm die aufsteigende Hitze. Deprimiert setzte ich mich für einen Augenblick auf die Bettkante und überdachte meine Lage.
Das würde heute nicht mein Tag werden! Soviel war klar!
Erstmalig überlegte ich ernsthaft, zu Hause zu bleiben und mich krank zu melden. Mmh, war auch ne blöde Idee.
Zum Arzt konnte ich nicht, und ohne Krankenschein riskierte ich eine Abmahnung, die mir mein Chef sicher umgehend und mit größtem Vergnügen ausstellen würde.
Zumindest brauchte ich mich nun nicht länger abzuhetzen, der Wecker stand auf Neun, und ich würde es nie rechtzeitig zur Geschäftsöffnung schaffen.
Humpelt kehrte ich ins Bad zurück, stopfte Bürste und Schminkutensilien in meine Handtasche und suchte nach einem Parfüm gegen die Ausdünstungen des Winterpullis.
LancÔme und Joop waren mir dafür zu schade, aber ganz hinten fiel mir ein schwarzer Flakon in die Hände. „Black Opium“ stand drauf.
Wenn ich mich recht entsinne, war das ein Geschenk von Oliver und daher mindestens zwei Jahre alt. So heiß die Affäre damals mit Olli begann, so schnell kühlte sie wieder ab. Schade drum, der Typ war echt süß gewesen.
Er arbeitete im Containerhafen in Schicht, und dass wir uns zufällig auf der Faschingsparty im LiLaBe kennenlernten, lag eindeutig an seinem Matrosenkostüm. Weiße enge Hose, Mütze und Schuh - sonst nichts.
Heiß und unwiderstehlich anziehend.
Bald stellte ich fest, der Olli war mit seinen Kumpels verheiratet, und ich wollte nicht teilen.
Der Stöpsel ließ sich nur schwer aus dem Flakon ziehen, ich schnüffelte daran und verzog angewidert das Gesicht. Mann, der Moschusochse musste schon zu seinen Lebzeiten überlagert gewesen sein.
Black Opium wanderte in die Hosentasche.
Den pochenden Zeh ignorierend, schlüpfte ich in die Turnschuhe und eilte in olympiaverdächtigem Rekord erst die vier Stockwerke und dann in den Keller hinab. Mein Fahrrad stand gleich um die Ecke, ich schleifte es rückwärts am Lenker und ohne Rücksicht auf Wände und Türen zu nehmen, die Kellertreppe hinauf. Immer den Blick fest und aufmerksam in die finsteren Gänge gerichtet.
Draußen schwang ich mich auf den Sattel und trat kräftig zu. Es knallte heftig, als die rostige Kette riss, und meine Füße strampelten erfolglos in den Pedalen. Da bekam ich meinen ersten Wutausbruch an diesem Morgen. Fuchsteufelswild schmiss ich den Drahtesel zu Boden, hob ihn wieder auf, nur um das Rad erneut auf den Asphalt zu knallen, und ließ meinem Ärger freien Lauf. Zorniges Füße Stampfen mit Gebrüll kann befreiend sein oder einfach nur dämlich. Nach einer Weile entschied ich mich für Letzteres und schaute besorgt in alle Richtungen.
Doch wer immer diese peinlichen Szenen beobachtet hatte, ließ sich nichts anmerken. Das war ein Vorteil der Großstadt und auch dem Gemüt der Hamburger zu verdanken. Ich hätte mich auch nackt auf die Straße stellen können, es hätte sich niemand daran gestört, solange ich keinem Autofahrer direkt im Weg stand.
Hier konnte jeder tun und lassen, was er wollte, auch einen Winterpullover im Hochsommer tragen und mit 'nem Pistolenfeuerzeug Gespenster jagen.
Das Rad musste zurück ins Kellerloch.
Am Ende des Ganges quietschte eine Tür, ich stieß mein Eigentum gegen die nächste Wand, wo es scheppernd zu Boden rutschte und flitzte schaudernd die Treppe hoch. Irgendwer würde das Ding schon aufheben.
Missmutig marschierte ich zur nächsten Haltestelle und bestieg den Bus nach Bramfeld. Nach zehnminütiger und ereignisloser Fahrt besserte sich langsam meine Laune.
Am Abend war ich mit den Mädels verabredet. Den Neunstundentag bis dahin würde ich auch noch überstehen, genauso wie das Gezeter meines Chefs.
Aber zuerst musste ich mich für den bevorstehenden Kampf wappnen.
Der Bus hielt, und ich stieg kurz entschlossen eine Station früher aus. Schließlich kam ich sowieso viel zu spät, ein paar Minuten mehr machten da auch nichts mehr aus.
Es gab Wichtigeres! Ich brauchte dringend Koffein.
Jetzt, in diesem Moment, wünschte ich nichts sehnlicher, als einen dampfenden Becher in meinen Händen zu halten.
Das Frühstück kann ich getrost weglassen, aber ohne Kaffee komme ich nicht auf Touren, bin mehr ein Zombie während der ersten halben Stunde, Mutant, doch nach zwei Tassen bin ich fähig zu sprechen, und mein Gehirn beginnt effektiv zu arbeiten.
Bis zur Arbeitsstelle waren es kaum mehr als dreihundert Meter, und auf dem Weg dorthin entdeckte ich gleich zwei Läden in der Straße.
Vor dem Bäcker stand eine lange Schlange, also steuerte ich den gegenüberliegenden Starbucks an, der im Unterschoss eines großen Versicherungsunternehmens lag.
Netter Laden, total angesagt, hippe Einrichtung, wohlsituierte Leute.
Männer in Armani-Anzügen und Frauen in hanseatisch blauen Kostümen saßen an den Tischen oder standen am Tresen, vertieft in sicher sehr wichtigen Gesprächen, und ich mit meinem Uniformpulli.
Vor mir zwei Warteschlangen, ich nahm die kürzere, nur vier Leute.
Es zog sich hin, ungeduldig trommelte meine Fußspitze auf dem Boden.
Als ich endlich an der Reihe war, befanden sich Hirn und Körper mangels Koffein bereits im Zombiemodus. Fragende Augenpaare schauten mich an, der Starbucks-Willkommensgruß zusammen mit der Frage nach meinen Wünschen wurde freundlich und nun etwas lauter wiederholt.
„Äh, einen Kaffee.“
Mit weit ausholender Geste wurde mir das Angebot auf der Wandtafel präsentiert, und als moderiere die junge Bistromaus gerade eine Fernsehverkaufsshow, begann sie mit honigsüßer Stimme vorzulesen: „Wir haben da einen Coffee Americano, Chocolate Mocha, Cappuccino, Kakao Cappuccino, Caramel Macchiato, Espresso, Espresso Con Panna, Flavored Latte, Coffee Frapuccino...“
Mein Hirn versuchte die Informationsfülle zu verarbeiten.
„Latte“, hörte ich mich sagen. Es war das Letzte, was ich bewusst wahrgenommen hatte. Nun egal. Hauptsache Koffein.
„Was für ein Latte darf's denn sein?“
„Äh, ich nehm‘ doch nur einen Kaffee!“
Zum ersten Mal flackerte Unsicherheit in ihren Augen, die Lippen wurden noch etwas mehr in Richtung Ohren gezogen, und zwei perfekte weiße Zahnreihen blitzen mich an. Mann, wie viel Koffein mussten die erst morgens einwerfen, um solch gute Laune zu verspritzen?
Vielleicht habe ich es vergessen zu erwähnen, ich bin allgemein ein fröhlicher Mensch, aber ich hasse Leute, die vor meiner ersten Tasse Witze reißen, gar lustig drauf sind oder so grinsen, wie die da eben vor mir.
„Einen Coffee Americano vielleicht?“
„Ja!“, beeilte ich mich zu bekunden, bevor die Aufzählung von neuem begann. „Mit Milch!“
„Mit normaler Milch oder laktosefrei? Extra aufgeschäumt?“
Wollte die mich auf den Arm nehmen?
Tatsächlich hörte ich mich wütend knurren.
Mutantenmodus.
Ihr Lächeln versteinerte vollends zur Maske, während das nervöse Augenblinzeln ihr einen fast irren Ausdruck verlieh. Mit Mühe versuchte ich den beginnenden hysterischen Anfall zu vermeiden, ich sah buchstäblich rot!
Stattdessen schloss ich die Augen, atmete tief durch und stellte mir vor, wie ich Alices Grinsekatze über den Tresen zog und ihr den Kopf einschlug.
Rein theoretisch versteht sich.
„Einen Kaffee, schwarz. BITTE!“
„Ah, einen Filterkaffee?“, kam es unsicher aus dem Grinsemund.
Endlich kamen wir der Sache näher!
„Zum Hiertrinken oder Mitnehmen?“
„Pappbecher!“, knirschte ich zwischen den Zähnen.
„Also zum Mitnehmen!“
Nein, du dumme Kuh! Ich trinke immer aus Pappbechern, manchmal auch aus Tüten! nickte ich stumm, und mein Zombie stellte sich vor, welche Körperteile man zuerst abreißen sollte, damit das Opfer möglichst lange leidet.
„Small, tall oder ...?”
„GROSS! Big, big, groß und...schnell!”
Hektisches Tippen auf der Kasse, ich zahlte den Preis und erhielt endlich.... Einen Zettel?
Überaus freundlich erklärte sie mir, dass ich an der zweiten Schlange meine Bestellung mit eben jener Zettelnummer bekäme, ganz frisch versteht sich.
Sieben Leute vor mir!
In diesem Moment begriff ich, warum in Europa nicht einfach jeder eine Waffe tragen durfte, denn glaubt mir, das war ein Augenblick, in dem ich sie ohne Zögern benutzt hätte.
Schwer atmend gab ich mich für eine Millisekunde dem Anblick hin, stellte mir vor, wie Blut und Hirn gegen die schöne grün getünchte Starbuckstafel spritzte, sich die weiße Bluse der Grinsekatze rot färbte, drehte mich auf dem Absatz um und floh zur gegenüberliegenden Bäckerei, ohne auf den vorbeifahrenden Verkehr und wütend hupende Autofahrer zu achten.
Ich brauchte sofort Koffein, bevor es Mord und Totschlag gab.
Flugs auf der Türschwelle stoppte mich die Verstrebung eines Rollators, im Schlepptau eine kleine grauhaarige Dame, während mir schmerzhaft über meinen ohnehin bereits lädierten Zeh gefahren wurde.
„Na, na, na! Nun mal langsam junge Dame!“
Tadelnd wackelte der Kopf auf dem viel zu kurzen Hals, und das Gespann zuckelte langsam in den Laden.
Der erlittene Schmerz ließ meine Wut verrauchen, und ergeben stellte ich mich hinten an. Ich traute mich nicht, nochmal an ihr vorbeizuhuschen.
Eine vor mir! Was macht das schon?
Das Gefährt wurde in zäher Langsamkeit am Schaukasten entlanggerollt, dabei die Auslage eingehend inspiziert und schließlich in Position geschoben, um sich auf den schmalen Sitz zu quetschen.
Letzteres alarmierte mich, es sah aus, als würde sich die Dame häuslich niederlassen, zumindest würde die Bestellung wohl länger dauern, wenn sie es sich dazu erst bequem machen musste.
„Guten Morgen, Fräulein! Sind die Brötchen denn auch frisch?
Also das gestern war ja knüppelhart, ich wollt‘s Ihnen ja erst wiederbringen, aber dann hab ich es doch im Kaffee eingeweicht, wissen Sie!“
Ich schielte zu Starbucks hinüber.
Noch fünf in der zweiten Schlange!
Ihr Kopf wippte hin und her, als wäre er nur lose auf die Schultern gesetzt und könnte jederzeit hinunterkullern.
„Ist denn da Zucker auf der Streuselschnecke? Ja? Oh, ich vertrag das ja nich mehr, ne! Hab Alterszucker! Also früher hätt‘s sowas nich gegeben! Ich sag Ihnen, meine Mutter, Gott hab sie selig, also meine Mutter hatte...“
„Tschuldigung! Ich wollt wirklich nur schnell einen Kaffee!“
„Also wirklich! Diese Jugend von heute! Keine Zeit!“, schnauzte das Mütterlein.
Missbilligend musterte mich die Bäckersfrau.
Ein Blick zu Starbucks. Nur noch ein Mann an Kasse zwei.
„Erst eine alte arme Frau fast umschubsen und dann drängeln. Mir hätte sonst was passieren können! Wer kümmert sich dann um meine Kinder?“
Irritiert schaute ich sie an. Wie alt konnten ihre Kinder denn sein?
„Meine fünf Katzen? Sie vielleicht? Wie kann man nur so herzlos sein?“
Vorwurfsvolles und entsetztes Kopfschütteln der Bäckersfrau, gleichbleibendes Kopfwippen der gemeinen alten Hexe.
Die Grinsekatze von gegenüber und die fünf Katzen der Alten, ich sah da plötzlich einen kosmischen Zusammenhang.
Mein rechtes Augenlid begann unkontrolliert zu zucken.
„Hab ja nur ne kleine Rente, das Leben lang geschuftet, und was bleibt nachher übrig? Trocken Brot und Wasser, dafür reicht's grad mal.“
Das Zischen austretendes Dampfes schweißte mich am Boden fest, ich konnte ihn riechen, diesen unverkennbaren verlockenden Duft des frisch Aufgebrühten, sah die samtige tiefdunkle Farbe durch die Glaskanne schimmern, und fast wäre mir Sabber von den Lippen getropft.
„Aber jetzt gönn ich mir mal was, muss man doch auch mal! Nicht wahr? Ja, ein Stück von der Erdbeersahnetorte. Ja, mit Schlag und einen Kaffee. Sehr nett! Ja, danke.“
Wippelte den Kopf, ließ den Rollator einfach stehen und schlurfte zum Ecktisch hinüber. Hilfsbereit schaffte die Verkäuferin Torte, Tasse, Besteck und Serviette zum Platz. Natürlich!
Wackeldackel! Alter Wackeldackel! knurrte mein Zombie.
Ganz offensichtlich konnte mich die Bäckersfrau nicht leiden, sie ließ sich viel Zeit, bis meine Bestellung entgegengenommen wurde.
„Ein Käsesandwich und einen Kaffee bitte! Einfach Kaffee, mit Milch, egal welche! Heiß, groß, zum Mitnehmen, gleich!“
Ich wollte Fehler und vor allen Dingen Nachfragen vermeiden, die solche Sachen unnötig verkomplizierten.
Das Sandwich wurde lieblos eingewickelt und auf den Tresen geknallt, das Gleiche passierte mit dem Becher, dessen Inhalt daraufhin überschwappte.
War mir egal, ich hatte nur Augen für meinen gigantischen Kaffee und trank, noch bevor ich mein Geld zückte, einen großen Schluck, verbrannte mir dabei die Zunge und nahm trotzdem einen zweiten, fühlte meine Lebensgeister und mich endlich wieder als Mensch.
Zufrieden legte ich einen Schein auf den Tisch, doch als sie ausgerechnet sechs Euro sechsundsechzig von mir verlangte, bekam ich es mit der Angst zu tun. Schien ihr Gesicht sich nicht ein ganz klein wenig in eine teuflisch grinsende Fratze zu verwandeln?
Ganz sicher! Der Kaffee war vergiftet.