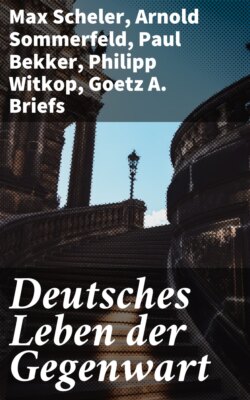Читать книгу Deutsches Leben der Gegenwart - Paul Bekker - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE LYRIK
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Die epische Dichtung hat bestimmte Lebensformen, die dramatische bestimmte Weltanschauungsformen zum Unter- und Hintergrund. Der epische Dichter kann die Lebensformen nicht selber schaffen — sie sind die Voraussetzung seiner Kunst —, der dramatische kann die Weltanschauungsformen höchstens mitschaffen, aus den gesamten ideellen Mächten seiner Zeit heraus. Die Form der lyrischen Dichtung ist die Form der Persönlichkeit. Der Lyriker ist unabhängig in seinem Schöpferwillen, alles wird ihm Stoff zu sich selber, Welt und Leben kristallisieren in seinem Ich. So kann in einer zersetzten Zeit, im Kampf der Lebens- und Weltanschauungen der Lyriker zuerst zur reinen Form gelangen, als der Vorposten der neuen Menschheit. Und dieses Ringen um den neuen Menschen, um das Bürgerrecht einer neuen Menschheit stellt die deutsche Lyrik der letzten Jahrzehnte dar.
1885 erschienen die "Modernen Dichtercharaktere", eingeführt von den Aufsätzen Hermann Conradis (1862-1890) "Unser Credo" und Karl Henckells (geb. 1864) "Die neue Lyrik". Die Gedichtsammlung war die Absage an die Epigonenlyrik Geibels und Heyses, an die "losen, leichtsinnigen Schelmenlieder und unwahren Spielmannsweisen" Rudolf Baumbachs und Julius Wolffs. Diese jungen Lyriker wollten "Hüter und Heger, Führer und Tröster, Pfadfinder und Wegeleiter, Ärzte und Priester der Menschen" werden. Hermann Conradi gibt 1887 in den "Liedern eines Sünders" sein lyrisches Bild. Er war der Innerlichste unter den Jüngeren, der Gärende, haltlos Ringende. Er fühlte sich berufen, "die Gegensätze der Zeit in ihrer ganzen tragischen Wucht und Fülle, in ihren herbsten Äußerungsmitteln zu empfinden" und "voll Inbrunst und Hingebung die verschiedenen Stufen und Grade des Sichabfindens mit dem ungeheueren Wirrwarr der Zeit schöpferisch zum Ausdruck zu bringen". Übergang und Untergang sah er ringsum, sich selbst empfand und gestaltete er in seinen Romanen "Phrasen" und "Adam Mensch" als den Typus des Übergangsmenschen, in den eigenen Krämpfen spürte er die Krämpfe der Zeit, deren Krisis er 1889 in "Wilhelm II. und die junge Generation" ahnend kündete: "Die Zukunft, vielleicht schon die nächste Zukunft: sie wird uns mit Kriegen und Revolutionen überschütten. Und dann? Wir wissen nur: die Intelligenz wird um die Kultur, und die Armut, das Elend, sie werden um den Besitz ringen. Und dann? Wir wissen es nicht. Vielleicht brechen dann die Tage herein, wo das alte, eingeborene germanische Kulturideal sich zu erfüllen beginnt. Vorher jedoch wird diese Generation der Übergangsmenschen, der Statistiker und Objektssklaven, der Nüchterlinge und Intelligenzplebejer, der Suchenden und Ratlosen, der Verirrten und Verkommenen, der Unzufriedenen und Unglücklichen — vorher wird sie mit ihrem roten Blute die Schlachtfelder der Zukunft gedüngt haben — und unser junger Kaiser hat sie in den Tod geführt. Eines ist gewiß: sie werden uns zu Häupten ziehen in die geheimnisvollen Zonen dieser Zukunft hinein: die Hohenzollern. Ob dann eine neue Zeit ihrer noch bedürfen wird? Das wissen wir abermals nicht." Conradis Leben und Lyrik ist nie zur persönlichen Form gedrungen. So tief er darum rang, die gärenden, brodelnden Elemente seines Wesens zur Einheit zu binden: "Und ob die Sehnsucht mir die Brust zerbrennt: — Auf irrer Spur — Läßt mich die Stunde nur — Am einzelnen verbluten."
Karl Henckell, der zweite Herausgeber der "Modernen Dichtercharaktere", verlor sich vorläufig in die Stofflichkeiten des Naturalismus und Sozialismus. Er sang "Das Lied des Steinklopfers", "Das Lied vom Arbeiter", "Das Lied der Armen", besang "Das Blumenmädchen", "Die Engelmacherin", "Die Näherin im Erker", "Die Dirne", "Die kranke Proletarierin". Er zeichnete billige satirische Gegenbilder im "Korpsbursch" im "Einjährig-Freiwilligen Bopf", im "Leutnant Pump von Pumpsack" im "Polizeikommissar Fürchtegott Heinerich Unerbittlich". Er feierte "das ideale Proletariat": "Heil dir Retterheld der Erde — Siegfried Proletariat — leuchtend in der Kraft des Schönen." Er empfand sich als die "Nachtigall am Zukunftsmeer". Durch die jugendliche Rhetorik und stoffliche Befangenheit brach die — sozialistisch gefärbte — Überzeugung einer Zeitenwende, eines nahen Zusammenbruchs, einer neuen Zukunft.
Ärger noch in diese Stofflichkeit, in die nächsten Bilder und Phrasen der Zeit verstrickt blieb Arno Holz (geb. 1863) in seinem "Buch der Zeit", "Lieder eines Modernen" (1885). Er glaubte sich schöpferisch, wenn er die Großstadt, das Großstadtelend, den Großstadtmorgen, den Großstadtfrühling in wässerig strömende Reime und Strophen zwang. Der "geheime Leierkasten", den er später aus jeder Strophe zu hören glaubte, klingt überlaut aus diesen jugendlichen Versifizierungen. Und es ist persönlich begreiflich, daß er 1899 schließlich in seiner "Revolution der Lyrik" Reim, Strophe und festen Rhythmus grundsätzlich verwarf und eine Lyrik proklamierte, "die auf jede Musik durch Worte als Selbstzweck verzichtet, und die, rein formal, lediglich durch einen Rhythmus getragen wird, der nur durch d a s lebt, was durch ihn zum Ausbruch ringt". Im "Phantasmus" schuf er dementsprechende, eindringliche, duft- und farbenreiche Stimmungsbilder und -bildchen.
In Julius Hart, Bruno Wille, John Henri Mackay, dem Schüler Stirners, und Ludwig Scharf ergänzte und steigerte sich die soziale Lyrik. Richard Dehmel (1863-1920) vertiefte und beseelte sie. Er war der Freund Detlev von Liliencrons (1844-1909), des "Blutlebendigen, Lebensbeglückten", Erdursprünglichen, der zwar durch den "Naturalismus" erst ganz zu sich selbst befreit wurde, aber stets reine, sinnenhafte Natur war und blieb, dem Kampf der neuen Ideen fremd, ein voller Ausklang der alten lyrischen Linie, der Droste, Kellers, Storms. Liliencron kam der Entwicklung von Dehmels sinnlicher Anschauung zur Hilfe, wie Uhland einst dem jungen Hebbel. Dehmel zerbrach die Kunstanschauung des "Naturalismus": Nie ahmt der Künstler die Natur nach. "Weder die sogenannte äußere Natur, die Welt der Dinge, noch auch die innere, die Welt der Gefühle, will oder kann er zum zweitenmal, zum immer wieder zweitenmal, in die bestehende Welt setzen, in diese Welt der Wirklichkeiten. Er will überhaupt nicht nachahmen; er will schaffen, immer wieder zum erstenmal. Er will einen Zuwachs an Vorstellungen schaffen, Verknüpfungen von Gefühlen und Dingen, die vorher auseinander lagen, in der werdenden Welt unserer Einbildungen." Aus "chaotischen Lebenseindrücken" will er einen "planvollen Kosmos" schaffen, "nicht Abbilder des natürlichen, sondern Vorbilder menschlichen Daseins und Wirkens," "überschauende Zeit-, Welt- und Lebenssinnbilder". So wird in Richard Dehmel zuerst der moderne Lyriker sich seiner Aufgabe bewußt, der sinkenden, zersetzenden Zeit neue Formen zu erobern, in der Form seiner Persönlichkeit und in heiliger Wirkung und Wechselwirkung, in immer weiteren Ringen über sie hinaus: "Alle Kunstwirkung läuft schließlich auf das Wunder der Liebe hinaus, das sich begrifflich nur umschreiben läßt als Ausgleichung des Widerspruchs zwischen Ichgefühl und Allgefühl, Selbstbewußtsein und Selbstvergessenheit." Den Weg vom Ichgefühl, einem neuen, starken Ichgefühl, zu neu bewußten und vertieften Allgefühl sucht Dehmels Leben und Lyrik. Vom sozialen Gefühl der Zeit geht er aus. "Wie kann der geistige Mensch zur Herrschaft kommen, wenn er umgeben bleibt von Menschen, die nicht einmal der Pflege des Körpers freie Zeit genug widmen können! Kann denn das geistige Dasein sich steigern, wenn jedermanns Sinne voll geistiger Unlust sind? Und kann der Geist des einzelnen wachsen, wenn kein geneinsamer Boden sich bildet, der seine Seele zum Wachstum anreizt?" Aus dieser leidenden Bruderliebe, aus diesem Wissen um das Verbundensein alles Volkslebens wachsen seine sozialen Gedichte "Zu eng", "Vierter Klasse", "Der Märtyrer", "Jesus der Künstler", "Bergpsalm":
Dort pulst im Dunst der Weltstadt zitternd Herz!
Es grollt ein Schrei von Millionen Zungen
Nach Glück und Frieden: Wurm, was will dein Schmerz!
Nicht sickert einsam mehr von Brust zu Brüsten
Wie einst die Sehnsucht, nur als stiller Quell;
Hier stöhnt ein Volk nach Klarheit, wild und grell,
Und du schwelgst noch in Wehmutslüsten?
Die beiden klassischen sozialen Lieder formen sich: "Erntefeld" ("Es steht ein goldnes Garbenfeld") und "Der Arbeitsmann" ("Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind"). Über die Lebens- und Liebeseinheit des eigenen Volkes, durch die es "dem hunderttausendfachen Bann" der Lebensnot und -niedrigkeit entwächst, drängt Dehmels Traum und Leidenschaft zur Menschheitsstunde: "Bis auch die Völker sich befrei'n — Zum Volk! — m e i n Volk, wann wirst du sein?" Und über die Menschheit hinaus stürmt sein Lebenswille ins Weltall: "Wir Welt!" Das ist das letzte Ziel, die Durchdringung von Eins und All. Den Weg führt uns die Liebe: "Wer so ruht an einem Menschenherzen — Ruht am Herzen dieser ganzen Welt."
Dieses Mysterium kündet der "Roman in Romanzen: Zwei Menschen" dreimal 36 Gedichte und drei Vorsprüche zu je zwölf Zeilen, die zusammen wieder 36 Zeilen ergeben. Alle Gedichte haben den gleichen Aufbau: eine Naturschilderung als Einleitung, die Worte des Mannes, die Worte der Frau, ein paar Schlußzeiten, die in neuer Einheit die Seelenstimmung zusammenfassen. Diese Strenge der Gliederung schafft architektonische Schönheit, aber hemmt und verbaut auch. Es kommt weder zur reinen epischen Erzählung noch zum reinen lyrischen Ausströmen. Überhaupt bleiben die epischen Elemente, die eigentliche Handlung, die Fülle der Schauplätze, bedenklich stofflich. Hinreißend ist der ekstatische Überschwung der Grundstimmung, der zwei Menschen aus ihrer Einzelhaft, durch die Liebe, zur Verbundenheit mit der Natur, der Menschheit, dem Weltall, zum "Weltglück" führt, bis selbst der Tod sie nicht mehr schreckt:
Wir sind so innig eins mit aller Welt,
Daß wir im Tod nur neues Leben finden.
So wächst Dehmels Ich-Bewußtsein in immer weiteren Kreisen zum Weltbewußtsein, nicht nur im Gefühlsrausch des Lyrikers, sondern im menschheitlichen Vorkampf. Die Harmonien zwischen Mann und Weib offenbaren sich ihm nur darum so machtvoll, weil er abgründige Disharmonien durchlitten und durchschritten hat. Seelische Helle wächst aus sinnlichem Dunkel. "Die Verwandlungen der Venus" zeichnen — stofflich überlastet — diesen Weg der Läuterung: "Aus dumpfer Sucht zur lichten Glut."
Alle Menschheitsbeziehungen werden in ihrem Doppelspiel von Haß und Liebe, von Selbstbehauptung und Hingabe neu zur Frage gestellt. Wie Mann und Weib sich gegenüberstehen, so Vater und Sohn. Im Kampf der Generationen, der alten und jungen Weltanschauung ruft er als Vater — als erster Vater! — seinem Sohne zu:
Sei du! Sei du!
Und wenn dereinst von Sohnespflicht,
Mein Sohn, dein alter Vater spricht,
Gehorch' ihm nicht! Gehorch' ihm nicht!
Als der Weltkrieg ausbrach, da war es Dehmel, dessen tapferer Lebensglaube stets gewesen, durch die Zeit hindurch zur neuen Zeit und Form sich vorzuringen, Pflicht und Bedürfnis, als einundfünfzigjähriger, ungedienter, gemeiner Soldat in das Heer zu treten und den Entscheidungskampf der neuen Menschheit mitzufechten: "Die Begleitumstände sind allerdings scheußlich, aber das Hauptziel des Kampfes ist herrlich und heilig; denn wir wollen den Frieden auf Erden schaffen, a l l e n Menschen zum Wohlgefallen... Etwas mehr Himmelsluft wird sich doch nach diesem reinigenden Sturm ausbreiten, bei uns selbst wie im ganzen Völkerverkehr. Und was war der Hauptgrund, warum ich alternder Mann zur Waffe griff, nicht bloß aus Vaterlandsliebe und Abenteurerlust; da mein Körper noch kräftig genug dazu ist, muß ich ihn einsetzen für die geistige Zukunft." Als Soldat der neuen Menschheit ist er gestorben, an einer Venenentzündung, die er sich im Kriege zugezogen.
Das Kämpferpathos Dehmels, das anfangs dem jungen Schiller nah ist, bevorzugt die charakteristische vor der musikalischen Form. Jeder Glätte in Bild, Rhythmus und Strophe setzt er herbe Eigenheiten entgegen. Der vierzeiligen Strophe gibt er eine fünfte Zeile mit, ohne Reim, von besonderem Rhythmus. Bild und Versform wirken oft geschmiedet und gehämmert. Auch seine "impressionistischen" Naturbilder sind keine nachgiebige Eindruckskunst, sind Umwandlung üblicher, erstarrter Anschauungen in charakteristische, von innen bewegte Bilder.
In der Herbheit der inneren und äußeren Form ist ihm Paul Zech (geb. 1881) verwandt. Soziales Ethos erfüllt und durchbebt sein bäuerisch-westfälisches Blut. Einige seiner Väter schürften Kohle. Er selber hat nach Vollendung seiner Studien in tiefster sozialer Verbundenheit nicht nur als Dichter, sondern zwei Jahre auch als Mensch, als Arbeiter, am Leben der Bergleute teilgenommen in Bottrop, Radbod, Mons und Lens. In den Vers- und Novellenbüchern "Das schwarze Revier", "Die eiserne Brücke", "Der schwarze Baal" zieht sein Ethos die Machthaber, die Harthörigen und Verblendeten vor Gericht, Güte und Menschlichkeit für alle zu fordern. Die Stoffwelt des jungen Naturalismus kehrt wieder: Fabriken, Zechen, Sortiermädchen, Fräser, aber durchseelt von einem Ethos und Pathos, das aus religiösen Tiefen, aus Christi Herzen steigt und zur "Neuen Bergpredigt" berufen ist. Dieser religiösen Menschheitsverbundenheit mußte der Weltkrieg, Welthaß und -gemetzel, die Zech als ungedienter gemeiner Soldat in den furchtbaren Kämpfen (Verdun und Somme) miterlebte, zum apokalyptischen Grauen, zur Sünde wider den Heiligen Geist werden. Von den tausend Kriegslyrikern hat Zech allein von Anfang an den Krieg in seiner metaphysischen Bedeutung erlebt und gestaltet. Seine Gedichtbücher "Golgatha" und "Das Terzett der Sterne" reißen den Krieg aus den historisch-politischen Verknüpfungen vor das Angesicht Gottes.
Ewig sind wir Kain. Unser Dasein heißt: vernichten!
Käme tausendmal noch Christi Wiederkehr:
Immer ständen Henker da, ihn hinzurichten.
Fluch der Welt ist, daß uns Abel kindlos starb.
"Zweitausend Jahre noch nach Golgatha — Göttliche Jugend blutig auf der Bahre!" "Und immer neue Mütter stießen ihre Knaben — In immer helleren Scharen in das Feld — Als wär vernarrt die ganze Welt — Den Mord hinfort als Hausaltar zu habe? — ...Daß du, Gekreuzigter, nicht von dem Holz — Herabsprangst und mit Geißeln auf die Menge hiebst — Und klein zurück auf ihren Ursprung triebst." "Seit jenen Tagen braust durch das verführte — Geschlecht ein schriller Ton — Wie ihn schon einmal ausstieß der verlorene Sohn." Aber den wilden Lärm der Schlachten überschwillt die Musik der Sterne, wenn im Dämmern der Nacht Gott aus den Mauerflanken anderer Erden ein Orgelhaus erbaut; dann lösen sich die erdengrauen Kämpfer aus Blut und Schlamm der Schützengräben ins Licht und Lied der Sterne und singen mit dem Brüderheer der Toten und den brausenden Stimmen der Wälder die große Schöpferfuge:
Zuletzt ist Gott nur noch alleine
Zuckender Puls im All...
Weit über Wind und Wassern hämmert seine
Urewigkeit wie Flügel von Metall.
Ist Zechs Menschenglaube und -liebe von alttestamentlichem, prophetischem Eifer der Klage, des Zorns, der Forderung, so ist Franz Werfels (geb. 1890), des Pragers, Liebe zur Welt und Menschheit weicher, inniger, mystischer. Er stellt des Laotse Wort vor seine Gedichte: "Das Allerweichste auf Erden überwindet das Allerhärteste auf Erden" und Dostojewskis Wort: "Was ist die Hölle! Ich glaube, sie ist der Schmerz darüber, daß man nicht mehr zu lieben vermag." Immer tiefer und reicher sprechen seine Gedichtsammlungen "Der Weltfreund", "Wir sind", "Einander" "Der Gerichtstag" die Lebens- und Liebesverbundenheit aller Kreaturen aus. Nur als Erscheinung sind wir getrennt, im Wesen sind wir eins, eins in Gott. Noch im ärmlichsten Menschen, im verachtetsten Tier und Ding ist Gott verborgen, ringt Gott nach Offenbarung. Und diesen göttlichen Funken, diese göttliche Einheit hinter aller getrennten Erscheinung, hinter Armut, Eiter und Niedrigkeit zu suchen und zu lieben, ist unsere religiöse Aufgabe, ist der Sinn unseres Lebens: "Wer sich noch nicht zerbrach — Sich öffnend jeder Schmach — Ist Gottes noch nicht wach. — Erst wenn der Mensch zerging — In jedem Tier und Ding — Zu lieben er anfing."
So fleht der Dichter aus der Dumpfheit und Einsamkeit irdischer Gebundenheit: "O Herr, zerreiße mich!" so braust der Bittgesang der neuen Menschheitsgemeinde:
Komm, Heiliger Geist, du schöpferisch!
Den Marmor unserer Form zerbrich!
Daß nicht mehr Mauer krank und hart
Den Brunnen dieser Welt umstarrt,
Daß wir gemeinsam und nach oben
Wie Flammen ineinander toben!
— — — — Daß nicht mehr fern und unerreicht
Ein Wesen um das andere schleicht,
Daß jauchzend wir in Blick, Hand, Mund und Haaren
Und in uns selbst dein Attribut erfahren.
Im Dichter wird dieses Gebet zuerst und zutiefst erfüllt: "In dieser Welt der Gesandte, der Mittler, der Verschmähte zu sein, ist dein Schicksal," kündet ihm der Erzengel — "Daß dein Reich von dieser Welt nicht von dieser Welt ist," diese Erkenntnis, "ist, o Dichter, dein Geburtstag". Und so offenbart und erlöst der Dichter hinter der Welt der Erscheinung die wahre Welt. Von der Welt der Armen, der Dienstboten, der Sträflinge, der Droschkengäule, der Nattern, Kröten und des Aases zieht er den täuschenden Schleier der Erscheinung und offenbart das Geheimnis Gottes. Er will nichts sein als "Flug und Botengang" des Ewigen, "eine streichelnde Hand", die allen einsam-ängstenden Kreaturen von der göttlichen Wärme und Liebe mitteilt. Nicht die "Eitelkeit des Worts" nur die Reinheit und Güte der Seele gibt ihm die Macht zur Offenbarung und Erlösung: "Der gute Mensch" ist der Befreier der Welt:
Und wo er ist und sein Hände breitet...
Zerbricht das Ungerechte aller Schöpfung,
Und alle Dinge werden Gott und eins.
Nicht die Erscheinung zu fliehen und vor der Zeit abzustreifen, sondern die Erscheinung zu durchseelen, zu vergöttlichen, ist der Sinn der Schöpfung, nachdem sie einmal im Sündenfall der Vereinzelung von Gott abgefallen ist. In der Welt will Gott offenbart und erlöst werden. Ergreifend spricht sich das im "Zwiegespräch an der Mauer des Paradieses" aus, wo Adam, müde des Erscheinungswandels, zur alten paradiesischen Einheit in Gott zurückverlangt und ihn anfleht: "Höre auf, mich zu beginnen!", Gott aber weist ihn zurück in die Welt:
Kind, wie ich dich mit meinem Blut erlöste,
So wart' ich weinend, daß du mich erlöst.
Werfel ist ursprünglich, innig, oft franziskanisch-kindlich in seiner Religiosität; gerade, sicher und sehnend wächst seine Dichtung zum Himmel auf, wie ein gotischer Turm (erst im "Gerichtstag" gewinnt die Reflexion zersetzend Macht). Rainer Maria Rilkes, des älteren Pragers (geb. 1875), religiöse Lyrik ist mehr die Zierart am Turm, die Fülle und Unruhe der gotischen Skulpturen, der Heiligen, Tiere und Ornamente. Sie hat keine ursprüngliche, eigenmächtige Strebe- und Baukraft. Rilke ist der Ausgang eines alten Kärntner Adelsgeschlechtes, verfeinert, müde, heimatlos. In steten Reisen wechselte er zwischen Wien, München, Berlin, Rußland, Paris, Italien. Er lebt wie seine Gestalten "am Leben hin" nicht ins Leben hinein, durchs Leben hindurch. Die tiefsten Offenbarungen gibt ihm nicht das unmittelbare Leben, sondern das mittelbare: die Kunst. Erst in den Worpsweder Malern und ihrer Atmosphäre wird ihm die seelische Bedeutung der Landschaft, erst in der Kunst und dem Künstler Rodin die religiöse Bedeutung des Menschen Erlebnis. Rodin, bekennt er, habe ihn "alles gelehrt, was ich vorher noch nicht wußte, geöffnet durch sein stilles, in unendlicher Tiefe vor sich gehendes Dasein, durch seine sichere, durch nichts erschütterte Einsamkeit, durch sein großes Versammeltsein um sich selbst". Sein Buch über Rodin ist wohl sein tiefstes und reichstes Werk. Wie Rodin, der Gotiker unter dem Bildnern, den menschlichen Körper auflöst in Seele, so löst Rilkes "Stundenbuch" mit den drei Büchern "Vom mönchischen Leben", "Von der Pilgerschaft" "Von der Armut und vom Tode" die Körper und Dinge in Gott. "Es gab eine Zeit, wo die Menschen Gott im Himmel begruben... Aber ein neuer Glaube begann... Der Gott, der uns aus den Himmeln entfloh, aus der Erde wird er uns wiederkommen." So offenbart Rilke Gott in den Kindern, den Mädchen, dem Volk, den Armen, den Bauern, der Landschaft, und mehr als in den Menschen in den Dingen: "Weil sie, die Gott am Herzen hingen — Nicht von ihm fortgegangen sind." Aber diese Offenbarung wächst nicht wie bei Werfel aus unmittelbarem Lebensanteil und -zwiespalt und heiliger Gewißheit, sie wächst aus der Sehnsucht des heimatlosen Zuschauers und Künstlers und aus dem Wissen um viele religiöse Vorstellungen und Symbole. Ein russischer Mönch ist der Träger und Schreiber des Stundenbuches, und der ganze Stimmungsreichtum russischer Klöster, Kuppeln, Ikone, Gossudars wird genutzt. Anderen religiösen Gedichtzyklen, wie den "Engelliedern" und den "Liedern der Mädchen an Maria" werden präraffaelitische Erinnerungen zu Stimmungsträgern. Und die "Neuen Gedichte", die in der Fülle ihrer Bilder die Beziehungen der individuellen Erscheinungen zu den letzten Prozessen und Formen des Daseins gestalten wollen, tun dies nicht aus der drängenden Einheit und Tiefe eines ursprünglichen Weltgefühls, sondern im seelischen oder gedanklichen Umkreisen eines Themas. Oft gestaltete, künstlerisch schon reizvoll umspielte Themen locken Rilke besonders: Abisag, David vor Saul, Pieta, Sankt Sebastian, Orpheus und Eurydike, Alkestis, Geburt der Venus, Eranna an Sappho usw. In diesen Lebensbildern sucht und schafft die Seele sich Heimat, der das Leben selber sich verschließt. Und sie bringt ihnen all ihre menschliche und künstlerische Feinfühligkeit und Bewußtheit als Gastgeschenk. Frühzeitig hat Rilke sich seinen Sprachstil geschaffen von solcher Eigenheit, daß er die Grenze der Manier streift. Unscheinbare Worte weiß er neu zu beseelen, verbrauchte Bilder auf ihren Ursinn zurückzuführen, Gleichnisse preziös auszubauen. Durch Assonanz, Binnenreim und Häufung des Endreims weiß er der Sprache eine slawische Weichheit und Klangfülle zu geben. Im letzten Gedichtbuch, der "Neuen Gedichte zweiter Teil", gewinnt jedoch das Artistische bedenklich Raum.
Die Neigung zur Mystik ist Gefahr und Flucht für eine Zeit, die die Form der Persönlichkeit wiedergewinnen, nicht aufgeben soll. Nicht ichflüchtig, sondern im tiefsten ichsüchtig mußte der Lyriker werden, der zur Form der neuen Lyrik: zur Form des neuen Menschen vordringen wollte. Und wenn niemand durch die Zeit hindurch zu ihr drang, wenn selbst Richard Dehmel, dem stärksten Bildner, deren zersetzte Elemente bröckelnd in den Händen blieben, so konnte nur der die reine Form der Persönlichkeit, des neuen Menschen bilden, der es von Anfang an außer der Zeit und gegen de Zeit unternahm. So ist die Persönlichkeit und Dichtung Stefan Georges (geb. 1866) Form geworden.
Der Wille zur Form war das Wesengesetz Georges von früh auf. Er selbst weist darauf hin, daß ihm die Formkräfte des römischen Imperiums, des Katholizismus, der rheinischen Landschaft im Blute mitgegeben seien. Zuerst wurde dieser Formwille ästhetisch seiner bewußt. Die "Blätter für die Kunst" die er 1892 gegründet, förderten — beeinflußt von den Präraffaeliten und von französischen Lyrikern, wie Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Villiers — eine "Kunst für die Kunst", sahen "in jedem Ereignis, jedem Zeitalter nur ein Mittel künstlerischer Erregung". Aber hinter diesem Willen zur ästhetischen Form rang und schuf bei George — nicht bei seinen Mitläufern — der Wille zu Lebens- und Wesensformen. Und weil er diese in der eigenen Zeit nicht fand, weil aus deren zersetzten Elementen auch keine reinen Formen zu bilden waren, floh seine Seele "vorübergehend in andere Zeiten und Örtlichkeiten", um dort die Urformen des Menschentums in ihrer Reinheit wieder zu suchen und bildhaft zu erneuern. In Algabal, dem römischen Priesterkaiser, fand er sein antikes Gegenbild: den Jüngling, den es verlangte, unabhängig von einer zergehenden Um- und Außenwelt ein Leben und Reich reiner Schönheit, reiner Formen zu schaffen:
Schöpfung, wo nur er geweckt und verwaltet,
Wo außer dem seinen keine Wille schaltet,
Und so er dem Wind und dem Wetter gebeut.
Der Schatten Ludwigs II. weht durch diese Strophen. Aber an der Vermessenheit des Einsam-Überheblichen zerbricht diese Welt. Aus dem Abseits und der Vereinzelung spätrömischen Herrschertums fliehen die "Hirtengedichte" in die mythisch geläuterten Urformen naturhaft schönen und reinen Menschentums, wie sie die Griechen zuerst gewahrt und gebildet haben. Hier beginnt die tiefe Wesensverwandtschaft Georges mit der Antike deutlich zu wurden. Das Christentum hatte in seiner Weltflüchtigkeit, seiner metaphysischen Sehnsucht und Wertung formsprengende Elemente in sich aufgenommen; nur im südlichen und rheinischen Katholizismus waren Himmel und Erde in Lebensfreude und Bildhaftigkeit eins geblieben. Georges reinem Formenwillen konnte nur eine antikische Weltanschauung genugtun, in der Gott und Welt, Seele und Leib sich restlos durchdrangen, und in der Schönheit der Gestalt zur vollkommenen Form gelangen. "Den Leib vergotten und den Gott verleiben", das war ihm der Sinn alles Weltgeschehens, darin Natur und Kunst sich trafen. Für diese religiöse Aufgabe bedurfte die Dichtung einer vollen Erneuerung ihrer Formsubstanz: der Sprache. Und von Anfang an hatte George sich darum gemüht, die epigonenhaft verbrauchten Elemente der deutschen Sprache neu zu schaffen. Er war in den Geist und Klang von sieben fremden Sprachen eingedrungen. In unermüdlichen Übersetzungen hatte er die deutsche Sprache bereichert, durchglüht und gehämmert. Im "Algabal" war ihm die Sprache ganz zu eigen geworden; es waren keine übernommenen und verbrauchten Elemente mehr in ihr, sie war wieder ursprünglich, war imstande, seinen neuen reinen. Wesens- und Lebensformen in reiner Sprachform Gehalt zu geben.
Nun war George stark genug, von seiner Flucht in die Welt der Geschichte zurückzukehren, nicht mehr Urbilder vergangener Zeiten zu erneuern, sondern Urkräfte zu bannen. Im "Jahr der Seele" (1897) offenbart er Urformen der Natur.
Die Natur ist ihm kein Gegensatz zum Geist oder zur Seele, ist ihm die Lebenseinheit beider, ursprünglich und ewig wie die Antike, die keine entgötterte und entseelte Natur kannte. So erschienen im "Jahr der Seele" die Urformen der Natur, die Jahreszeiten, in Bildern von räumlicher Gegenständlichkeit und Farbigkeit und zugleich tiefster Seelenhaftigkeit. Die Seele sucht hier nicht — wie bei Goethe — die Natur, um an ihr sich zu finden und auszusprechen; beide sprechen sich in ursprünglicher, kosmischer Einheit aus. Urformen der Natur offenbaren sich als Urformen der Seele, Urformen der Seele als Urformen der Landschaft. So sind es keine Stimmungs-, sondern Schicksalsbilder, die diese Gedichte schaffen. Die Fülle des Herbsttags hebt an, die reife Ernteruhe und -klarheit, der Friede der Erfüllung, den doch der Vers Hebbels schon ahnend durchschauert: "So weit im Leben ist zu nah am Tod." Wie sind Seele und Landschaft eins in solchem Gedicht:
Wir schreiten auf und ab im reichen Flitter
Des Buchenganges beinah bis zum Tore
Und sehen außen in dem Feld von Gitter
Den Mandelbaum zum zweitenmal im Flore.
Wir suchen nach den schattenfreien Bänken,
Dort, wo uns niemals fremde Stimmen scheuchten,
In Träumen unsre Arme sich verschränken,
Wir laben uns am langen, milden Leuchten.
Wir fühlen dankbar, wie zu leisem Brausen
Von Wipfeln Strahlenspuren aus uns tropfen,
Und blicken nur und horchen, wenn in Pausen
Die reifen Früchte an den Boden klopfen.
Erst nachdem George die Urformen der Geschichte und der Natur erlebt, erneuert und gebannt, ist er geläutert und gestählt zur Weihe der Berufung. Jetzt erscheint ihm der Engel des "Vorspiels": "Das schöne Leben sendet mich an Dich — Als Boten." Der Geist des Lebens erscheint ihm jetzt, des "schönen Lebens", dem alles Dasein reine Einheit ist und klare Form. Der hebt ihn zu sich auf die heilige Höhe der Sendung. Die reinen Formen, die er bisher nur erfahren und erneuert — jetzt darf er sie am Urquell mit schauen und -schaffen; ein Leben der Weihe wartet seiner, in dem jede Stunde sich sinnvoll einordnen, schöpferisch rechtfertigen will. Aber die Gnade der Berufung fordert das Opfer, die Hingabe, den ausschließlichen Dienst des Berufenen. Aus irdischem Glück und menschlicher Wärme schreitet er zur Gipfelhöhe, Gipfeleinsamkeit, Gipfeleisigkeit.
"Georges Vorspiel ist nur Gedicht, gehorsam demselben strengsten Geheiß, das den Zarathustra erzwang: dem Ich Gesetz und Heil des Lebens zu schaffen in gottblinder und weltwirrer Zeit, doch nicht für alle und keinen, sondern aus dem einen. Ist ein Dichter mehr als bloß ein Ich, dann gilt es dadurch den anderen; und was ihn ruft, weckt auf die Ohren, die ihn vernehmen. Soll er den Kreis füllen, so muß er die Mitte und die Strahlen halten, nicht dem Umfang nachlaufen. S i c h gestalten, sich erfüllen, sich vollenden war Georges erstes Gebot, und das empfing er nicht vom Fernen, sondern vom Nächsten, seinem eigenen Herzen. Doch eben dies Gebot war die Antwort auf die Frage des Lebens... und indem er sich erfüllte, als Dichter, indem er seine Form fand, seinen Streit ausfocht, sein Wort sagte, tat er, was an der Zeit war. Dantes Gesetz hieß: Schaue i Gott... Goethes: Werde Welt... Georges: Gestalte Leben. Die Gefahren, Leiden, Wonnen und Pflichten dieses Gesetzes hat er im Vorspiel verkündet, von der Einweihung bis zur Vollendung." (Gundolf.)
Erst der also Geweihte vermag aus dem Geist des Lebens den "Teppich des Lebens" (1900) zu zeichnen: die geistigen Urbilder des Menschentums in Natur und Geschichte, "das Kräftereich europäisch-deutscher Menschenbildung in einzelnen Schöpfungsformen, von den erdgebundenen Anfängen bis zum geistigen Tun und Wirken der Genius". (Gundolf.) Wie "ein Epos des Erdgeistes" beginnt die Reihe mit dem mütterlichen Grunde alles Menschentums, der "Urlandschaft", in der Mensch, Tier und Erde noch unbewußt und einig sind: "Erzvater grub, Erzmutter molk, — Das Schicksal nährend für ein ganzes Volk."
Zum erstenmal in dieser epischen Bilderfolge taucht in Georges Werk das Volk als Urform des Menschentums auf und als Urform seines Menschentums das deutsche Volk. Im Vorspiel hatte der Geist des Lebens ihn aus den magischen Landschaften des Südens zu "den einfachen Gefilden", der "strengen Linienkunst" der heimischen, rheinischen Landschaft geführt:
Schon lockt nicht mehr das Wunder der Lagunen,
Das allumworbene, trümmergroße Rom,
Wie herber Eichen Duft und Rebenblüten,
Wie sie, die deines Volkes Hort behüten —
Wie deine Wogen — lebensgrüner Strom!
Jetzt ist ihm das Volk als Urform deutlich geworden, die ihn selber umfaßt, die Wesens- und Geschichtskräfte des deutschen Volkes. Seine Sendung ist zur deutschen Sendung geworden: Indem er die reinen Kräfte des deutschen Volkes in sich zur Gestalt bildet, wird er auch der Bildner seines Volkes sein. — —
"Den Leib vergotten und den Gott verleiben": die Einheit von Welt und Gott, Natur und Geist, Leib und Seele war Georges Weltanschauung und -aufgabe. Sie sollte und mußte er erleben, erschauen, erschaffen. Das höchste Symbol dieser Einheit ist der Gott-Mensch. Und wenn je die Menschheit dieses Symbols bedurfte zu ihrer Vollendung — George konnte sich nicht begnügen, seine Weltanschauung in zerstreuten Bildern zu schauen und zu schaffen; sie mußte sich ihm in einer Gestalt verdichten. Das war die höchste Möglichkeit seiner Weltanschauung. Und seinem Formsehnen und -willen war die höchste Möglichkeit auch die höchste Notwendigkeit. So schaute und schuf er in Maximin, der geliebten Gestalt eines schönen, früh gestorbenen Jünglings und Jüngers, das Bild des Gott-Menschen, darin die Welt vollkommen ward.
"Wir gingen", heißt es in Georges Maximin-Rede, "einer entstellten und erkalteten Menschheit entgegen, die sich mit ihren vielspältigen Eingenschaften und verästelten Empfindungen brüstete, indessen die große Tat und die große Liebe am Entschwinden war. Massen schufen Gebot und Regel und erstickten mit dem Lug flacher Auslegung die Zungen der Rufer, die ehemals der Mord gelinder beseitigte: unreine Hände wühlten in eincm Haufen von Flitterstücken, worein die wahren Edelsteine wahllos geworten wurden. Zerlegender Dünkel verdeckte ratlose Ohnmacht, und dreistes Lachen verkündete den Untergang des Heiligtums." Da erschien in Maximin der göttlich einfsch schöne Mensch, "Einer, der von den einfachen Geschehnissen ergriffen wurde und uns die Dinge zeigte, wie die Augen der Götter sie sehen." In ihm ward der erstarrten Zeit der Erlöser:
Die starre Erde pocht,
Neu durch ein heilig Herz.
Die Gedichte auf das Leben und den Tod Maximins, seine Feier, Verklärung und Wirkung bilden die Gipfelhöhe des "Siebenten Rings" (1907). Von ihr aus sind die "Gestalten" geschaut, der zweite Zyklus des Werkes, "der Aufruf der letzten gotteshaltigen oder gottesmörderischen Urwesen zur Wende der Gesamtmenschheit". (Gundolf.) Im Vor- und Aufblick zu ihr ist in den "Zeitgedichten" die Gegenwart zu Gericht gerufen, verworfen in ihrer Fäulnis und Finsternis, gesegnet in den einsam ragenden Lichtgestalten, den Vorbildern: Nietzsche, Böcklin, Leo XIII., denen Dante, Goethe, Karl August, die alten deutschen Kaiser sich in ewiger Lebendigkeit zugesellen: Urformen höheren Menschentums, wie Held und Herrscher, Priester, Seher und Dichter usw. Hier wird George Gewissen und Stimme der Zeit.
Im "Stern des Bundes" (1914) wird die Zeitschau, die in den "Zeitgedichten" nur aus der Ahnung des Göttlichen geschah, aus seinem Schauen und Wissen gegeben. Hier wächst George zum gewaltigen Richter und Propheten der Zeit empor. Ein paar Monate vor Beginn des Weltkrieges hat er hier aus heiligen Höhen den chaotischen Untergang der zersetzten Zeit gesichtet und gerichtet:
Aus Purpurgluten sprach des Himmels Zorn:
Mein Blick ist abgewandt von diesem Volk.
Siech ist der Geist! Tot ist die Tat!
In einer ungeheuren Vision sieht und hört er in gewitternden Lüften schreitende Scharen, klirrende Waffen, jubelnd drohende Rufe: den "letzten Aufruf der Götter über diesem Land". Er sieht den maß- und haltlosen Bau der Zeit wanken und zusammenstürzen. Er fühlt die furchtbare Gewißheit:
Zehntausend muß der heilige Wahnsinn schlagen,
Zehntausend muß die heilige Sache raffen,
Zehntausende der heilige Krieg.
Er hört sein Prophetenwort, seinen Schrei zur Umkehr verhallen, als wäre nichts geschehen. Und im letzten, flammenden Gesicht sieht er den Herrn des Gerichtes:
Weltabend lohte...wieder ging der Herr
Hinein zur reichen Stadt mit Tor und Tempel,
Er arm, verlacht, der all dies stürzen wird,
Er wußte: kein gefügter Stein darf stehn,
Wenn nicht der Grund, das Ganze sinken soll.
Die sich bestritten, nach dem Gleichen trachtend:
Unzahl von Händen rührte sich und Unzahl
Gewichtiger Worte fiel und eins war not.
Weltabend lohte...rings war Spiel und Sang,
Sie alle sahen rechts — nur er sah links.
Und als die Vision Wahrheit geworden, das Weltverhängnis niedergebrocben war, als immer noch "In beiden Lagern kein Gedanke — Wittrung — Um was es geht", als aller Augen immer noch nur das strategische Hin und Her anstarrten, da kündete er in seinem Gedicht "Der Krieg" (1917):
Der alte Gott der Schlachten ist nicht mehr.
Erkrankte Welten fiebern sich zu Ende
In dem Getob.
— — —
Zu jubeln ziemt nicht: kein Triumpf wird sein.
Nur viele Untergänge ohne Würde.
— — —
Keiner, der heute ruft und meint zu führen,
Merkt, wie er tastet im Verhängnis, keiner
Erspäht ein blasses Glüh'n vom Morgenrot.
Weit minder wundert es, daß so viel sterben,
Als daß so viel zu leben wagt.
— — —
Ein Volk ist tot, wenn seine Götter tot sind.
Aber eben weil George von heiligen Höhen über die Zeit hinwegsah, sah er auch weiter, über den Zerfall und Untergang hinaus, mündete sein Kassandraruf in die heilig-liebende deutsche Verheißung:
Doch endet nicht mit Fluch der Sang. Manch Ohr
Verstand schon meinen Preis auf Stoff und Stamm,
Auf Kern und Keim...schon seh' ich manche Hände
Entgegen mit gestreckt, sag' ich: O Land,
Zu schön, als daß ich dich fremder Tritt verheere:
Wo Flöte aus dem Weidicht töne, aus Halmen
Windharfen rauschen, wo der Traum noch webt
Untilgbar durch die jeweils trünnigen Erben...
Wo die allbühende Mutter der verwildert
Zerfallnen weißen Art zuerst enthüllte
Ihr echtes Antlitz...Land, dem viel Verheißung
Noch innewohnt — das drum nicht untergeht, — — —
Die ruft die Götter auf.
Der "Geist der heiligen Jugend unseres Volkes", der — in Maximin göttliche Gestalt geworden — schon im "Stern des Bundes" verkündet und in Lehre und Liebe dort unterwiesen war, wird in Frommheit und Würde, Zucht und Opfer, Größe und Schöne die zerfallene Welt erneuern.
Als einziger einer zersetzten Zeit hat Stefan George seine Wesenheit in Leben und Lyrik zur reinen Form geläutert, urbildlich erhöht und vollkommen gestaltet. Mag das Gesetz seines Wesens wenigen gemäß sein — er ragt in die Zeit als Standbild des in sich Vollendeten, ein Vorbild jedem, das Gesetz seines eigenen Wesens zu ergründen, zu leben, zu formen und im eigenen göttlichen Keim die Kraft Gottes im entgötterten Europa zu befreien.