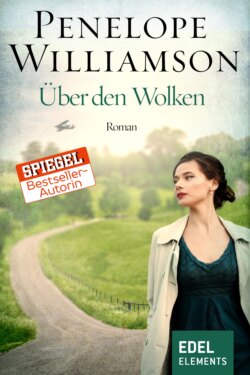Читать книгу Über den Wolken - Penelope Williamson - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2
ОглавлениеLinc Cameron, ehemaliger Kapitän im Lafayette Fliegercorps, lehnte sich gegen das mit rot-weiß-blauen Flaggen geschmückte Geländer der Tribüne. Er kam sich wie eine Zirkusattraktion vor. Er trug die Galauniform der Flieger, rote Hose und blaue Jacke, und fühlte sich äußerst unbehaglich. Die Aufmerksamkeit, die man ihm zollte, steigerte sein Unbehagen; überhaupt war ihm die ganze Veranstaltung äußerst zuwider.
Es herrschte auch nicht gerade ideales Wetter, um im Freien herumzustehen und sich alle möglichen Reden anzuhören. Dutzende kleine amerikanische Fähnchen zierten die Tribüne und knatterten im kalten Wind; der Fahnenstoff, der das Tribünengerüst verkleidete, blähte sich und verfing sich im groben Holz. Eine Kapelle stimmte ihre Instrumente, und die Männer hauchten sich in die Hände, um diese warm zu halten. Das Gras im Stadtpark von Kingly war braun und verwelkt, und an manchen Stellen war der Boden kahl.
Linc zog die Schultern hoch, steckte die Hände in die Taschen und fluchte leise vor sich hin.
»He, Alter!« erklang eine sarkastisch klingende Stimme. »Mit deiner finsteren Miene verscheuchst du ja alle hübschen Mädchen!«
Linc drehte sich zu Edward Farrell um. Farrell war groß und schlank und trug die gleiche Uniform wie Linc. Sie waren gemeinsam in Frankreich gewesen und hatten gemeinsam gekämpft; in vieler Hinsicht standen sie einander so nahe wie Brüder.
Linc verzog das Gesicht. »Du weißt, wie sehr ich diesen Unfug hasse, Ward.«
Ward Farrell lächelte, und seine braunen Augen wurden schmal dabei. »Du gewöhnst dich besser daran. Der Krieg ist zwar vorüber, aber jetzt wird gefeiert. Und du bist der Ehrengast!«
Jemand betrat neben ihnen die Tribüne und zog das weiße Tuch vom Tonmodell des Denkmals. Kritisch betrachteten die beiden Männer das angekündigte Meisterwerk des Bildhauers. Es war eigentlich kein Obelisk: Die Basis war dick, das obere Ende abgerundet. Zwei Jahre in der mit Zoten geladenen Atmosphäre auf den Militärflugplätzen Frankreichs hatten Linc und Ward geprägt. Die Freunde tauschten belustigte Blicke. Ward lachte als erster laut heraus. »Du lieber Himmel, Linc, was haben sich denn die Stadtväter dabei gedacht? Es sieht aus wie ...«
»Ja, ja, ich weiß.« Linc mußte jetzt ebenfalls lachen. Dann sah er sich im Park um. Es war nur ein kleines Geviert mit einem alten, von Ulmen umstandenen Pavillon. Hier hatte die Kapelle Aufstellung genommen und begann soeben eine wehmütige Melodie zu spielen. Neben dem Pavillon hatte man ein rot-weiß gestreiftes Zelt errichtet, in dem Erfrischungen angeboten wurden: glasierte Kuchen und Kekse, widerlich rosaroter Punsch, Kaffee und Tee in silbernen Kannen.
Linc beobachtete zwei Knaben in Matrosenanzügen und mit Strohhüten, die rund um die Zeltstangen Fangen spielten, und mußte lächeln. Er war schon in unzähligen Städten wie Kingly gewesen – friedliche Gemeinden, traditionsbewußt und still in sich ruhend; der gleichförmige Lebensrhythmus dieser Städtchen hatte immer beruhigend auf ihn gewirkt. Hier würde ich mich gern niederlassen, dachte Linc. Seßhaft werden, heiraten und eine Familie gründen.
Der Krieg war endlich vorüber – er war vor drei Monaten zu Ende gegangen –, und Linc Cameron sehnte sich aus ganzem Herzen nach einem normalen Leben, damit er den Tod – und das Töten – vergessen konnte.
Linc betrachtete die versammelten Menschen. Der Anlaß war zwar ernst, dennoch schienen die Leute guter Laune zu sein und sich über die Gelegenheit zu freuen, Freunde und Nachbarn zu treffen. Außer einigen jungen Männern, die immer noch die khakifarbenen Infantrieuniformen trugen, waren alle Festgäste in Sonntagskleidung gekommen. Aber Februar war keine gute Zeit für eine Feierstunde im Freien, und die Frauen mußten ihre hübschen Kleider unter dicken Wintermänteln verbergen; nur die Broschen an den Spitzenkrägen oder hier und da eine hervorblitzende kunstvolle Ärmelmanschette ließen vermuten, was sich unter den Mänteln verbarg.
Erst jetzt wurde sich Linc bewußt, daß er ein bestimmtes Gesicht in der Menge suchte, und das ärgerte ihn. Nach dem gestrigen Kuß war er bestimmt der letzte Mensch, den sie sehen wollte. Außerdem sollte ein Mann wie er, der sich nach Ruhe und einem normalen Leben sehnte, so vernünftig sein und sich aus dem Staub machen, sobald ihm ein Mädchen wie Cassie Jones über den Weg lief.
In diesem Augenblick erspähte er eine schlanke Gestalt mit blonden Haaren, und trotz seiner guten Vorsätze schlug sein Herz schneller. Aber als sich die Frau umdrehte, war ihm ihr Gesicht unbekannt.
Die Fremde schien ihn jedoch zu kennen, denn sie hob die Hand und winkte. »Hallo, Mr. Cameron!« rief sie und kam zielstrebig auf ihn zu.
»Oho! Nimm dich besser in acht, Linc, alter Knabe!« warnte Ward und grinste dabei.
»Warum?«
»Weil sich gleich das mannstollste weibliche Wesen von ganz Kingly auf dich stürzen wird. Eine Zeitlang hatte sie es auch auf Monte abgesehen, bevor meine Schwester ihn ihr vor der Nase wegschnappte.« Linc stöhnte auf, und Ward lachte und weidete sich sichtlich an der Verlegenheit des Freundes. »Sieh einer an! Ihrem Blick nach zu schließen, hält sie dich für erstklassige Beute!«
Die junge Frau war noch zu weit entfernt, als daß Linc ihre Augen sehen konnte, aber er befürchtete das Schlimmste. Weibliche Wesen auf Männerfang machten ihn immer nervös. Dann bemerkte er zu seiner Erleichterung, daß die Frau von zwei älteren Damen mit Sammelbüchsen aufgehalten worden war – vermutlich wollte man noch bis zur letzten Minute Geld für das Kriegerdenkmal auftreiben. Seine Verehrerin warf Linc einen flehenden Blick zu, aber er kehrte ihr den Rücken zu.
»Ich bin keine Beute«, erklärte er Ward. »Weder eine erstklassige noch sonst eine.«
»Klar bist du das. Du bist jetzt berühmt, ob es dir paßt oder nicht. Du warst ein As als Kampfpilot, und an deiner Brust baumeln jede Menge Orden; das gefällt den Frauen. Sie umschwärmen dich doch wie die Bienen einen Honigtopf.«
Linc schüttelte den Kopf und grinste. »Hinter dir sind sie genauso her, Ward.«
Ward lächelte geringschätzig. »Nicht mit meinen kümmerlichen drei Abschüssen.« Er zuckte mit den Achseln. »He, alter Knabe, du solltest dich nicht beklagen. Ruhm und Ehre machen dich zu einem reichen Mann.«
Linc runzelte die Stirn. Ward hatte recht, ob er es wollte oder nicht, er war jetzt berühmt. Nur ein einziger Amerikaner, Eddie Rickenbacker, hatte mehr Flugzeuge abgeschossen als Linc. Aber die Lobhudelei und die ihm entgegengebrachte Aufmerksamkeit machten Linc nicht glücklich. Er schämte sich innerlich dafür, daß er fähig war, kaltblütig und gezielt zu töten, und wollte auf keinen Fall dafür belohnt werden, daß er den Tod von Männern verursacht hatte, die nur ihre Pflicht getan hatten, genau wie er.
Melodie Farrell näherte sich in Begleitung einer großen, überschlanken Frau. Beide Frauen waren ganz in Schwarz gekleidet, aber Linc hatte den Eindruck, daß die unbekannte Frau, im Gegensatz zu Melodie, ihre Trauerkleider nicht nur zum Schein trug.
»Ihr beide seid ja doch die attraktivsten Männer weit und breit!« rief Melodie. Sie küßte Ward auf die Wange und sah Linc an, als hätte sie ihn auch gern geküßt.
»Melodie, was ...« begann ihr Bruder, aber Melodie unterbrach ihn mit einem entzückten Aufschrei.
»Sieh an, wie viele Leute gekommen sind! Monte hätte sich sehr darüber gefreut, das weiß ich.« Sie faßte die Frau am Arm und zog sie näher heran. »Linc? Das ist Janet, Montes Schwester. Sie möchte sich unbedingt mit Ihnen unterhalten, nicht wahr, Janet? Weil Sie doch zusammen mit ihrem Bruder in Frankreich waren, und so weiter! Du liebe Zeit«, rief Melodie und winkte jemandem zu, der sie gegrüßt hatte. »Ich muß mir meine Anweisungen holen. Ich soll nachher Kaffee eingießen. Wenn das nur keine Katastrophe gibt! Womöglich schütte ich Kaffee auf die Frau des Bürgermeisters!«
Melodie lief lachend davon und ließ ihre Begleiterin stehen.
»Es tut mir leid, Janet«, entschuldigte sich Ward Farrell. »Normalerweise ist Melodie nicht so unsensibel. Sie ist nervös, und wenn sie nervös ist, plappert sie und ...«
Die Frau legte Ward ihre schmale Hand im schwarzen Spitzenhandschuh auf den Arm. »Ich verstehe, Ward.«
Er nickte und seufzte. »Janet, das ist Linc. Linc Cameron.«
Ein dünner schwarzer Schleier verdeckte das Gesicht der Frau. Linc konnte ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Miss Lane«, begrüßte Linc sie ernst.
Ein eisiger Windstoß fuhr plötzlich durch die nackten Zweige der Ulmen und wirbelte Staub durch die Luft. Die Frau zog den Mantelkragen enger um den Hals zusammen, und Linc entdeckte an ihrer Hand unter der dünnen schwarzen Spitze einen schmalen goldenen Ring.
Die Frau bemerkte seinen Blick. »Ich habe in Frankreich nicht nur meinen Bruder, sondern auch meinen Mann verloren.«
»Das tut mir leid.« Linc wußte, wie unzulänglich die Worte waren.
Janet senkte den Kopf. »Danke. Und vielen Dank, daß Sie heute gekommen sind.« Sie sah Linc an und lächelte zaghaft; sie mußte einmal ein bezauberndes Lächeln gehabt haben, bevor es in Trauer erstarrt war. »Die Briefe, die mein Bruder nach Hause schrieb, waren voll mit bewundernden Schilderungen von Ihren verwegenen Heldentaten, Mr. Cameron. Ich möchte, daß Sie wissen, wie sehr er Sie schätzte. Sie waren sein bester Freund.«
Linc spürte, wie Ward neben ihm zusammenzuckte. Ward Farrell und Monte Lane waren seit vielen Jahren Freunde gewesen – dicke Freunde –, bis Linc aufgetaucht war und ein Freundestrio daraus geworden war. Erst nach Montes Tod war Linc der Verdacht gekommen, daß er womöglich einen Keil zwischen die alten Freunde getrieben hatte. »Wir standen einander sehr nahe, alle drei«, bestätigte er.
Janet lächelte ihm und Ward zu. »Ja, natürlich.« Sie holte tief Luft, als ob sie sich auf etwas Unerfreuliches vorbereitete. »Soviel ich weiß, waren Sie dabei, Mr. Cameron, als ... als mein Bruder starb. Ich wollte Sie fragen, können Sie mir sagen, ob er ... ob er litt ...«
Linc hatte plötzlich den Geruch von verbranntem Fleisch in der Nase. Die Erinnerung war so intensiv, daß sie ihm einen Augenblick lang den Atem nahm. Er mußte die Zähne fest aufeinanderbeißen, damit sie nicht klapperten. Um Janet Lanes willen hoffte er, daß sein Gesichtsausdruck nichts von seinen Gefühlen widerspiegelte.
»Er hat nicht gelitten. Er war sofort tot«, unterbrach Linc schließlich die lastende Stille. »Er konnte keine Schmerzen gehabt haben.« Die Erleichterung auf Janets Gesicht bestätigte ihm, daß er mit seiner Lüge Erfolg gehabt hatte.
In diesem Augenblick kam ein korpulenter Mann auf sie zu; er rang nach Atem und schwitzte, trotz der Kälte. Der Bürgermeister von Kingly, dem Linc bereits vorgestellt worden war.
»Wenn Sie sich bitte alle auf die Tribüne begeben«, bat der Bürgermeister. »Wir beginnen jetzt mit der Feier.«
Linc half Janet auf die Tribüne und geleitete sie zu einem Stuhl neben dem Modell für das Denkmal. Er und Ward nahmen ihre Plätze links und rechts von Janet ein. Die Leute aus der Stadt beeilten sich und setzten sich auf die hölzernen Klappstühle, die gegenüber der Tribüne aufgereiht standen. Sie saßen stocksteif und gaben sich Mühe, nicht vor Kälte zu zittern, während sie höflich auf den Beginn der Zeremonie warteten. Erst jetzt bemerkte Linc, daß manche Leute weiße Gazemasken trugen, um sich gegen die äußerst ansteckende Grippe zu schützen, an der bereits Tausende im ganzen Land gestorben waren. Es war ein makabrer Anblick.
Linc kam sich wie ein Ausstellungsobjekt vor und fühlte sich sehr unbehaglich. Er wäre gern woanders gewesen. Wenn es so etwas wie einen Himmel gab, dann würde Monte vermutlich von dort herunterschauen – das Modell für das Denkmal, die Musikkapelle, er und Ward in ihren etwas operettenhaften Galauniformen – Monte würde lachen, wenn er sie sehen könnte. Doch Monte hatte solche dramatischen Inszenierungen immer geliebt. Diese Vorliebe hatte schließlich auch zu seinem Tod geführt.
Plötzlich glaubte Linc, Montes verkohltes Gesicht über der Menge zu sehen, und er kniff die Augen zusammen. Die Kapelle begann einen Marsch zu spielen, und die Zuhörer applaudierten.
Kaum war die Musik verklungen, nahm der Bürgermeister seinen Platz auf dem Sprecherpodium ein; wieder applaudierte die Menge. »Wir haben uns heute zu Ehren dieser tapferen jungen Männer versammelt«, begann der Bürgermeister. Linc lächelte bitter. Er hielt sich nicht für tapfer und fühlte sich keineswegs mehr jung.
An seinem dreiundzwanzigsten Geburtstag war er Kampfpilot geworden; mehr als zwei Jahre voller Blut und Tränen waren seither vergangen. Amerika war damals noch nicht in den Krieg eingetreten. Aber als eine französische Fliegerstaffel aus amerikanischen Freiwilligen gebildet werden sollte, das sogenannte Lafayette Fliegercorps, hatte er sich sofort gemeldet. In Frankreich hatte er dann Monte Lane und Edward Farrell kennengelernt, zwei Freunde aus derselben Stadt in Virginia. Monte und Ward waren all das, was er nicht war: Sie waren reich, während er jeden Pfennig zusammenkratzen mußte. Sie waren auf der Universität gewesen, er hatte sich alles selbst aneignen müssen; sie waren geradezu überschwenglich freundliche Menschen, er war ein Einzelgänger. Dennoch war Linc von Monte und Edward als Kamerad und Freund akzeptiert worden, und die drei wurden unzertrennlich. Doch nein, das stimmte nicht ganz. Der Tod hatte sie getrennt, als aus dem gleißenden Licht der Sonne ein Leuchtspurgeschoß aufblitzte.
Ein Tumult am anderen Ende des Parks riß Linc aus der Erinnerung an Montes Tod. Eine kleine Gruppe von Suffragetten war aufgetaucht und marschierte mitten auf der Hauptstraße auf den Park zu. Es wurde gehupt, Polizisten bliesen in ihre Trillerpfeifen, und ein Maultier, das einen Gemüsekarren zog, scheute, so daß Tomaten und Salat in den Rinnstein rollten.
Dem Bürgermeister versagte allmählich die Stimme. »Männer ... die so viel geopfert haben ... so viel, für äh, die Demokratie«, er begann zu stottern, als sich die Zuhörer umdrehten, um das ganze Durcheinander zu beobachten. Linc und Ward grinsten einander an; das versprach interessant zu werden.
Mit Tambourinen und zwei Trommeln machten die Frauen ihre eigene Musik. Quer über die Brust trugen sie Schärpen, auf denen stand: WAHLRECHT FÜR FRAUEN, und in den Händen hielten sie Blumenbouquets aus gelbem Papier. Die Anführerin war eine schlanke Blonde mit einem breitkrempigen Hut mit einer langen gelben Schleife. Linc erschrak. Das mußte Cassie Jones sein, dachte er. In einer kleinen Stadt wie Kingly konnte es unmöglich zwei blonde Unruhestifterinnen geben.
Die Suffragetten waren am Parkzaun angekommen. Linc fragte sich gerade, ob die Frauen wohl über den Zaun klettern würden, als eine von ihnen das eine Ende einer schweren Eisenkette um einen Pfosten und das andere Ende um ihre Taille schlang.
Ein Polizist lief auf die Frau zu. Er schrie sie an, sie schrie zurück, und dann versuchte er, die Kette abzuwickeln. Die Frau traktierte seine Brust mit Fäusten und trat ihm gegen die Schienbeine. Der Mann stöhnte so laut auf, daß es bis zu Linc herauf zu hören war. Cassie Jones kam der Frau zu Hilfe. Sie packte den Polizisten am Handgelenk und versuchte, seine Finger von der Kette zu lösen. Auch als er die Kette so unvermittelt losließ, daß Cassie das Gleichgewicht verlor, hielt sie seine Hand immer noch fest.
Ein zweiter Polizist eilte herbei. Er packte Cassie an den Schultern und versuchte, ihre fuchtelnden Arme festzuhalten, aber ohne viel Erfolg. Sie wehrte sich und warf den Kopf zurück. Dabei rutschte ihr Hut vom Kopf, und ihre üppigen blonden Locken fielen ihr über den Rücken, verfingen sich in der Mütze des Polizisten, wodurch seine Augen verdeckt wurden. Cassie umklammerte immer noch hartnäckig das Handgelenk des anderen Polizisten. Der riß verzweifelt die Hand zurück, um sich endlich aus Cassies Umklammerung zu lösen. Cassie ließ los, die Faust des Polizisten schnellte hoch und traf Cassie, ohne daß der Mann es beabsichtigt hatte, mitten auf die Backe.
»Cassie!« rief Linc und sprang vor.
Doch genau in diesem Augenblick war der Bürgermeister vor Linc getreten, weil er besser sehen wollte, was vor sich ging, so daß die beiden Männer zusammenstießen. Der Bürgermeister schwankte auf den Fußballen an der Kante der Tribüne. Nach Halt suchend, packte er Linc am Kragenaufschlag der Uniformjacke, aber es nützte nichts. Er stürzte von der Tribüne und riß Linc mit sich.
Der Bürgermeister ließ Lincs Jacke los und versuchte verzweifelt, mit einer Hand die Flaggendrapierung an der Tribüne zu erwischen. Tatsächlich gelang es ihm, das dünne Material zu fassen zu bekommen, aber da es nur mit Reißzwecken am Holz befestigt war, löste es sich sofort. Die zwei Männer hatten sich Halt suchend aneinander geklammert und landeten auf dem Boden. Linc kam zuoberst zu liegen und preßte mit seinem Gewicht dem Bürgermeister die Luft aus den Lungen; es gab ein Geräusch, als hätte man ein Ventil an einem Schlauch geöffnet.
Die Flaggendrapierung hatte sich wie ein Leichentuch um den korpulenten Leib des Bürgermeisters gewickelt; Linc mußte nur ein Bein befreien. Er riß sich fluchend los und kam auf die Knie. Die meisten Zuschauer waren aufgesprungen, und ein paar Frauen kreischten. Neben ihm keuchte der Bürgermeister und schnappte nach Luft; es klang, als wäre er am Ersticken. Aber Linc hatte nur Augen für das blonde Mädchen, das dem wütenden Polizisten ohnmächtig in die Arme gesunken war.
»Lassen Sie sie los. Sie Scheißkerl!« schrie Linc, als er endlich wieder auf den Beinen war und mit zornig geballten Fäusten über die Wiese lief.
Cassie öffnete die Augen und blickte in ein vertrautes Gesicht, das irgendwie zu dem pochenden Schmerz in ihrem Kopf dazuzugehören schien.
»Schon wieder Sie!« rief sie und unterdrückte einen Aufschrei, als sie den stechenden Schmerz an der Kinnbacke verspürte. Vorsichtig betastete sie die neue, rasch anschwellende Beule und sah Linc dabei böse an.
Linc Cameron lächelte. »Na, diesmal bin ich unschuldig. Ich war nur zufällig in der Nähe.«
Cassie sah sich um und bewegte dabei den schmerzenden Kopf so wenig wie möglich. Sie blickte in die Hinterhöfe einer Häuserzeile, auf zwei stinkende Aborte und Wäsche, die auf der Leine im Wind flatterte. Linc hockte auf einem Haufen Abfallholz und alter Ziegel, mitten in einem mit Unrat übersäten Gäßchen. Sie selbst lag halb auf dem Abfallhaufen, halb auf ihm – ihr Kopf ruhte in seinem Schoß.
Cassie setzte sich mit einem Ruck auf; die Folge war, daß sich alles um sie herum drehte, wie auf einem außer Kontrolle geratenen Karussell. Linc faßte sie an den Schultern und zog sie an seine Brust, um sie zu stützen. Sie schmiegte die Wange an den groben Stoff seines Uniformrocks. Es wirkte sehr beruhigend auf sie, seine Arme um ihre Schultern zu spüren und dem gleichmäßigen Schlag seines Herzens zu lauschen.
»Verdammt, Sie Scheusal, Sie!« murmelte sie. »Sie müssen sich überall einmengen! Sie haben alles ruiniert.«
»Sie sind undankbar. Ich konnte verhindern, daß man Sie ins Gefängnis steckte. Dafür werde ich wahrscheinlich dort landen, weil ich einem Polizisten in die ... in eine empfindliche Stelle getreten und einem anderen einen Schlag auf die Nase verpaßt habe. Davor hatte ich den Bürgermeister von Kingly von der Tribüne gestürzt.«
Cassie hatte keine Ahnung, wovon er sprach, aber es war ihr gleichgültig. Sie hatte ihre eigenen Probleme, wenn sie sich auch nur mit Mühe daran erinnerte, während er sanft ihre Schulter und den Nackenansatz massierte.
Schließlich machte sich Cassie los. Unsicher schwankend stand sie auf. Das einzige Kostüm, das sie besaß, hatte einen Riß, und jemand hatte die obersten drei Knöpfe aufgemacht. Sie funkelte Linc wütend an und versuchte dabei, mit einer Hand die Jacke zuzuknöpfen.
»Sie Narr! Ich wollte doch ins Gefängnis!«
»Tatsächlich?« Er wollte ihr mit den Knöpfen helfen.
Cassie dachte mit Grauen an den schrecklichen Monat, den sie bereits einmal im Gefängnis verbracht hatte, und verbesserte sich: »Nein ... eigentlich nicht. Aber wie sonst können wir wirksam auf die mißliche Situation der Frauen in diesem Land aufmerksam machen? Die ganze Sache ist allein Ihre Schuld.«
»Was ist meine Schuld?« Er raffte ihre Haare zusammen und schob sie ihr aus dem Gesicht. »Bei mir haben sich die Frauen bisher noch nie über ihre mißliche Lage beklagt.«
»Sie sind ein Mann, und ich erwarte daher nicht, daß Sie das verstehen.« Sie überging seine Bemerkung über seine Frauen, deren Zahl wahrscheinlich in die Tausende ging. »Sie haben für die Demokratie gekämpft, Monte Lane starb dafür, und trotzdem ist es Ihnen gleichgültig, daß in den so großartig demokratischen Vereinigten Staaten von Amerika Kriminelle, Verrückte und Frauen nicht wählen dürfen.«
»Damit befindet ihr euch doch in guter Gesellschaft.« Linc grinste.
Beinahe hätte sie auch gelacht. »Das war nicht witzig.«
»Ich dachte doch.«
»Sie sind vermutlich dagegen, daß Frauen das Wahlrecht bekommen.«
Linc zuckte die Achseln und stand auf. »Der Zustand, in dem sich die Welt derzeit befindet, ist schlimm genug; die Frauen könnten es nicht mehr schlimmer machen, als es ohnehin bereits ist.«
»Das ist eine typisch männliche Einstellung!« Cassie stemmte die Fäuste auf die Hüften und reckte das Kinn in die Höhe. »Sie gehören vermutlich zu jenen Idioten, die den Frauen am liebsten auch das Fliegen verbieten würden. Sie glauben wahrscheinlich, daß wir viel zu emotional sind, um ein Flugzeug zu fliegen, und beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten den Kopf verlieren.«
Er umfaßte ihr hochgerecktes Kinn mit den Fingern. »Ihre Vermutungen sind nicht fair. Wenn eine Frau fliegen will, soll sie fliegen. Ich habe nur Bedenken, wenn sie so verantwortungslos oder unvorsichtig ist, daß sie mit ihrem Flugzeug meines beinahe zum Absturz bringt.«
Cassie wurde rot. Warum mußte er immer recht behalten? Und warum fing sie immer gleich zu zittern an, sobald er sie berührte?
Linc hatte es so geschickt eingerichtet, daß Cassie mit dem Rücken gegen den Holzstoß lehnte und er vor ihr stand; sie konnte also nicht davonlaufen. Er hatte ihr Kinn losgelassen und streichelte zart über ihren Nacken. Seinen anderen Arm hatte er um ihre Taille gelegt, und mit seinem Handballen drückte er auf ihre Hüfte.
Cassie konnte ihren Blick einfach nicht abwenden. Noch nie hatte sie in so strahlend blaue Augen gesehen, die gleichzeitig so unendlich traurig wirkten. Sie hatte das Gefühl, daß diese Augen viel Schlimmes gesehen hatten und ihnen keine bittere Erfahrung erspart geblieben war.
»Es tut mir leid«, flüsterte sie, ohne genau zu wissen, was ihr leid tat, oder ob er sie überhaupt gehört hatte. Dann beobachtete sie wie hypnotisiert, wie er die Lider senkte und sich seine Lippen langsam den ihren näherten.
Sie drehte den Kopf fort. »Nicht«, bat sie, plötzlich atemlos.
»Nicht was?«
»Nicht küssen«, bat sie etwas lauter.
»Das wollte ich aber gerade machen«, entgegnete er.
Cassie schob ihn fort. »Nein, hören Sie auf. Ich meine es ernst.«
Linc hob den Kopf, ohne jedoch die Hand von ihrer Taille zu nehmen. »Ich habe geglaubt, Sie mögen mich.«
»Ha! Wie kommen Sie denn auf diese dämliche Idee?«
»Ach ...« Er lächelte sie unschuldig an und sah dabei wie ein kleiner Junge aus, aber Cassie ließ sich keinen Augenblick täuschen. »Eine Bemerkung von Ihnen.«
»Von mir? Was habe ich gesagt? Wann?«
»Sie sagten, ich wäre unglaublich toll!«
Cassie riß die Augen auf und konnte sogar überzeugend lachen. »Sie dachten, daß ich über Sie gesprochen habe? Ganz zufällig waren Sie nicht der einzige Mann, den ich gestern kennengelernt habe.«
»Sie haben an einem Tag gleich zwei unglaublich tolle Männer kennengelernt? Was für ein Glückspilz Sie sind!«
Ohne es zu wollen, brach sie in Gelächter aus. Linc zog sie an sich. »Ach, Cassie«, flüsterte er, bog ihren Kopf nach hinten und ließ seine Finger durch ihre Haare gleiten.
Als er ihre Lippen berührte, zuckte sie wie unter einem elektrischen Schlag zusammen und lag zitternd in seinen Armen. Sie wehrte sich nicht mehr. Sein Mund glitt über ihren, als wollte er sie verschlingen. Cassie war früher schon geküßt worden und hatte es immer angenehm gefunden, aber das war ... das übertraf alle ihre Vorstellungen. Es war wie ein Rausch.
Lincs Kuß wurde intensiver. Cassie öffnete sich ihm wie eine Blume. Das Gefühl war überwältigend. Sie wünschte, er würde sie in alle Ewigkeit küssen.
Schließlich ließ er von ihrem Mund ab und ließ seine Lippen zart über ihren Nacken spielen, daß Cassies Haut wie von Feuermalen brannte. Sie schmiegte sich zitternd an ihn.
»Linc«, flüsterte sie an seiner Schulter. »Ich möchte ...«
Er legte die Lippen an ihr Ohr. »Was möchtest du, Miss Cassandra Jones?«
Sie stieß ihn von sich und machte einen Schritt von im weg. Das war sehr seltsam, was hier geschah! Sie schien plötzlich den Verstand verloren zu haben.
»Ich möchte, daß Sie mich in Frieden lassen!« Cassies Stimme klang unsicher, obwohl sie sich bemühte, überzeugend zu wirken.
Linc betrachtete sie aufmerksam. »Sind Sie sicher, daß Sie das wollen?«
»Ja.«
Er legte die Hand kurz an seine Uniformmütze. »Dann guten Tag, Miss Jones!« Damit drehte er sich unvermittelt um, lief durch das Gäßchen davon und verschwand um die Ecke.
»Verdammt!« Cassie trat gegen eine verrostete Milchkanne und stieß sich dabei die Zehe an. »Verdammt, Linc Cameron, das war es gar nicht, was ich wollte!«