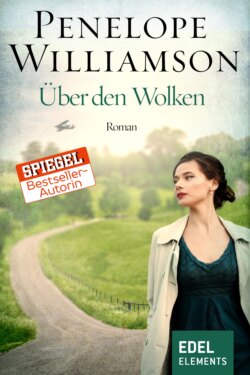Читать книгу Über den Wolken - Penelope Williamson - Страница 6
KAPITEL 3
ОглавлениеCassie öffnete die Tür zur Scheune und schlüpfte hinein. Sie blieb kurz stehen und sog den vertrauten Geruch ein – es stank nach Kastoröl, Schmiermittel und dem hochentzündlichen Lack, mit dem die Stoffteile des Flugzeugs imprägniert wurden, um eine steife, widerstandsfähige Oberfläche zu erzielen.
Quigly stand über die Werkbank gebeugt und suchte in seinen Werkzeugen herum. Bei seinem Anblick mußte Cassie lächeln; sie hatte ihn gern. Quigly war klein und schmächtig. Er hatte dunkelgraue, gelockte Haare und einen grauen, borstigen Schnurrbart. Cassie wußte nicht genau, wie alt er war; sie hielt ihn für ungefähr sechzig. Auf alle Fälle war er bereits ein junger Mann gewesen, als seine Schwester Sara, Cassies Mutter, zur Welt gekommen war. Er hatte Sara dann auch großgezogen, nachdem ihre Eltern bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen waren.
Auf einer großen Drehscheibe aus Holz lag die Maschine, an der Quigly gerade arbeitete. Die Leute hielten Quigly Jones für exzentrisch, weil er in einem Schuppen lebte und seine ganze Zeit und all sein Geld für die Erfindung seltsamer Dinge, wie motorisierte Fahrräder, elektrische Automobile und Flugzeuge, aufwandte. Aber Cassie bewunderte ihn.
Beim Eintreten war Cassie mit dem Fuß an einen Stein gestoßen, und Quigly sah flüchtig über seine Brillenränder hinweg zu ihr auf. Ihm entging weder ihr unordentlicher Aufzug, noch ihr aufgeschürftes Kinn.
»Was ist passiert, Kind? Du siehst aus, als hättest du dich mit einem Bären angelegt.«
Cassie lachte und küßte ihn auf seine stachelige Wange. »Den Bären solltest du einmal sehen!«
Das zurückhaltende, aber freundliche Lächeln, mit dem Quigly Cassie jetzt bedachte, war das äußerste, dessen er fähig war, seiner Erheiterung Ausdruck zu verleihen.
»Hast du den Kredit bekommen?« fragte Cassie.
Quigly antwortete nicht sofort. Er betrachtete den Motor mit einer Bewunderung, wie die meisten Männer sie nur für Frauen übrig hatten. Die Pioniere der Luftfahrt suchten die Grenzen ihrer Maschinen zu testen und wollten immer größere Entfernungen zurücklegen. Es wurden daher ständig stärkere Motoren benötigt, damit die mit Treibstoff schwer beladenen Maschinen vom Boden abheben konnten. Quigly Jones war überzeugt, daß der Motor, den er baute, dieses Problem lösen konnte. Vergangene Woche war er in Richmond gewesen und hatte sich um die dringend notwendige Finanzierung für seine Erfindung bemüht.
»Quigly«, begann Cassie neuerlich geduldig; sie war an die geistesabwesende Verträumtheit ihres Onkels gewöhnt. »Hast du den Kredit bekommen?«
Er sah auf und schüttelte den Kopf.
»Ach, zu dumm!« rief Cassie aus. Sie brauchten das Geld dringend. Wenn sie nicht bald welches auftrieben, konnten sie den Plan, mit dem Motor eine kleine Serienproduktion zu beginnen, aufgeben. Cassie schätzte, daß sie ungefähr zehntausend Dollar für den Anlauf der Produktion von Quiglys Motor benötigten; zusammen besaßen sie ungefähr zehn Dollar. »Diese Narren in Richmond würden nicht einmal dann eine vielversprechende Idee erkennen, wenn sie sie anspringt und in den ...«
»...in die Nase beißt«, ergänzte Quigly, wohlwissend, welches Wort sie andernfalls gebraucht hätte.
»Was machen wir jetzt, Quigly?«
Er zuckte die Achseln und strich sich über den Schnurrbart. »Es wird sich bestimmt etwas ergeben. Irgendwie löst sich immer alles.«
Plötzlich schnippte er mit den Fingern, zog eine zusammengerollte Zeitung aus der hinteren Hosentasche und entfaltete sie. Er reichte sie Cassie und zeigte mit ölverschmierten Fingern auf eine Schlagzeile. »Das könnten wir vielleicht versuchen.«
Aber Cassie beachtete die gedruckten Worte gar nicht. Ein Foto hatte ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen: ein Bild von Linc Cameron. Im Untertitel dazu stand fett gedruckt sein Name und darunter in etwas kleineren Buchstaben: Fünfundzwanzig Abschüsse. Cassie brauchte nur sein lachendes Gesicht anzusehen, und schon vollführte ihr Herz die seltsamsten Sprünge.
»Der Wettbewerb findet erst Anfang Mai statt«, überlegte Quigly. »Wir hätten für die Vorbereitungen mehr als zwei Monate Zeit. Die Teilnahme an einem Wettfliegen über diese Distanz kostet verdammt viel Geld, und wir müßten die Kosten selbst tragen. Falls wir verlieren, ist das ganze Geld dahin. Cassie?«
»Äh? Ja?«
Er griff nach der Zeitung. »Ist bei dir alles in Ordnung? Vielleicht sollten wir später darüber reden.«
»Nein!« Cassie holte sich die Zeitung wieder zurück. »Mir geht es gut, und wenn ich nicht ständig von unbeherrschten Kerlen Kinnhaken bekäme, ginge es mir noch besser.«
Sie überflog rasch den Artikel. Leroy Irving Bean, der mit einem Sodagetränk, genannt Bean’s Cola, ein Vermögen verdient hatte, sponserte einen Fliegerwettbewerb quer über den Kontinent. Er war für einmotorige Flugzeuge mit einer zweiköpfigen Besatzung ausgeschrieben. Die Gesamtdistanz war in sechs Teilstrecken unterteilt. Start war in Santa Monica, Kalifornien, Ziel auf Long Island im Staat New York. In fünf anderen Städten an der Strecke waren Kontrollstationen vorgesehen. Für jede Teilstrecke wurde eine Zwischenzeit genommen, und der Teilnehmer mit der geringsten Gesamtzeit war der Gewinner. Als Preis –
»Fünfzigtausend Dollar!« rief Cassie und starrte Quigly an.
Er setzte sein scheues Lächeln auf und nickte. »Das würde uns ein wenig über die Runden helfen.«
Das würde uns nicht nur über die Runden helfen, dachte Cassie. Mit fünfzigtausend Dollar könnten sie einen Prototyp des Motors bauen und ihn vorführen – vielleicht in England. Cassie war mit den Gedanken schon weit voraus und gab das Preisgeld bereits aus. Europa war Amerika auf dem Gebiet der Luftfahrt in der technischen Entwicklung überlegen. Die Vorführung würde andere Investoren ermutigen. Cassie stellte sich bereits den riesigen Hangar vor, in dem eine Heerschar von Arbeitern Quiglys Motoren bauten.
Sie strahlte ihren Onkel an. »Ach, Quigly! Fünfzigtausend Dollar!«
»Davor müssen wir nur eine Kleinigkeit erledigen: Wir müssen den Wettbewerb gewinnen.«
Cassie lachte und zuckte die Achseln, als handelte es sich dabei tatsächlich um eine Kleinigkeit. Sie breitete die Zeitung auf der Werkbank aus, um den Artikel über den Wettbewerb genauer zu lesen.
Mehrere berühmte Flieger hatten ihre Teilnahme an dem Wettfliegen bereits zugesagt, auch – und diesen Absatz las Cassie langsam und genau – Linc Cameron, der amerikanische Kampfflieger. In einer Kunstflugvorführung vor dem eigentlichen Start würden Cameron und andere Piloten todesmutige Bravourstücke vorführen.
Cassie rümpfte die Nase, als sie das las. Es überraschte sie nicht, denn in ihren Augen war er der Typ Mann, der nicht widerstehen konnte, wenn sich eine Gelegenheit bot, seine Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Wie todesmutig konnten seine Kunststücke schon sein, wenn er gestern so hysterisch darauf reagiert hatte, als sie beinahe zusammengestoßen wären. Dabei hatte sie ihn doch um fast zwanzig Zentimeter verfehlt! Was den Wettflug anging, so irrte er sich, wenn er glaubte, er könnte mit den fünfzigtausend Dollar davonfliegen; da kannte er seine Mitbewerber schlecht. Cassie Jones wollte sich mit Linc Cameron unter gleichen Bedingungen messen – und ihn schlagen.
Quigly beugte sich wieder über seinen Motor und arbeitete am Vergaser. Cassie nahm die Petroleumlampe von der Werkbank und hielt sie über Quiglys Kopf, damit er besseres Licht hatte. Die Scheune hatte keine Fenster, und es war daher fast immer dunkel hier.
»Quigly«, begann Cassie aufs neue. Er brummte, was sie als Aufforderung nahm, fortzufahren. »Warst du je verliebt?«
Die Antwort ließ so lange auf sich warten, daß Cassie schon glaubte, Quigly hätte sie nicht gehört. Doch er überlegte sich ganz genau, was er sagen wollte.
»Ich glaube ja, einmal. Vor sehr, sehr langer Zeit.« Er hob resignierend die Schultern. »Es ist nichts daraus geworden. Verliebtheit ist eine Krankheit, die einen meist nur in der Jugend befällt.«
»Wie weiß man, daß man die Krankheit hat? Wie weiß man, daß man verliebt ist?«
»Nun ja, zuerst einmal muß man ständig an die betreffende Person denken. Man plant ständig, was man bei der nächsten Begegnung tun und sagen wird. Das ist reine Zeitverschwendung, denn wenn man den Menschen dann wiedersieht, benimmt man sich trotzdem wie ein Narr.«
Cassie nickte wissend. »Im Bauch scheinen Flöhe zu hüpfen, wenn der Mensch in der Nähe ist, und der Mund wird trocken. Man hat keine Spucke und bringt kein Wort heraus. Dabei ist man wütend auf den Menschen, weil er an diesem Zustand Schuld trägt, und man sagt häßliche, dumme Sachen, die einem später leid tun. Ist es das?«
Quigly richtete sich auf und sah sie über den Rand seiner Brille eindringlich an. »Ich glaube, dich hat es ganz arg erwischt, mein Kind.«
»Wie recht du hast, Quigly. Es hat mich plötzlich überfallen. Wie wird man es wieder los?«
Noch ehe Quigly antworten konnte, erklang das Motorengeräusch eines Autos, und Steine knirschten unter den Reifen. Cassie erschrak und wurde rot.
»Wer das wohl sein mag?« fragte Quigly.
Cassie blickte in panischem Entsetzen auf das Scheunentor. »Ich ...«
»Sieh besser nach, wer es ist. Vielleicht ist es jemand Wichtiges.«
»Ich ...«
Quigly nahm ihr die Lampe aus der Hand und versetzte ihr einen zarten Stoß. »Geh, Kind. Für deine Krankheit gibt es keine Heilung. Entweder hat es dich so arg erwischt, daß du es gar nicht loswerden willst, oder du kommst ganz von allein darüber hinweg, nachdem du mit der betreffenden Person ausreichend oft und ausreichend lang zusammen warst. Es ist so ähnlich wie Windpocken. Vielleicht bleiben ein paar Narben zurück, aber du überlebst die Geschichte.«
Cassie nickte und schluckte. Sie drehte sich um und ging zum Tor. Quigly lächelte.
Edward Farrell sprang aus dem grünen Sportwagen; sein weißer Seidenschal flatterte im Wind. Er hatte eine getupfte Fliege umgebunden, trug ein Tweedjackett, eine Flanellhose, Wildlederhandschuhe und auf dem Kopf eine braune Melone. Er grinste über das ganze Gesicht. Cassie begrüßte ihn mit einem strahlenden Lächeln und redete sich ein, daß der alte Freund, den sie schon seit ihrer Kindheit kannte, genau der Mensch war, den sie jetzt sehen wollte.
»Ward! Ich habe dich seit Wochen nicht gesehen.« Sie schob ihren Arm durch seinen, als er sich zu ihr hinunterbeugte und ihr einen zarten Kuß auf die Wange drückte. »Du hast mir gefehlt. Wo bist du gewesen?«
Er sah sie erstaunt an, lachte und schüttelte den Kopf. »Du überraschst mich, Cassie! Wirklich!«
»Warum? Wie meinst du das?«
»Als ich das letzte Mal hier war, bat ich dich auf Knien, mich zu heiraten. Du hast mich abgewiesen. Ist es dir nicht in den Sinn gekommen, daß es mir peinlich gewesen wäre, früher zu kommen? Ein solcher Masochist bin ich nicht.«
Cassie fühlte sich schuldig, und es tat ihr leid. Ward Farrell war der letzte Mensch, dem sie Kummer bereiten wollte. Sie waren zusammen aufgewachsen, und Ward war immer nett zu ihr gewesen. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte sie geglaubt, die ganze Welt hätte sich gegen sie verschworen, nur Ward hatte immer zu ihr gehalten. Aber als er sie zu Weihnachten gebeten hatte, ihn zu heiraten, war sie entsetzt gewesen. Cassie hatte nie in Erwägung gezogen, daß sich ihre Freundschaft – eine Freundschaft aus kindlichen Geheimnissen und geflüsterten Träumen – in Liebe verwandeln könnte. Zumindest nicht in die Liebe, wie sie für Mann und Frau typisch ist.
Sie bemühte sich, Worte zu finden, die seinen Schmerz linderten. »Wir könnten doch gar nicht heiraten, Ward«, tröstete sie. »Es ist vermutlich illegitim. Cousin und Cousine ersten Grades können nicht heiraten.«
Er schüttelte den Kopf. »Cassie, Cassie ... jeder in Kingly weiß, daß wir nicht blutsverwandt sind. Wir könnten, so wie wir sind, in die Stadt fahren und das Aufgebot bestellen; keiner würde mit der Wimper zucken.«
Cassie wandte den Blick ab; seine Logik war unwiderlegbar. Der Mann ihrer verstorbenen Mutter, Lawrence Kingly, war zu den Farrell-Kindern wohl ein Onkel mütterlicherseits, aber die ganze Stadt wußte, daß Cassie Jones nicht das Kind von Lawrence Kingly war.
Sie seufzte. »Ach Ward, ich dachte, wir hätten das zu Weihnachten alles geklärt. Es hat nichts mit meinen Gefühlen für dich zu tun, daß ich dir einen Korb gegeben habe. Ich habe dich gern, Ward ...«
»Wirklich?«
»Natürlich. Und wenn ich je heiraten sollte, dann würde ich bestimmt dich zum Mann nehmen. Aber du weißt, wie ich darüber denke. Ich werde nie heiraten, Ward. Niemals.«
Er seufzte trotzdem. »Ich weiß, wie du darüber denkst... und ich verstehe es ja auch.« Sie bogen in die Straße entlang dem Feld ein. »Aber du solltest die Ehe nicht nach den Erfahrungen deiner Mutter beurteilen. Die Ehe kann doch nicht so schlecht sein, wenn die Menschen seit Tausenden von Jahren Ehen führen.«
»Das hat nur deshalb funktioniert, weil der Mann in der Ehe nicht nur eine Gefährtin findet, sondern gleichzeitig eine unbezahlte Köchin und Wäscherin, Dienstmagd, Näherin und Mutter seiner Kinder. Die Frauen gewinnen durch die Ehe nur einen Herrn. Warum sollte ich einem Mann das Recht einräumen, mir zu sagen, wann ich was tun soll?«
»Gar nicht davon zu reden, wie du es tun sollst, warum und mit wem.«
Cassie lachte. Sie waren bei einem alten, verwitterten Baum stehengeblieben. Edward ließ seinen Arm sinken und lehnte sich gegen den knorrigen Baumstamm. »Solange ich dich zum Lachen bringe, kann ich immer noch hoffen. Ich werde nie aufgeben, Cassie. Ich habe dich nicht bloß gern, ich liebe dich.«
Er beugte sich vor und küßte sie. Sie ließ es zu; sie wehrte sich auch nicht, als er die Arme um ihre Taille legte und sie an sich zog. Sie hatten sich früher schon geküßt, aber Cassie hatte diesen harmlosen Küssen nie eine besondere Bedeutung beigemessen – bis heute. Sie wollte vergleichen, was sie bei Wards Küssen empfand und was sie empfunden hatte, als Linc Cameron sie heute vormittag in die Arme genommen hatte.
Es waren zwei verschiedene Dinge.
Cassie entzog sich ihm, und sie sahen einander in die Augen. »Es tut mir leid, Ward«, flüsterte Cassie, als sie seinen enttäuschten Gesichtsausdruck bemerkte.
»Ja, es tut mir auch leid. Mir tun viele Dinge leid.« Er wandte den Blick ab, nahm seinen Hut vom Kopf und fuhr sich mit den Fingern durch die zusammengedrückten Haare. »Weißt du, daß ich wahrscheinlich einen weiteren Kredit aufnehmen muß, damit ich die Setzlinge für nächstes Jahr pflanzen kann? Alle sind wild auf Zigaretten, und die Nachfrage nach Tabak ist heute so groß wie seit hundert Jahren nicht. Ich habe Berge von Tabak gelagert und schaffe es trotzdem nicht, daß die Plantage sich selbst trägt.«
»Das ist doch nicht dein Fehler, Ward«, protestierte Cassie. Sie wußte, wieviel Ward die Plantage bedeutete. Er war in dem Glauben erzogen worden, das stolze Vermögen der Familie Farrell retten zu müssen. Cassie hatte Ward immer bedauert, weil ihm so jung eine solche Bürde aufgeladen worden war. Sie versuchte, ihm ein Lächeln zu entlocken. »Du hast mir doch erzählt, daß die Plantage der Farrells ein Verlustgeschäft ist, seit sich die Familie seinerzeit im Bürgerkrieg auf die falsche Seite gestellt hatte.«
»Das schon. Aber ich fürchte, daß ich nach dem Tod meines Vaters noch mehr Unheil angerichtet habe. Egal, was ich unternehme, wir verschulden uns immer mehr.«
»Dann solltest du besser einem Mädchen mit einem reichen Vater einen Heiratsantrag machen, nicht mir.«
Er lächelte traurig. »Vielleicht hast du recht.«
»Du kannst immer noch am Bean’s Cola-Wettbewerb teilnehmen«, schlug Cassie vor.
Er sah sie verständnislos an. »Was für ein Wettbewerb?«
Sie erzählte ihm von dem transkontinentalen Wettfliegen und dem Preisgeld von fünfzigtausend Dollar. »Quigly und ich wollen daran teilnehmen. In dem Artikel steht außerdem, daß dein Freund, Mr. Cameron, auch mitfliegen wird.«
Wards anfängliche Begeisterung über den Bewerb verflog schnell wieder, und er zuckte lachend die Achseln. Cassie kannte ihn gut genug, um zu wissen, daß es ein gezwungenes Lachen war. »In dem Fall brauche ich gar nicht teilzunehmen. Linc steckt jeden Piloten, den ich kenne, in die Tasche.« Er tippte ihr an die Nasenspitze. »Du bist vielleicht die einzige Ausnahme«, fügte er hinzu.
Cassie lächelte über sein Kompliment; sie fielen in ein vertrautes Schweigen. Cassie wollte Ward über Linc Cameron ausfragen. Sie wußte, daß er bei den Farrells wohnte und daß er und Ward in Fankreich gemeinsam Kampfeinsätze geflogen waren. Die ganze Stadt redete davon, was für ein tolles Flieger-As Linc Cameron im Krieg gewesen war. Cassie wollte von Ward wissen, wie der Mann wirklich war. Woher kam er? Wie lange wollte er in Kingly bleiben? Hatte er irgendwo eine Freundin? ...
»Was bedeutet dir Linc Cameron eigentlich?« fragte Edward unvermittelt, und Cassie erschrak, weil er ihre Gedanken so geschickt erraten hatte.
»Äh ... nichts. Ich habe ihn erst gestern kennengelernt.« Sie zwang sich zu lächeln. »Melodie hat dir vermutlich erzählt, was passiert ist. Das Zusammentreffen stand unter keinem besonders glücklichen Stern. Warum fragst du?«
Edward betrachtete sie eingehend, und Cassie fürchtete bereits, daß er ihre Gefühle ebenfalls erraten würde.
»Du mußt ihm etwas bedeuten«, antwortete Ward. »Linc ist stolz auf seine Selbstkontrolle, und ich habe noch nie erlebt, daß er die Beherrschung verlor. Aber als er sah, wie dich der Polizist schlug, rastete er aus. Wenn man bedenkt, daß ihr euch erst gestern kennengelernt habt, war seine Reaktion schon ungewöhnlich heftig.«
Cassie trat nach einem Grasbüschel. »Merk dir eines, Ward Farrell: Ich kann Linc Cameron nicht ausstehen und werde ihn nie ausstehen können. Er ist dein Freund, und er ist ein Held und was sonst noch, aber ich finde ihn hochmütig, anmaßend, unerträglich. Ich habe mich noch nie derart über einen Mann geärgert wie über ihn. Von mir aus kannst du ihm das auch sagen.«
Edward hob die Hände vor sein Gesicht und lachte. »He! Ich liebe dich, vergiß das nicht! Linc wird von mehr als genug Frauen verehrt. Von mir aus kannst du Linc Cameron bis an das Ende der Welt ablehnen.«
Cassies Blick wanderte über die Wiese hinüber zur Pegasus, die unweit der Scheune vertäut war. Edward erzählte ihr, was er gegen den drohenden Bankrott der Tabakplantage zu unternehmen gedachte, aber sie hörte nicht zu; der Text eines dummen Liedes ging ihr im Kopf herum: Wann wird wohl meine Hochzeit sein ... o Hochzeit sein. Wann wird wohl meine Hochzeit sein ...
Sie hatte Ward nicht wirklich angelogen. Sie hatte ihn gern. Aber gern haben und lieben waren nicht dasselbe. Man konnte jemanden sogar hassen und ihn trotzdem lieben. Das waren die zwei Seiten ein und derselben Sache. Was ihr aber an der Liebe wirklich Angst einjagte, war die Tatsache, daß die Liebe meistens zur Ehe führte. Dann dauerte es nicht lang, und die Liebe verlor ihren Glanz, wie Silber, das schwarz wurde; was blieb, war die Ehe – zwei Menschen, die gemeinsam in einer Falle saßen, die einander bekämpften und einander haßten.
Wann wird wohl meine Hochzeit sein ... o Hochzeit sein ...
Sie würde nie heiraten. Es war ihr gleichgültig, ob man sie eines Tages als alte Jungfer bedauern würde. Unwillkürlich hob Cassie stolz das Kinn in die Höhe. Deshalb war sie als Frau nicht weniger wert, nur weil sie es vorzog, nicht rechtmäßig den Namen – und den Ring – eines Mannes zu tragen und von seinem Geld zu leben. Wenn die Liebe unweigerlich zur Ehe führte, dann wollte sie mit der Liebe nichts zu tun haben, denn sie hatte erlebt, wie es war, wenn einst strahlende Liebe dunkel und bitter wurde. Sie hatte gesehen, wie das Leben ihrer Mutter zur Hölle auf Erden geworden war, alles nur wegen der Liebe und der Ehe. Davon wollte sie nichts wissen.
Liebe und Ehe – sie waren der Fluch im Leben einer Frau.
»Gut, daß der Bürgermeister und Ward alte Freunde sind«, lachte Melodie; wenn sie lachte, zeigten sich Grübchen auf ihren Wangen. »Sonst könnten Sie heute abend bei Brot und Wasser dasitzen, Linc, statt diese köstliche Ente zu essen, die unsere Köchin für uns gebraten hat.«
Linc griff nach dem Whiskyglas, prostete Edward Farrell belustigt zu und lächelte. Sie saßen in einem kleinen, gemütlichen Salon im weitläufigen, eleganten Haus der Farrells und genossen die neueste Modeerscheinung im Land – Cocktails vor dem Dinner.
Ward erwiderte Lincs Zutrunk. Er ließ Linc in dem Glauben, daß es ihm. Ward, zu verdanken war, wenn der Bürgermeister ein Auge zugedrückt und Lincs Angriff auf einen Polizisten von Kingly nicht weiter verfolgen lassen wollte. In Wahrheit wollte jedoch niemand einen Mann verhaften, dem Präsident Wilson persönlich erst unlängst eine Tapferkeitsmedaille an die Brust geheftet hatte.
Nicht, daß Ward Linc den Ruhm neidete, den ihm sein Mut eingebracht hatte. Er hätte nur gern gehabt, daß ein bißchen davon auch auf ihn abfärbte. Er dachte dabei daran, was er Cassie am Nachmittag erzählt hatte, nämlich daß er neuerlich einen Kredit aufnehmen mußte, um im nächsten Jahr über die Runden zu kommen. Das Problem dabei war nur, daß die Plantage schon schwer mit Hypotheken belastet war und es nicht leicht sein würde, einen neuen Kredit aufzutreiben. Bei einem berühmten Kriegshelden, wie Linc Cameron einer war, würden sich die Banken gegenseitig überbieten, um ihm Geld zu borgen. Das erinnerte Ward an etwas ...
Er stand auf und ging zum Schreibtisch in der Ecke des kleinen Salons, griff nach der Ausgabe der Richmond News vom Vortag, entfaltete sie und brachte sie Linc und seiner Schwester, die nebeneinander auf dem Sofa saßen. Linc erzählte Melodie von Paris, und sie hörte ihm mit verträumtem Gesicht zu. Ward registrierte ihren mondsüchtigen Blick mit leichtem Widerwillen.
Er hielt seinem Freund die Zeitung unter die Nase. »Warum hast du mir nichts davon erzählt?«
Melodie beugte sich über Lincs Schulter, und alle drei starrten auf Lincs Foto und den Artikel über den Flugwettbewerb von Bean’s Cola.
»Fünfzigtausend Dollar!« rief Melodie aus. »Hast du das gesehen Ward? Das Preisgeld beträgt fünfzigtausend Dollar!«
»Linc wollte die Neuigkeit offenbar für sich behalten. Vielleicht hofft er, daß er den Wettbewerb um so eher gewinnt, je weniger Konkurrenten daran teilnehmen.« Ward gab sich keine Mühe, seine Erbitterung zu verbergen.
Linc sah den Freund an. »Es ist mir nie in den Sinn gekommen, daß du dich dafür interessieren könntest, Ward. Du hast immer gesagt, daß du nie mehr in eine Pilotenkanzel kriechen willst, sobald der Krieg einmal vorüber ist.« Er zuckte mit den Schultern. »Um ehrlich zu sein, die Leute von Bean’s Cola sprachen mich erst vor ein paar Tagen darauf an, ob ich nicht an dem Wettfliegen teilnehmen wollte. Wenn ich nicht vollkommen abgebrannt wäre und das Geld dringend brauchte ...«
Ward winkte ab und verschüttete dabei seinen Cocktail. »Glaubst du, ich könnte es nicht brauchen? Hast du eine Ahnung, wieviel es kostet, einen Besitz von dieser Größe zu erhalten? Zum Teufel! Ich wollte wirklich nie wieder fliegen. Aber wer kann sich die Chance entgehen lassen, fünfzigtausend Dollar zu gewinnen?« Er lächelte Linc plötzlich an. »In dem Artikel steht, daß ein Team aus zwei Personen bestehen muß. Du brauchst einen Kopiloten; warum bilden wir nicht ein Team?« Er lachte. »Es wird wie in alten Tagen sein, als du, Monte und ich im Krieg waren. Wir teilen uns die Kosten und das Preisgeld, jeder die Hälfte. Was hältst du davon?«
Linc schwieg einen Augenblick, dann seufzte er. »Es tut mir leid, Ward ... ich habe bereits Pete Striker gebeten, mein Kopilot zu sein.«
»Ach so ...« Ward gab sich Mühe, seine Enttäuschung nicht zu zeigen. »Es war nur eine Idee. Aber du hast recht, nach zwei Jahren hängt mir die Fliegerei ohnehin zum Hals heraus.« Er zwang sich zu einem Lächeln. »Außerdem habe ich einen reichen Onkel, der wahrscheinlich bald ins Gras beißen wird. Ich war immer schon der Meinung, daß man durch eine Erbschaft am einfachsten zu Geld kommt.«
Melodie seufzte hörbar. »Ich hoffe, du fängst nicht wieder davon an. Ward. Du weißt doch, Mama hat es immer für unhöflich gehalten, vor Gästen über so banale Dinge wie Geld oder Erbschaften zu sprechen.«
»Vor mir kann Ward ruhig auf Förmlichkeiten verzichten, Miss Farrell.« Linc lächelte Ward so warm und aufrichtig an, daß dessen Zorn und Schmerz im Nu vergessen waren.
Melodie lachte anmutig. »In diesem Fall sollten Sie auch mir gegenüber die Förmlichkeiten weglassen.« Sie sah ihren Bruder schmollend an. »Ward, mein Lieber, gestatte doch Linc, mich Melodie zu nennen. Wenn er mich ›Miss Farrell‹ ruft, komme ich mir wie eine alte Jungfer vor.«
Ward entgegnete neckend: »Ich glaube, Linc muß sich erst daran gewöhnen, wieviel sich hier zu Hause während unserer Abwesenheit verändert hat. Ihr modernen jungen Damen macht ja den armen Linc richtig kopfscheu.«
»Sie dürfen mich nicht mißverstehen, Linc«, verteidigte sich Melodie, »ich bin nicht wirklich modern. Auf keinen Fall bin ich eine aufrührerische Suffragette wie Cassie Jones.«
Ward entging es nicht, wie bei der Erwähnung von Cassies Namen plötzlich Lincs Interesse erwachte. »Ist sie eigentlich immer so gewesen?« fragte Linc.
»Wie?« Ward gab vor, nicht zu wissen, was er meinte.
»Nun ja, ich weiß nicht...« Linc zuckte die Achseln. »So wild.«
Ward betrachtete eingehend sein Glas mit dem Whisky-Soda. »Wild ist eine sehr passende Beschreibung für Cassie. Um bei dem Thema zu bleiben, welche Absichten hast du ihr gegenüber?«
Linc hob überrascht den Kopf. »Ich kenne sie noch nicht lang genug, um irgendwelche Absichten zu haben. Warum? Bist du ...«
»Nicht was du glaubst«, beeilte sich Ward zu sagen. Linc sollte auf keinen Fall erfahren, daß er um Cassies Hand angehalten – und daß sie ihn abgewiesen hatte. »Von ihrem verrückten Onkel abgesehen, bin ich ihr nächster Verwandter und fühle mich in gewisser Weise verantwortlich für sie. Cassie ist ... sie ist einfach nicht wie andere Mädchen. Sie ist leicht verletzbar.«
»Erstens wußte ich nicht, daß ihr beide verwandt seid«, entgegnete Linc steif. »Außerdem ...«
»Ach bitte, Ward!« mischte sich Melodie ein. »Was willst du damit erreichen? Linc bekommt einen vollkommen falschen Eindruck. Cassie ist nicht mit uns verwandt. Formal gesehen kann man sie als unsere Cousine bezeichnen, aber in Wirklichkeit sind wir nicht verwandt. Unser Onkel Lawrence war mit ihrer Mutter verheiratet, aber ganz Kingly weiß es, Cassie ist ein ... nun, ich soll das Wort nicht verwenden, aber ...«
»Ein illegitimes Kind«, erklärte Ward. »Und die ganze Stadt sorgt dafür, daß sie es nicht vergißt. Damit hast du schon einen Gutteil der Erklärung dafür, warum Cassie so ist, wie sie ist.« Im Haus läutete eine Glocke. Ward stand auf und leerte sein Glas; er war froh, das Thema Cassie Jones beenden zu können. »Das Essen ist fertig.«
Linc erhob sich und bot Melodie seinen Arm. Sie strahlte ihn lächelnd mit ihren hellbraunen Augen an. Ward folgte ihnen ins Speisezimmer.
Wie alle unverheirateten jungen Frauen in Kingly, fand seine Schwester Linc offenbar äußerst attraktiv. Ward wußte nicht, ob das Interesse auf Gegenseitigkeit beruhte. Trotz aller Freundschaft hatte er immer mit Linc Cameron konkurriert, aber sie hatten so viel zusammen erlebt, daß sie einander nahestanden wie Brüder. Unter normalen Umständen hätte er nichts dagegen gehabt, Linc Cameron zum Schwager zu bekommen. Aber Linc hatte zugegeben, daß er keinen Pfennig besaß. Er hatte nur selten von seiner Familie gesprochen, aber Ward bezweifelte, daß die Camerons, wer sie auch sein mochten, finanziell gut gestellt waren. Nein, so gern Ward Linc auch hatte, es kam nicht in Frage, daß er in die Familie Farrell einheiratete.
Es sei denn, Linc gewann tatsächlich die fünfzigtausend Dollar...
Linc Cameron schaltete das Licht im Gästezimmer ein und schloß die Tür. Patches lag ausgestreckt vor dem Kaminfeuer, öffnete ein Auge, wedelte faul mit dem Schwanz und schlief wieder ein.
Linc zog das Jackett des Abendanzugs aus und warf ihn auf das Bett. Dann lockerte er die Krawatte und knöpfte erleichtert den hohen, gestärkten Kragen auf. Normalerweise hätte er die Gesellschaft der Farrells genossen. Ward brachte ihn immer zum Lachen, und es war ein Vergnügen, Melodie anzusehen. Aber er hatte sich während des Essens nur danach gesehnt, allein zu sein.
Unruhig ging er im Zimmer auf und ab, blieb neben dem Beistelltischchen mit den dünnen Beinen stehen und goß sich aus einer Kristallkaraffe einen kräftigen Schluck Whisky ein. Der Staat Virginia hatte zwar bereits vor dem Krieg gesetzlich die Prohibition eingeführt, aber die Farrells standen anscheinend über dem Gesetz, denn hier im Haus mangelte es nicht an erstklassigen Spirituosen.
Linc genoß den Whisky und ließ ihn lange im Mund, ehe er ihn hinunterschluckte. Dabei dachte er über die beiden kurzen Begegnungen mit Miss Cassandra Jones nach. Sie war ihm den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gegangen.
So wie er Cassie kennengelernt hatte, schien sie ihm ein faszinierendes Gemisch aus Rauhbeinigkeit und süßer Unschuld zu sein. Sie hatte ihn geküßt und sich wie eine schnurrende Katze an ihn geschmiegt, und im nächsten Augenblick schon hatte sie ihn mit ihren großen grauen Augen angesehen, als hätte er versucht, sie zu ... Ach, zum Teufel! Er zuckte die Achseln. Die Frauen spielten doch alle ihre Spielchen mit der Liebe. Vielleicht war Cassie Jones bei diesem Spiel nur viel geschickter als die meisten anderen.
Linc legte sich auf das Bett und stellte das Whiskyglas auf seinem Bauch ab. Aber er hielt es nicht lange aus und ging schon bald wieder auf und ab. Er öffnete das bis zum Boden gehende Fenster und trat auf die Veranda, die rund um das Obergeschoß des Hauses lief. Unter ihm dehnte sich die Rasenfläche bis zum Flußufer hinunter, wo die Zweige der Platanen im Wind raschelten. Da er nur ein dünnes Hemd trug, fröstelte ihn bald in der frischen Winterluft.
Heute abend war er rastlos und auf merkwürdige Weise innerlich erregt. Und daran waren nur diese verdammten grauen Augen schuld! Wenn er eine Spur von Vernunft besäße – was vermutlich nicht der Fall war –, würde er so weit wie möglich vor diesen Augen fliehen. Cassie war genau der Typ Frau, mit dem er letztlich nicht auskam, der ihn aber unweigerlich anzog. Aus den Jahren mit Ria hatte er zumindest die eine Lehre gezogen, daß eine Frau wie Miss Cassandra Jones nur Probleme brachte.
Es raschelte, und Linc schreckte aus seinen Überlegungen auf. Er sah sich um. Die weißen Korbmöbel leuchteten gespenstisch im Mondschein. Eine helle Gestalt löste sich plötzlich von einem der Stühle.
»Melodie!« rief er heftiger als beabsichtigt. »Was machen Sie hier draußen?«
»Das gleiche wie Sie. Ich hörte ein Kratzen und dachte, es ist vielleicht ein Waschbär. Diese kleinen Tiere kommen manchmal ins Haus und suchen sich etwas zu fressen.«
»Es war kein Waschbär, sondern ich. Ich mußte noch etwas frische Luft schnappen.«
Melodie zitterte und hielt die Arme fest vor dem Oberkörper verschränkt. Ihre schwarzen Haare glänzten im Licht des Mondes, und ihre Augen funkelten. »Es ist kalt hier draußen.«
Linc holte eine kleine Decke von einem Stuhl neben der offenen Tür, legte sie Melodie um die Schultern und zog die Enden fürsorglich unter ihrem Kinn zusammen. Sie hob ihm das Gesicht entgegen und erwartete seinen Kuß. Er beugte den Kopf, um ihre Erwartungen zu erfüllen, hielt dann aber inne. Er ließ die Enden der Decke los und drehte sich um.
»Linc?« rief sie mit leise flehendem Ton. »Ist es wegen Monte?« Sie legte ihm die Hand auf den Arm. »Ich kann mir vorstellen, was Sie denken, Linc. Weil Monte und ich verlobt waren, glauben Sie, daß ich ihm gehöre. Sie sind ein sehr loyaler Mensch. Aber Monte ist tot. Er ist tot, und wir leben. Es würde ihn glücklich machen, wenn er wüßte, daß wir einander trösten. Glauben Sie nicht, daß er glücklich wäre?«
Linc sah in ihr wunderschönes Gesicht und spürte, wie ihn die vertraute Schwäche überkam. »Nein, Miss Farrell. Ich glaube nicht, daß er glücklich darüber wäre.«
Melodie umklammerte seinen Arm fester und zwang ihn, sie anzusehen. »Sie reisen morgen wieder ab, nicht wahr?«
»Ja.«
Melodie seufzte leise und zeichnete mit den Fingern seine Lippen nach. »Ich kann es kaum glauben, daß ein tapferer Flieger wie Sie vor mir davonläuft, wo ich doch nur eine kleine, schwache Frau bin.«
»Sie mögen klein und schwach sein, aber Sie haben mich zu Tode erschreckt.« Es war eine Lüge. In Wahrheit lief er nicht vor Melodie Farrell davon, sondern vor zwei grauen Augen.