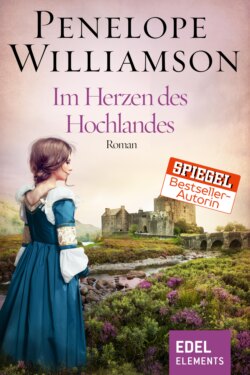Читать книгу Im Herzen des Hochlandes - Penelope Williamson - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1
ОглавлениеAlexia Carleton trat mit nackten Sohlen von einem Fuß auf den anderen. Sie spähte durch das Gitterfenster hinab in den Hof. Selbst durch den dichten Binsenbelag kroch ihr die Kälte aus dem harten Holzboden an den Beinen hoch.
In dieser Stunde vor dem Morgengrauen spendete der untergehende Mond noch genügend Licht, so daß sie die hohe, kräftige Gestalt ihres Vaters unter den anderen Männern des Clans leicht erkennen konnte. Er trug seine Stahlhaube und sein Wams – die ärmellose Jacke aus kräftigem Leder, die mit Metallplättchen besetzt war. Das hieß, er rechnete mit einem Kampf. Selbst hier oben, in dem im dritten Stockwerk des Bergfrieds von Thirlwall gelegenen Schlafzimmer, spürte Alexia die erwartungsvolle Spannung, die da unten herrschte. Pferdehufe schlugen unruhig auf den festgetretenen Boden, Speerspitzen und Lanzen blitzten silbrig im Mondlicht, und sie hörte die Nervosität selbst in dem unbändigen Gelächter ihres Vaters, der sich gerade sein Schwert umschnallte.
Als sie sich vom Fenster abwandte, fröstelte Alexia – aber nicht nur vor Kälte. Sie war aufgeregt und vielleicht auch ein bißchen ängstlich, denn was sie jetzt tun wollte, war gefährlich, möglicherweise sogar böse. Gewiß, Lady Edwina, ihre Mutter, würde es für skandalös halten. Bei dem Gedanken mußte sie unwillkürlich lächeln.
Auf Zehenspitzen schlich sie hinüber zu der Truhe am Ende ihres Bettes und hob ein Bündel Kleider auf, das mit einem Bindfaden zusammengebunden war. In der Dunkelheit fummelte sie herum und tat sich mit den ungewohnten Kleidern schwer: Unterhose, Reithose, Hemd und Wams, abgenutzte Lederstiefel mit heruntergetretenen Absätzen. Die Kleider gehörten dem Stalljungen Willie Bell, beziehungsweise hatten ihm bis gestern gehört, als sie ihm die Kleider beim Würfeln in einem der rückwärtigen Ställe abgenommen hatte. Alexia hatte darauf bestanden, sich das Pfand an Ort und Stelle geben zu lassen, und sie dachte amüsiert daran zurück, wie der arme Willie sich ein Büschel Stroh vor den Leib gehalten hatte, um seine Nacktheit zu verhüllen. Er hatte sie gebeten, ihre Augen mit den Händen zu bedecken, und sie tat ihm den Gefallen. Aber das hielt sie nicht davon ab, doch zwischen den Fingern hindurchzuschielen.
Die Kleider paßten ihr beinahe wie angegossen. Schließlich war sie groß für ein Mädchen, zu groß, sagte ihre Mutter oft; kein Mann wolle eine Frau, die ihn überragt. Alexia hoffte, daß das stimmte, denn mit vierzehn wollte sie noch keinen Ehemann. Hoffentlich hatte Willie Bell keine Flöhe. Als sie daran dachte, mußte sie sich sofort überall kratzen.
Sie nahm noch einen letzten Gegenstand aus der Truhe. Die Kappe hatte sie entdeckt, als sie an Michaelsmeß auf dem Jahrmarkt in Gilsland an einer Bude vorbeiging, und sie hatte drei Schillinge dafür bezahlt. Es war aber auch eine großartige Kappe; weicher roter Samt mit einem breiten Rand und einer Feder, die über den Rand herunterhing.
Am Abend zuvor hatte sie sich ihr langes, dunkles Haar in zwei dicke Zöpfe geflochten, die sie jetzt elegant über die Stirn zog. Sie versuchte bei dem bißchen Mondlicht, das durch das Fenster fiel, sich in ihrem Stahlspiegel in männlicher Verkleidung zu bewundern. Die rechte Hand auf dem Herzen, machte sie eine weit ausladende Bewegung zu einer großartigen Verbeugung, so wie sie es bei einem Kavalier auf der Hochzeit ihres Vetters gesehen hatte, dann hielt sie sich die Hand vor den Mund, um nicht laut zu lachen.
Ein gedämpftes Fluchen und das Schlagen einer Tür erinnerten sie daran, daß sie sich beeilen mußte, um nicht zu spät zu kommen. Auf halbem Wege merkte sie, daß sie das Wichtigste vergessen hatte.
In ihrer Eile vergaß sie, leise zu sein, und Willies Stiefel, die für ihre Füße zu groß waren, knallten gegen den Bettsockel, als sie sie anzog. Sie hörte einen Seufzer und das Rascheln der Bettwäsche. Sofort blieb sie stehen und hielt den Atem an, dann zog sie langsam den Vorhang zurück. Im Dämmerlicht konnte sie gerade noch in Umrissen den Körper ihrer Schwester Evie erkennen, deren dunkelbraunes Haar auf dem Bettuch ausgebreitet lag. Sehr vorsichtig langte Alexia unter das Kopfkissen, wobei sie ihre Schwester nicht aus den Augen ließ, und packte geschwind den Dolch.
Sir Thomas Carleton übertönte mit seiner lauten Stimme alle anderen Geräusche im Hof, der Dampf seines Atems legte sich wie eine Wolke um seinen Kopf.
»Verdammt noch mal! Rufus!«
Ein kräftiger, junger Mann mit dunkelbraunem Haar, der gerade seinen Sattel festzurren wollte, blickte auf und sah Alexia direkt ins Gesicht. Sie trat zurück und versteckte sich, eng an die rauhe Hofmauer gepreßt.
Der junge Mann sah über sie hinweg zu ihrem Vater hinüber. Sir Thomas pflanzte sich vor seinem Verwalter auf, hinter seinem breiten Rücken konnte der Mann Alexia nicht entdecken.
»Verdopple die Wache bei den Herden, Rufus«, befahl Sir Thomas. »Ich würde sonstwas wetten, daß Maxwell einen Überfall wagt, sobald wir weg sind.«
Rufus Hall stieß dem Wallach sein Knie in die Flanke, das Tier schnaubte. »Ich dachte, Lord Maxwell müßte auch zur Grenzland-Versammlung kommen.« Er ächzte, als er den Gurt fester zog. »Da er doch schottischer Landeshauptmann ist.«
»Ja, der Bastard muß schon dort sein. Nicht aber seine Söhne. Ich selbst hatte schon daran gedacht, seine Herden zu überfallen. Und wenn mir schon dieser Gedanke gekommen ist, kannst du fest damit rechnen, daß er auch daran gedacht hat. Verdopple die Wachen.«
Rufus blickte störrisch vor sich hin, aber er sagte nur: »Ja, Sir.«
Mit einem Fuß im Steigbügel zog er sich in den Sattel, und Alexia schlich davon. Hätte der Verwalter sie trotz ihrer Verkleidung erkannt, hätte er ihrem Vater das gesagt. Rufus Hall ließ nie eine Gelegenheit vorübergehen, sie in Schwierigkeiten zu bringen.
Sie rannte an der Holzwand des achteckigen Küchentrakts entlang bis zum Misthaufen am hinteren Ende. Selbst in der frischen, frühen Morgenluft stank der Haufen bestialisch, und sie versuchte, nicht durch die Nase zu atmen.
Hier war es dunkler, und es schien kälter zu sein. Sie schlang die Arme um ihren Körper und flüsterte laut: »Willie, wo bist du?«
»Hier, Fräulein.«
Alexia erschrak, als ein magerer Junge mit Wuschelkopf hinter dem Mehlschober hervorkam, der einen Fuchs am Halfter führte. Er trug wenig mehr als Lumpen und zitterte vor Kälte. Alexia hatte ein schlechtes Gewissen, als sie erkannte, daß sie ihm offensichtlich die einzigen anständigen Kleider weggenommen hatte, die der arme Willie besaß.
Sie lächelte ihn an, als sie nach den Zügeln des Pferdes griff. »Ich werde dir deine Sachen sofort zurückgeben, wenn wir heute abend heimkommen, Willie.«
»Ihr solltet das nicht machen, Fräulein.«
»Aber ich tue es trotzdem.« Sie zog auf ihrer Seite am Zügel. »Laß los.«
Er zog von der anderen Seite. Der Fuchs schnaubte und schlug aus. »Ihr werdet Ärger kriegen. Großen Ärger. Werdet Ihr Sir Thomas erzählen, daß ich irgend etwas damit zu tun hatte?«
Alexia hörte das Kratzen und Quietschen des Fallgitters, das am Tor hochgezogen wurde. »Ich werde keinem Menschen etwas sagen.« Sie hielt die Hand am Griff ihres Dolches. »Ich schwöre es auf mein Schwert.«
Willie warf einen skeptischen Blick auf den Dolch.
»Das reicht«, meinte Alexia. »Verdammt, Willie Bell, laß mich los.«
Er seufzte und ließ die Zügel los, dabei tat er einen Schritt zurück, und Alexia stieg schnell auf, ehe er es sich anders überlegen konnte. Sie trabte lässig hinter den Außengebäuden hervor, um sich der Nachhut das Clans anzuschließen, von der einer nach dem anderen durch das Tor ins Freie trabte.
Das Schwierigste stand ihr noch bevor: Unter den Männern des Clans zu reiten, ohne daß man sie bemerkte, bis sie von Thirlwall Castle weit genug entfernt wären. Weit genug entfernt, denn wenn ihr Vater sie dort erst entdecken würde, wäre er gezwungen, sie mitzunehmen. Dann mochte er schimpfen und sie anschreien, soviel er wollte, er würde es nicht wagen, sie allein zurückzuschicken, und er konnte es sich auch nicht leisten, auf einen seiner Männer zu verzichten, der sie hätte begleiten können. Außerdem, dachte sie, würde er gar nicht so böse sein. Er wußte, daß sie gut auf sich aufpassen konnte. Dafür hatte er gesorgt, denn er hatte sie wie einen Sohn erzogen und ihr gezeigt, wie man mit dem Schwert, mit der Lanze und mit dem Langbogen umgeht.
Sie umfaßte das geschnitzte Heft der Waffe an ihrer Taille. Ihr Vater hatte sie ihr am Neujahrsfest geschenkt, und ihre Mutter hatte ausnahmsweise einmal kein Wort darüber verloren, daß das Geschenk unpassend sei. In den Grenzländern, wo der Tod mitten in der Nacht aus dem Norden geritten kommen konnte, schliefen selbst Edelfrauen mit Dolchen unter ihren Kopfkissen.
Alexia hielt ihren Kopf gesenkt und die Kappe tief ins Gesicht gezogen, als sie durch das Tor und auf die Zugbrücke zuritt. Als der kleine Trupp sich verteilte und zu einem schnelleren Tempo überging, wandte sich der Reiter vor ihr um und sah ihr ins Gesicht. Es war ein Junge, kaum älter als Alexia selbst, und er sperrte den Mund auf, denn er hatte sie offensichtlich sofort erkannt. Alexia legte einen Finger auf ihre geschürzten Lippen. Er wurde rot und wandte sich ab.
Alexia drehte sich im Sattel um und blickte zurück auf Thirlwall Castle. Die riesige Silhouette der Burg mit den vielen Zinnen auf ihren Mauern hob sich schwarz gegen den grauen Himmel ab, der allmählich von der aufgehenden Sonne in weißes Licht getaucht wurde. Die Festung wirkte sicher und uneinnehmbar, was Alexia ein beruhigendes Gefühl einflößte. Solange Burg Thirlwall über dem Moor von Cumbria emporragte, würden die Carletons da sein, sie zu verteidigen.
Die Sonne war bald warm genug, um das dünne Eis über dem Sumpfgras wegzuschmelzen. Es war zwei Wochen nach Michaelsmeß und schon wurden die Oktobernächte kalt. Aber tagsüber war es noch immer ungewöhnlich heiß. Die Sonne hatte die trockene, aufgebrochene Erde Tag für Tag weiter ausgedörrt, bis die Heide selbst ein stumpfes Graubraun angenommen hatte, die Farbe von abgestorbenem Adlerfarn. Im Sommer hatte es wenig geregnet und jetzt im Herbst noch gar nicht. Die Ernte war schlecht gewesen, die Jagdbeute erbärmlich. Diesen Winter würde es zu einer Hungersnot kommen, und die Raubüberfälle würden nichts erbringen.
Andererseits hatte es Überfälle immer schon gegeben, auch während der Jahre relativen Wohlstandes in den Grenzländern. Das gehörte dort eben zum Leben dazu. Plünderungen oder Räubereien, zunächst nur im Kampf ums nackte Überleben durchgeführt, waren schließlich zur Gewohnheit geworden. Und im Laufe von drei Jahrhunderten ständiger Scharmützel waren auf beiden Seiten der Grenze englische und schottische Familien zu Wilden geworden. Nachts ritten die verfeindeten Clans über die zerklüfteten Hügel und verlassenen Sümpfe, um sich gegenseitig die Wohnhäuser zu plündern und zu verbrennen und einander die Pferde, die Schaf- und Rinderherden zu stehlen. Tagsüber trafen sie sich in den Tavernen von Carlisle oder auf den Rennplätzen in Langholm. Und dort betrogen sie einander beim Kartenspiel und Würfeln, oder sie schlossen irgendeinen zweifelhaften Pferdehandel ab. Und in den Jahren, in denen die beiden Länder offiziell im Kriegszustand miteinander lagen und Mord legalisiert war, schlachteten sie einander hemmungslos ab.
Ein- oder zweimal im Jahr wurde für einen Tag ein Landfrieden verkündet, damit an diesem Tag eine sogenannte Grenzland-Versammlung abgehalten werden konnte, an dem die Clans der Grenzländer zusammenkamen, um eine Beilegung ihrer Differenzen zur Abwechslung einmal auf friedlichem Wege zu versuchen. Sir Thomas Carleton war nicht nur das Oberhaupt des Carleton-Clans, sondern seit den letzten zehn Jahren auch Landeshauptmann für die englische Westmarsch. Zu seinen Pflichten gehörte es, die Grenze gegen Invasionen zu schützen und Gesetz und Ordnung in diesem gesetzlosesten Teil von England aufrechtzuerhalten. In dieser Eigenschaft hatte er die Grenzland-Versammlung mit seinem größten Feind, Lord Maxwell als schottischem Gegenspieler durchzuführen.
Die englische Königin Elizabeth hatte dazu einmal bemerkt, es käme ihr so vor, als ob man zwei rivalisierende Diebe beauftragen würde, die Kronjuwelen zu reinigen. Die Landeshauptmänner, selbst zwei der schlimmsten Räuber in dem Moorland, hielten sich niemals lange genug an eine vertragliche Vereinbarung, um sie auch wirksam werden zu lassen, und so mancher Landfriedenstag hatte in einer offenen Schlacht geendet.
Frauen waren bei den Grenzland-Versammlungen nicht zugelassen. Huren waren natürlich dabei, zusammen mit Hausierern, Jongleuren und Tierbändigern; aber keine einzige anständige Frau. Und ganz gewiß war nie eine adelige Dame dabei. Das war der Grund, warum Alexia, die schon vor langer Zeit herausgefunden hatte, daß Männer alles, was im Leben Spaß macht, für sich allein haben wollen, fest entschlossen war, an einem solchen Treffen teilzunehmen. Außerdem würde diese verfluchte Maxwellbrut dort sein, und sie hatte noch nie einen Maxwell richtig gesehen – außer abends und aus der Sicherheit des Bergfrieds, wenn sie über die Grenze gefegt kamen, um Carletons Vieh zu stehlen. Aber das zählte nicht.
Sie träumte gerade mit offenen Augen davon, was sie tun würde, wenn sie einen der Maxwells in ihre Gewalt bekäme, als sie merkte, daß der Lyne-Fluß bereits erreicht war. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit war der Fluß nur noch ein Rinnsal, dennoch war die Furt schmal und konnte nur einzeln überquert werden. Sir Thomas zog sein Pferd zur Seite, sein Verwalter folgte ihm, und sie ließen die übrigen vorbei. Alexia versuchte, sich in die Mitte zu schlängeln, und als sie an ihrem Vater vorbeiritt, bedeckte sie ihr Gesicht und hüstelte.
»Alexia!« brüllte Sir Thomas.
Sie tat, als höre sie ihn nicht, was lächerlich war, denn alle hatten angehalten und sich in der plötzlichen Stille entsetzt nach ihm umgesehen.
»Alexia, verdammtes Mädchen. Komm her!«
Alexia schluckte und wendete ihr Pferd. Sie stand ihrem Vater gegenüber und hielt den Kopf demütig gesenkt, solange er seine Schelte auf sie herniederprasseln ließ. Er drohte ihr, sie würde eine Tracht Prügel mit dem flachen Schwert von ihm bekommen, danach würde er sie eine Woche lang bei Brot und Wasser in Thirlwalls Keller einsperren, und – die schlimmste Drohung für sie – er würde sie Lady Edwina zur Bestrafung überlassen.
Aber schließlich beendete er seine Tirade: »Wahrscheinlich kann man nichts tun. Du kannst jetzt nicht mehr zurück.« Er drohte ihr mit seinem knochigen Finger. »Aber stell nur nichts an, Göre.«
»Ja, Vater.«
»Und halte dich von allen Maxwells fern. Wenn sie dir auf die Schliche kommen, nehmen sie dich als Geisel und bringen mich an den Bettelstab, wenn ich dich zurückhaben will.«
»Ja, Vater.« Alexia hob den Blick. Der Verwalter lächelte süßlich, offensichtlich genoß er die Schelte, die auf sie niederging. »Rufus würde dir sicher raten, mich ganz abzuschreiben, Vater. So wie eine Schafherde, die räudig geworden ist. Nicht wahr, Rufus?«
Sir Thomas schnaubte. »Sei nicht unverschämt, Fräulein. Und nenne ihn nicht Rufus. Du bist noch immer ein Backfisch, und wirst dich gefälligst dazu bequemen. Älteren mit Respekt zu begegnen.«
Alexia spielte die Überraschte. »Aber wie kann man mich noch als Kind bezeichnen, wenn ich doch alt genug bin, um verheiratet zu werden? Das bin ich doch, nicht wahr, Rufus?«
Sir Thomas brummte und gab seinem Pferd die Sporen. Rufus, mit hochrotem Kopf vor Wut und Scham, folgte.
Alexia lächelte. Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, Rufus zu necken. Er tat immer so großartig. Und sie vermutete, daß er sie nicht besonders leiden mochte, obwohl er ihrem Vater gegenüber angedeutet hatte, daß man eine Heirat arrangieren könne. Rufus war ein Gentleman, aber der jüngere Sohn einer verarmten Familie. Sir Thomas hatte eigentlich Höheres im Sinn.
Alexia runzelte die Stirn bei dem Gedanken an Heirat. Sie war ihres Vaters Liebling, und dieser hatte keine Eile, sie einem anderen Mann zu überlassen, der sie von ihm wegholen würde. Aber Sir Thomas hatte keine direkten männlichen Nachkommen und hoffte verzweifelt auf Enkel. Und Evie, die arme Evie, würde niemals heiraten. Alexia war die einzige Hoffnung ihres Vaters.
Sie trafen sich mit den anderen englischen Clans auf ihrer Seite des Esk-Flusses. Alexia entdeckte ihren Vater, der bei Rufus stand und zusah, wie sich die Schotten auf der anderen Uferseite sammelten. Sie ritt zu ihnen hin und stieg ab; dabei ignorierte sie Rufus’ Versuch eines versöhnlichen Lächelns.
»Die Maxwells sind hier«, sagte Rufus. »Ich sehe ihre Standarte.« Die Standarte der Maxwells war ein silberner Falke im Flug vor blutrotem Hintergrund. Die Fahne hing schlaff in der stillen, heißen Luft.
»Vater, welcher ist Lord Maxwell?«
In Sir Thomas’ faltendurchzogenem, sonnengebräuntem Gesicht stand der Ärger geschrieben. »Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst still sein und außer Sichtweite bleiben.« Er drehte sich wieder zu Rufus um. »Diese Bastarde von Maxwells vermehren sich wie die Karnickel. Und seine Frau hat gerade wieder einen Jungen in die Welt gesetzt. Das macht jetzt fünf.« Sir Thomas fluchte und spuckte in den Dreck. »Fünf Söhne!«
»Es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt«, meinte Rufus und sah Alexia an.
Alexia blinzelte gegen die allzu helle Sonne. Sie versuchte zu raten, welcher von den Männern, die auf der anderen Uferseite herumwuselten, Lord Maxwell sein könnte. Als Kind hatte sie Alpträume wegen ihm gehabt. In ihren Träumen hatte er gespaltene Hufe und einen zweiteiligen Schwanz, wie der Teufel auf einem der Holzschnitte im Gebetbuch ihrer Mutter. Sie wollte schon immer wissen, wie er wirklich aussah.
Niemand hatte ihr je sagen können, womit die Feindschaft zwischen den Carletons und den Maxwells angefangen hatte. Sie war jahrhundertelang immer wieder aufgeflackert und hatte sich vor vierzig Jahren zu einem Höllenbrand entwickelt, als der Vater des jetzigen Lord Maxwell sein Schwert bei der schottischen Niederlage in der Schlacht von Solway Moss an Alexias Großvater verloren hatte. Das Schwert hing jetzt über dem Kamin in der großen Halle von Thirlwall Castle. Die Maxwells hatten wie ein Mann geschworen, es zurückzuholen, selbst wenn sie die Burg Stein für Stein niederreißen müßten.
Ein einzelner Schotte durchwatete den Fluß und kam auf ihre Gruppe zu. Sir Thomas zog seine Reithosen hoch und den Bauch ein. Er übergab Rufus die Zügel und schritt hinaus auf das rote Sandufer.
»Was werden sie tun?« fragte Alexia Rufus. Sie hatte vergessen, daß sie ihn ignorieren wollte. »Werden sie kämpfen?«
»Sie werden den Landfrieden vereinbaren, der bis zum Sonnenaufgang gilt. Dann kann die Versammlung beginnen.«
»Aber wie kann Vater darauf vertrauen, daß Lord Maxwell die Waffenruhe nicht bricht?«
Rufus sah sie verwundert an. »Und warum sollte Lord Maxwell deinem Vater vertrauen?«
Alexia warf den Kopf hoch. Eine so lächerliche Frage wollte sie gar nicht erst beantworten.
Sir Thomas war hochgewachsen, aber der schottische Lord war mindestens noch einen halben Kopf größer. Sie blieben stehen und starrten sich an. Dann nahm Lord Maxwell seinen stählernen Helm ab und warf ihn auf den Boden. Sir Thomas tat das gleiche.
Lord Maxwells Haar und Bart waren feuerrot, so daß sein Kopf in der Sonne zu glühen schien. Die beiden Männer sprachen miteinander. Alexia konnte das knarrende, cumbrische Gebrumme ihres Vaters und Maxwells schottischen Singsang unterscheiden, aber die Worte konnte sie nicht verstehen. Schließlich streckte Sir Thomas die Hand aus, und Lord Maxwell schüttelte sie, woraufhin die englischen Clans begannen, die Grenze nach Schottland zu überqueren.
Die Grenzland-Versammlung war eine riesige Enttäuschung für Alexia. Die zwei Landeshauptmänner saßen unter einem Baldachin und hörten sich eine endlose Beschwerdeliste an. Alle schrien sich an, aber es kam zu keinem Kampf.
Gelangweilt schlenderte sie zu einer Stelle, wo einige schottische Händler aus dem nahen Dorf Gretna ihre Zelte und Karren aufgestellt hatten, von denen aus sie alle möglichen Waren und Erfrischungen verkauften. Sie entdeckte einen Mann mit einem Tablett voll Wildpasteten und kaufte zwei, die sie herunterschlang, während sie an der Reihe der kleinen und hastig aufgestellten Stände entlangspazierte, auf denen viel Plunder, aber auch mancherlei Nützliches zu überhöhten Preisen aufgestapelt lag. Neben einem mit Holzböcken und roh gezimmerten Tischplatten vollbeladenen Wagen stellten zwei Männer eine Plattform für eine Hahnenkampfarena auf. Mehrere Kampfhähne hingen in ihren Säcken, wo sie warten mußten, bis sie sich gegenseitig umbringen durften.
Die Pasteten hatten sie durstig gemacht, und so trat sie in ein riesiges Zelt aus gestreifter Leinwand, das ein Tavernenwirt errichtet hatte. Das Zelt hing in der Mitte erheblich durch, weil der Stützpfosten nicht tief genug in die trockene, festgestampfte Erde getrieben werden konnte. Aber drinnen war es kühl, und man war vor der heißen Sonne geschützt. Alexia ließ sich einen Krug Bier geben und beobachtete ein paar Männer, die auf Bänken um die Bierfässer herumsaßen und um die nächste Runde würfelten.
Auf einem nahe gelegenen Feld spielte eine Gruppe schottischer Jungen, die nur mit Hemd und Hose bekleidet waren, Fußball. Alexia schlenderte hinüber, um zuzusehen.
Sein Haar war das erste, was ihr an ihm auffiel, hellblond mit von der Sonne gebleichten Strähnen. Sein Schopf wurde immer wieder zwischen den dunklen Köpfen der übrigen Jungen sichtbar, wenn er gelegentlich hochschnellte oder sich freilief. Leichtfüßig und schnell rannte er auf der Weide hin und her. Mit verbissener Wildheit und wagemutig kämpfte er gegen die anderen um den Ball.
Ein Junge mit feuerrotem Haar riß sich von der Meute los, das Leder im Arm, und rannte auf das Tor zu. Der blonde Junge war der einzige, der eine Chance hatte, ihn zu fangen, und im allerletzten Augenblick warf er sich vor die Beine des Rotkopfes, der klatschend in den Dreck fiel. Der Ball kam frei und sprang hoch in die Luft. Alexia lachte laut auf.
Die Jungen jagten dem weiterrollenden Ball nach. Nur der Rotschopf nicht. Er stand vorsichtig auf, klopfte sich den Staub aus den Kleidern und beugte sich vor, um die Risse in seinen Kniehosen zu inspizieren. Nur ein Maxwell konnte Haare von dieser Farbe haben, dachte Alexia und lachte wieder.
Der Rotkopf hörte sie. Er fuhr herum und starrte sie einen Augenblick an, dann kam er mit geballter Faust auf sie zu.
»Und über wen lachst du gerade?« wollte er wissen. Er sprach mit dem Knarrton der Schotten.
Er war stämmig gebaut und hatte große Hände. Sehr große Hände. Sie sahen einander direkt in die Augen. Die seinen waren schwarz wie Kohlen und funkelten bedrohlich.
»Über dich«, sagte sie, weil eine Carleton lieber auf das Schafott ginge, als sich vor einem Maxwell zu verkriechen. »Ich habe über dich gelacht.«
Der Junge legte seine Hände flach auf ihre Brust und stieß sie um. Sie landete auf ihrem Hintern im Dreck, die Beine breit gespreizt.
»Jetzt kannst du lachen, du widerlicher englischer Laffe.«
Alexia rappelte sich auf und wollte ihn nun ihrerseits umstoßen. Aber es war, als wolle man einen Felsen wegschieben.
»Ach, Kleiner.« Er grinste und holte mit der Faust aus. »Da hast du dich wohl etwas übernommen ...«
Eine Hand schloß sich von hinten um das Handgelenk des Jungen, so daß er das Gleichgewicht verlor. »Benimm dich, Sandie-Junge, das ist unser Gast.«
Es war der Junge mit dem hellblonden Haar. Er sprach mit leicht mokanter Stimme, aber Alexia bemerkte, wie seine Knöchel weiß wurden, als er den Griff am Gelenk des anderen Jungen verstärkte.
Drei weitere Rotköpfe hatten das Fußballfeld verlassen und kamen auf sie zu. Alexia dachte an die Warnung ihres Vaters, sich von den Maxwells fernzuhalten.
Der Rotkopf fletschte die Zähne. »Mann, du wirst deine Knochen im Korb nach Hause tragen, wenn wir mit dir fertig sind. Zusammen mit ein paar Gedärmen, die du vom Boden abkratzen kannst.«
Der blonde Junge warf einen Blick über die Schulter und sah dann wieder Alexia an, und in seinen Augen saß der Schalk, so daß Alexia unwillkürlich lächeln mußte. Er lächelte zurück. »Erst wirst du mich fangen müssen, Sandie-Junge«, sagte er und stieß sein Knie grob in den Unterleib des anderen Jungen.
Der Rote sackte in die Knie. Dann fing er an zu schreien. Die anderen Rotschöpfe sahen, was passiert war, und fingen an, auf sie zuzulaufen. Der blonde Junge packte Alexia am Handgelenk und zog sie mit sich zu den Zelten und Wagen.
Sie hörten die Schritte hinter sich, und Alexia wagte es, über die Schulter zu sehen. Die Rotköpfe gewannen an Boden.
Als sie an einem Wagen vorbeirannten, der bis oben hin mit Küchengeräten beladen war, ließ der Junge ihre Hand fallen, packte sich einen großen, schwarzen Topf, der von einem Haken herabhing, und warf ihn dem führenden Rotschopf vor die Füße. Dabei traf er ihn am Schienbein, und der Junge stolperte kopfüber in einen Leiterwagen, auf dem Berge überreifer Äpfel aufgeschichtet waren. Alexia brüllte vor Lachen und klatschte in die Hände, und der Junge grinste sie übermütig an.
Alexia schnappte sich eine Pastete vom Tablett des Pastetenverkäufers, der stehengeblieben war, um zuzusehen, und warf sie dem Rotschopf an den Kopf. Sie landete mit einem Plumps im Matsch.
Der Junge lachte. »Du wirfst wie ein Mädchen.«
Er griff sich ebenfalls eine Pastete und zielte. Sie traf den Rotschopf mitten ins Gesicht, und dieser brüllte, als das heiße Fett seine Haut versengte.
Sie liefen zwischen den Wagen und Zelten hin und her, wobei sie alle möglichen Gegenstände, die ihnen in die Finger kamen, den Verfolgern als Hindernisse vor die Füße warfen. Fässer, Äpfel, die Holzbälle eines Jongleurs, Rollen mit buntem Garn, das sich entrollte und um die Füße ihrer Feinde wickelte. Für ein paar Augenblicke waren sie die Verfolger los, weil sie sich unter einen Wagen rollen ließen, bis sie an den Hahnenkampfplatz stießen. Alexia lehnte sich an die Plattform und rang nach Luft.
»Verdammter Mist.«
»Was ist?« preßte Alexia hervor.
»Ich habe meinen Dolch dort drüben gelassen. Ich brauche jetzt ein Messer.«
Alexia gab ihm ihren Dolch und sah mit Überraschung und Bewunderung zu, wie er einen Sack nach dem anderen aufschnitt. Innerhalb von Sekunden hieben alle acht Hähne wild mit den Schnäbeln aufeinander ein. Schnell versammelte sich eine aufgeregte Zuschauermenge, die ihre Wetten so laut hin und her schrie, daß das Schreien und Krächzen der Vögel übertönt wurde. Einer der Hahnenbesitzer brüllte vor Schmerzen. Er war in die Arena gekrochen, um einen hellgelben Hahn vor den wütenden Hieben seines rotbrüstigen Feindes zu bewahren.
Der Junge kroch in das nahe Bierzelt, Alexia folgte ihm dicht auf den Fersen.
Die Leute schrien, und das Zelt fing an zu wackeln. Alexia erkannte mit wachsendem Entsetzen, daß sie nun schon weit davon entfernt war, nur eine Tracht Prügel von ein paar rotköpfigen Maxwells zu riskieren – inzwischen hatte sie halb Schottland gegen sich. Und das alles wegen eines verrückten blonden Jungen, der in dem Zelt von einem der aufgebockten Tische auf den nächsten hüpfte, wie ein Baumfäller, der beim Floßtreiben von Stamm zu Stamm sprang.
Die Leinwand wankte wieder, und zwei Rotköpfe stolperten herein. »O Gott«, betete Alexia laut und sah sich vergeblich nach einem anderen Ausgang um.
Der Junge hatte das Ende der Tisch- und Bankreihen erreicht. Er hob die letzte Sitzbank hoch, schwang sie im weiten Bogen um sich und auf den gebogenen Zeltpfosten zu. Der Pfosten krachte zusammen, und das Zelt schwankte, ächzte und fiel dann in sich zusammen.
Mit Alexias Dolch schnitt der Junge ihnen beiden einen Schlitz in die Leinwand, und dann liefen sie weg, hinunter zum Esk-Fluß. Er führte sie über den Fluß und hüpfte dabei behende von einem glitschigen Stein zum anderen – ein Kunststück, von dem Alexia annahm, daß sie es niemals im Leben mit solcher Anmut nachvollziehen könnte. Sobald sie auf der anderen Seite in Sicherheit waren, warf sie sich auf den Sandboden und wollte sich totlachen.
Der Junge stand über ihr, die Hände auf den Hüften. »Und über wen genau lachst du, du widerlicher englischer Geck?« dabei imitierte er die knarrende Stimme des Rotschopfs so perfekt, daß Alexia den nächsten Lachanfall bekam.
Jemand mit kupferrotem Haarschopf war aus dem Wirrwarr von Leinwand hervorgekrochen, schrie und deutete in ihre Richtung. Alexia stöhnte und vergrub ihren Kopf zwischen den Knien. »Ich kann nicht ... ich kann nicht mehr weiterrennen.«
»Wir werden uns verstecken«, meinte der Junge.
Sie bahnten sich einen Weg durch den dichten Bewuchs am Fluß und folgten einem trockengelegten Abflußgraben bis zu einigen überstehenden Felsen. Alexia kroch zuerst darunter, dann klemmte sich der Junge neben sie.
Sie hörten Schreie und Rufe vom Fluß herauf, und einmal hörte Alexia einen Schrei und ein lautes Spritzen. Sie kicherte. »Still«, wisperte der Junge streng, aber sie spürte, wie er sich amüsierte.
Jemand brach durch das Gesträuch, und ein paar kleine Kieselsteine rieselten an dem Felsüberhang herunter. Dann rief ein anderer, offenbar aus unmittelbarer Nähe: »Komm raus und kämpfe fair, Jamie Maxwell!«
Maxwell!
Einen Augenblick war Alexia nicht einmal sicher, ob sie richtig gehört hatte. Dann keuchte sie und wollte ihn wegschieben.
»Sei still«, zischte er ganz nah an ihrer Wange.
O ja, sei still, dachte sie. Sei still, damit er mir, wenn sie alle weg sind, den Hals durchschneiden und andere, noch schlimmere Dinge mit mir machen kann, der dreckige Maxwell. Da hat er mich nun mit seinen Tricks dazu gebracht, ihm zu folgen, damit er mich hier in Ruhe umbringen kann. Und das mit meinem eigenen Dolch! Sie schluckte und preßte die Augen zusammen, blieb aber ruhig.
Da lagen sie, dicht aneinandergedrängt, unter dem überstehenden Felsen und warteten darauf, daß der Verfolger wegging. Alexias Gesicht war gegen seinen Hals gepreßt. Sie konnte den regelmäßigen Pulsschlag spüren und sein leises Ein- und Ausatmen hören. Einer seiner Arme drückte gegen ihre Brüste. Es schien ihr, als ob die Wärme seiner Haut sie durch Willies Lederwams und das rauhe Wollhemd hindurch verbrannte. Sie selbst hatte ihren Arm um seine Taille geschlungen und durch das feine Leinen seines Hemdes spürte sie seine sehnige Brustmuskulatur.
Sein Knie war irgendwie zwischen ihre Beine geraten. Als er sich ein wenig bewegte, rieb er gegen die Innenseite ihrer Oberschenkel. Alexia stockte der Atem, und in ihrem Bauch begann es zu kribbeln. Unbewußt zog sie ihn enger an sich.
Er rollte unter dem Überhang heraus und kam auf seine Knie, dabei zog er sie hinter sich her. »Um Himmels willen, hör auf, dich an mich zu kuscheln wie ein liebeskrankes Mädchen ...« Und er stieß sie so heftig von sich, daß sie flach auf dem Rücken landete.
Einen Augenblick lag sie erschrocken da und rang nach Atem. Dann zog sie sich hoch und stützte sich auf die Ellenbogen. Ihre Kappe, die sich hochgeschoben hatte, fiel jetzt vom Kopf, und die schweren Zöpfe sprangen auf ihre Schultern.
Jamie Maxwell setzte sich auf seine Fersen und starrte sie an. Alexia starrte zurück.
Es war nicht nur sein hellblondes Haar mit den Strähnen, es waren auch seine Augen. Sie waren von einem seltsam dunklen Grün, wie Moos an einem Fluß oder wie das alte Grün eines Grenzhügels Ende Oktober. Er hatte hohe, markante Wangenknochen und eine schmale Nase über einem breiten, vollen Mund. Selbst wie er da im Schmutz kniete, mit nichts an als einem mit Grasflecken übersäten Hemd und aufgerissener Hose, wirkte er so lässig und überlegen, daß sich Alexia mehr denn je wie ein schäbiger, ungewaschener Stalljunge vorkam. Zum ersten Mal im Leben war es ihr wichtig, welchen Eindruck sie machte, und sie dachte voller Verzweiflung und Wut, daß sie wohl schrecklich aussehen mußte.
Sie kannte ihre Fehler; sie waren ihr oft genug von der Mutter vorgebetet worden. Flach wie ein Nudelbrett, lang und dürr wie ein Maibaum. Ihre Nase war zu dünn und viel zu groß und ihr Mund viel zu voll. Ihre Beine waren schlaksig, ihre Füße zu klobig. Ihr einziger Vorteil waren ihre dunkelbraunen Haare mit den rötlichen und goldfarbenen Strähnen dazwischen, wie Herbstlichter. Aber wie konnte er ihre Haare bewundern, wenn sie total verfilzt und zu Zöpfen geflochten waren?
»Du bist ein Mädchen«, sagte er schließlich, als ob er es noch immer nicht glauben könnte, lächelte aber.
»Sag es nicht meinem Vater.«
»Guter Gott, weiß der das nicht?«
Alexia knirschte mit den Zähnen bei seinem spöttischen Lachen. »Das habe ich nicht gemeint. Und außerdem, ich bin es nicht.«
»Nicht was?« fragte er heiser.
»Liebeskrank!«
Wieder lachte er sie aus. Sie wollte aufstehen, aber er hielt sie am Arm fest und drückte sie hinunter.
»Sie werden drüben am Fluß auf uns warten.«
Sie blickte in diese Richtung. »Wer waren denn eigentlich diese Rotschöpfe?«
»Johnstones, Gott möge sie ausrotten, die tun mir nicht leid. Aber die guten Leute aus Gretna, o Gott.« Er lachte. »Da drüben ist ein ziemlicher Schaden angerichtet.«
Alexia zuckte mit der Schulter. »Sie wissen nicht, wer wir sind. Und übrigens, mein Vater wird sich darum kümmern. Er ist der Landeshauptmann.«
»Sie wissen sehr gut, wer ich bin. Ich will nicht einmal daran denken, was mein ... Landeshauptmann?« Er starrte sie an, seine Augen weiteten sich, ungläubiges Erstaunen stand darin und plötzlich aufkeimende Wut. »Um Gottes willen, du bist nicht nur ein Mädchen ... du bist eine Carleton!«
»Alexia Carleton.« Sie hielt ihre Hand hin, als wären sie einander gerade im Salon eines Londoner Schlosses vorgestellt worden. Er nahm die Hand nicht.
»Willst du mir damit sagen, ich habe das Risiko auf mich genommen, von einer Meute von Johnstones verprügelt zu werden, habe halb Gretna ruiniert ..., davon wird mir mein Vater jeden Schilling vom Hintern abziehen ..., und das alles für eine verdammte Carleton?«
»Hör auf, das so zu sagen! Als wäre ich eine Aussätzige oder so etwas.«
Sie funkelten sich an, dann lächelte er verschmitzt.
»Ach, egal, es war die Sache jedenfalls wert. Und sei es nur, weil wir die verfluchten Johnstones blamiert haben.«
Alexia lächelte ihm ebenfalls zu. »Das war wirklich verrückt, was du da unten gemacht hast. Ich hoffe, daß du nicht allzuviel Ärger bekommst.«
»Das ist schwer zu sagen. Mein Vater würde sich freuen, wenn er wüßte, daß ich den Johnstones eins ausgewischt habe, aber er trennt sich nicht gern von seinem Geld. Außerdem hätte ich bei der Versammlung dabeisein sollen. Ich werde eines Tages ebenfalls Landeshauptmann werden.« Das sagte er so, als ob diese Aussicht ihm nicht besonders gefiele.
Eine Weile saßen sie in geselligem Schweigen beieinander, ihre Rücken an die Felsen gelehnt. Alexia betrachtete immer wieder verstohlen sein herrliches Profil, wenn sie meinte, er würde es nicht merken.
»Darf ich bitte meinen Dolch wieder zurückhaben«, sagte sie.
Er zog ihn zwischen Hemd und Hose hervor und wollte ihn ihr gerade geben, drehte ihn aber um und betrachtete die feine Schnitzerei am Heft.
»Mein Vater hat ihn mir geschenkt«, sagte sie stolz.
Er wog ihn in der Hand. Seine Finger waren lang und schlank und die Nägel sauber und gepflegt. Alexia versteckte ihre eigenen Fingerkuppen mit den abgenagten Nägeln hinter dem Rücken.
Mit einer plötzlichen Bewegung, die so schnell war, daß sie lediglich einen dunklen Fleck vor den Augen wahrnahm, griff er den Dolch an der Klinge und warf ihn auf einen Baum zu, der zehn Meter entfernt stand. Er schwang unregelmäßig hin und her, nachdem er sich tief neben einem hervorstehenden Astloch in die Rinde gebohrt hatte.
»Danebengeworfen!« krähte Alexia.
Er stand auf und holte den Dolch zurück, dann warf er ihn von Hand zu Hand.
»Er hat kein Gleichgewicht«, sagte er.
Sie sprang auf und schnappte ihn weg. »Das stimmt nicht.«
Er starrte sie amüsiert an. Dann zog er an einem ihrer Zöpfe. »Selbst damit siehst du aus wie ein Junge.«
Das tat weh. Lächerlicherweise wollte sie weinen, obwohl sie kaum je weinte. Sie wollte ihn ebenfalls verletzen, und plötzlich fiel ihr ein, womit ihr das gelingen konnte.
»Wir haben das Schwert deines Großvaters«, sagte sie.
Er fuhr sie an. »Nicht mehr lange. Ich werde es zurückholen.«
»Haha. Du und welche Armee?«
Er wandte sich ab.
»Wo gehst du hin?«
»Zurück. Ich gehe zurück.«
»Oh ... nun. Lebwohl.«
Aber er ging nicht. »Alexia ...«, sagte er sanft und tat einen Schritt auf sie zu. Nahe genug für sie, um die grauen Lichtflecken zu sehen, die seinen grünen Augen diese seltsame schummerige Farbe verliehen. Er nahm ihr Kinn und rieb es mit dem Finger. Dann neigte er den Kopf und küßte sie auf den Mund.
Seine Lippen waren warm und fest und ihre Bewegung auf den ihren schien ihr zugleich unendlich geheimnisvoll und vollkommen vertraut. In ihrem Bauch spürte sie wieder dieses seltsame Flattern, als ob Tausende von Schmetterlingen mit den Flügeln schlugen.
Sie fühlte noch immer den Druck seiner Lippen auf ihrem Mund, selbst nachdem der Kuß zu Ende war. »Weshalb hast du das getan?« Es klang wie ein Quieksen.
»Ich weiß nicht, ich hatte Lust dazu.« Er schüttelte den Kopf. »Ich muß wirklich dämlich sein.«
»Tu es noch mal.«
Er ging einige Schritte zurück, immer noch den Kopf schüttelnd. Dann wandte er sich um und trottete davon in Richtung Fluß. Während sie Jamie Maxwells schlanker Gestalt nachsah, wie er leicht von Stein zu Stein sprang, fühlte sie ein heftiges, unbekanntes Ziehen, wie den Schmerz der Einsamkeit.
Sie fragte sich, ob sie ihn jemals wiedersehen würde.