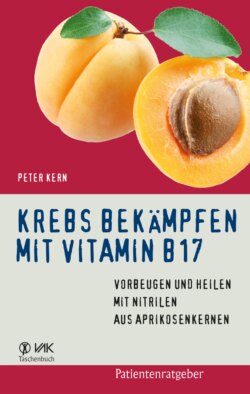Читать книгу Krebs bekämpfen mit Vitamin B17 - Peter Edward Kern - Страница 8
2. Kapitel: Verschiedene Thesen und Theorien im Lauf der Geschichte
ОглавлениеHeiler und Ärzte versuchen seit Jahrhunderten, Krebs zu verstehen und zu behandeln. Sowohl die Theorien zur Krebsentstehung wie auch die angewandten Therapien haben sich im Lauf der Zeit gewandelt. Die meisten unter uns betrachten die Erkenntnisse und Therapiemethoden aus früheren Zeiten heute nur mit einem mitleidigen Lächeln, weil sie der Meinung sind, unsere Vorfahren seien ungebildete Leute gewesen, deren Erkenntnisse im Licht der heutigen „exakten“ Forschungen als kindisch und unwissenschaftlich zu bewerten sind.
Ob diese Art der Einschätzung so richtig ist, sei dahingestellt. Wir sollten jedoch bedenken, dass vielleicht in einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten über unsere heutigen „wissenschaftlichen“ Erkenntnisse möglicherweise ebenso gelächelt werden wird.
Ein kurzer Abriss über die Entwicklung der verschiedenen Theorien zur Krebsentstehung soll Ihnen einen Überblick ermöglichen:
Alte Aufzeichnungen aus Ägypten, Mesopotamien oder Indien offenbaren ein erstaunliches Wissen über Krebs. Schon im altägyptischen Papyrus „Ebers“ wird zwischen verschiedenen Krebsarten wie Brust- und Blasenkrebs unterschieden und im Papyrus „Kahoun“ werden exakt die Symptome eines Gebärmutterkrebses aufgezählt.
Im Papyrus „Ebers“ heißt es: „(…) Es ist ein Tumor des Gottes Xensu. Lege nicht Hand gegen ihn an (…).“ Der Tumor war so genau beschrieben, dass heutige Ärzte einen speziellen Hauttumor, ein Kaposisarkom, in ihm vermuten. Es war also bereits damals bekannt, dass unbehandelte Tumoren dem Patienten manchmal ein längres Leben bescheren konnten als eine ausgiebige medizinische Behandlung.
Papyrus Ebers (Abschrift); Quelle: Wikipedia, copyright free
Krebs wurde also zuerst einmal als eine von den Göttern gesandte Krankheit betrachtet. Die Ärzte im alten Ägypten wussten jedoch durchaus auch um andere Ursachen. Die Ursache von Blasenkrebs waren Ihrer Ansicht nach Würmer – die Erreger der Bilharziose, zwei Zentimeter lange Saugwürmer (Schistosoma haematobium), können diese Krankheit auslösen.
Griechen und Römer waren der Ansicht, ein Ungleichgewicht der Körpersäfte sei die Ursache der Krebserkrankungen. Diese Lehre wird Humoralpathologie genannt. Für den Griechen Hippokrates (460-370 v. Chr.) war Krebs die Folge einer falschen „diaita“, also einer falschen Lebensweise und Ernährung.
Nach Auffassung des Römers Galenus (129-199 n. Chr.), der neben Hippokrates als ein Vater der modernen Medizin gilt, entstand Krebs durch ein fehlendes Gleichgewicht zwischen den Säften „Blut“ und „schwarze Galle“.
Die Humoralpathologie war die theoretische Grundlage der damaligen Medizin. Man könnte sie auch als vereinfachte Vorgängerlehre unserer heutigen Ansichten über den Stoffwechsel betrachten. Krebs und verschiedene andere Krankheiten wurden in diesem Sinne als Stoffwechselkrankheiten angesehen und als solche behandelt.
Hippokrates; Quelle: Wikipedia, public domain
Im späten Mittelalter erweiterte Paracelsus (1493-1541) die antike Humoralpathologie. Er vertrat die These, dass im Körper ständig chemische Reaktionen ablaufen und dass dabei Salze, Schwefel und Quecksilber die Grundelemente des Lebens bilden, die untereinander immer in einem Gleichgewicht sein müssen. Erhalten die Salze seiner Meinung nach durch krankhafte Vorgänge einen „arsenigen“ Charakter, dann beginnen sie sich durch den Körper zu fressen und hinterlassen Krebsgeschwülste.
Galenus von Pergamon; Quelle: Wikipedia, copyright free
Auch hier zeigt sich die Grundanschauung eines aus dem Lot gebrachten Gleichgewichts verschiedener „Grundelemente“, wie auch immer sie von Paracelsus damals genannt wurden. Dies ist bis heute die Grundlage unserer Arbeit als naturheilkundlich tätige Therapeuten – dass dies auch so seine Richtigkeit hat, wird im Folgenden aufgezeigt werden.
Für den Holländer Nicolaes Tulp, den Rembrandt in einem berühmten Gemälde verewigte, war Krebs sogar eine ansteckende Krankheit, eine These, die Angehörige von Krebspatienten lange Zeit und sogar bis in das 20. Jahrhundert hinein, verunsicherte.
Bis ins 18. Jahrhundert beherrschte weiterhin die Humoralpathologie auch die Vorstellungen zur Krebsentstehung. In England wurde die These aufgestellt, dass sich Krebs aus aufgestauter Lymphflüssigkeit entwickeln würde.
1774 gewann der französische Chirurg Bernard Peyrilhe den Preis der medizinischen Gesellschaften in Paris und Lyon. Er hatte Krebsgewebe eines Menschen in einen Hund transplantiert und damit die experimentelle Krebsforschung begründet. Das Transplantat wurde zwar einige Zeit später abgestoßen, jedoch gelang ihm so der Nachweis, dass sich Krebs in Geweben und nicht aus Körpersäften entwickelt. Ein weiterer Durchbruch gelang dem Franzosen Marie-François-Xavier Bichat (1771-1802). Krebs war für Bichat nichts anderes als eine missglückte Bildung von Geweben. Ohne die Hilfe eines Mikroskops konnte er bereits zwischen Krebsgewebe und gesundem Gewebe unterscheiden. Durch die Entwicklung der Mikroskope gelang es schließlich, die Zelle als Ausgangspunkt der Krebsentwicklung zu identifizieren. Johannes Peter Müller formulierte 1838 in seiner Schrift „Über den feineren Bau und die Formen der krankhaften Geschwülste“ als einer der Ersten, dass Krebsgewebe genauso wie das normale Gewebe aus Zellen besteht.
Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus; Quelle: Wikipedia, public domain
Der deutsche Embryologe Robert Remak erkannte, dass sich Karzinome regelmäßig aus Häuten, wie etwa Schleimhäuten oder Häuten von Organabgrenzungen, entwickelten.
Dr. Nicolaes Tulp; Quelle: Wikipedia, public domain
Rudolf Virchow, Professor und Politiker in Berlin, begründete schließlich die Lehre der Zellularpathologie, die besagt, dass Krankheiten auf Störungen der Körperzellen basieren. Eine Krebszelle musste sich demzufolge in einem krankhaften Prozess aus einer normalen Körperzelle entwickelt haben.
Die Anatomie des Dr. Tulp, Rembrandt van Rijn (1632); Quelle: Wikipedia, public domain
Die große Blüte der Krebsforschung beginnt jedoch erst im 20. Jahrhundert. Heute können Lebensprozesse auf der Ebene von Molekülen untersucht werden, eine genetische Beteiligung wird ebenso vermutet. Dennoch bleibt festzustellen, dass Krebs die Wissenschaft auch heute noch vor viele Rätsel stellt. Aus Sicht der Schulmedizin lässt sich die Situation vereinfacht wie folgt beschreiben:
„Krebs“ ist kein klar definierter Begriff. Unter dieser Bezeichnung werden eine Reihe verschiedener Erkrankungen zusammengefasst. All diesen Erkrankungen ist jedoch eines gemeinsam: Sie gehen mit einem vermehrten, sehr häufig völlig unkontrollierten Gewebewachstum einher. Dieses vermehrte Wachstum kann von einem Organ ausgehen, innerhalb des Organs ist dann meist auch wieder nur ein bestimmter Gewebetyp betroffen. Beispiele hierfür sind klassischerweise Brustkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, dass die Vermehrung von Zellen eines bestimmten Gewebetyps in verschiedenen Regionen des Körpers stattfindet. Beispiele hierfür sind die verschiedenen Arten von Leukämien und die Lymphome. Insgesamt kennt die konventionelle Medizin mehr als 100 verschiedene Krebserkrankungen. Wir sehen: Es können Organe oder auch nur bestimmte Gewebe betroffen sein – Krebs ist (scheinbar) sehr vielgestaltig.
Johannes Peter Müller; Quelle: Wikipedia, public domain
Bösartige Tumoren unterscheiden sich von gutartigen Tumoren durch drei Kennzeichen. Sie wachsen:
• infiltrierend: die Tumorzellen überschreiten Gewebegrenzen und wachsen in benachbartes Gewebe ein;
• destruierend: sie zerstören dabei umliegendes Gewebe;
• metastasierend: sie siedeln über die Blut- und Lymphgefäße ab oder sie bilden durch Abtropfung Tochtergeschwülste – sogenannte Metastasen.
Rudolf Virchow; Quelle: Wikipedia, public domain
Gutartige Tumoren wachsen zwar an ihrem Entstehungsort und verdrängen unter Umständen das sie umgebende Gewebe, jedoch zerstören sie es nicht und bilden auch keine Metastasen. Bei gutartigen Tumoren spricht man in Regel nicht von Krebs.
Durch das krankhafte Wachstum des betroffenen Organs beziehungsweise Gewebes entwickelt sich zunächst eine kleinere Wucherung, ein Tumor. Kleine Tumoren verursachen meist noch keine Beschwerden. Sie sind auch schlecht zu diagnostizieren, insbesondere dann, wenn der Tumor tiefer im Körper gelegen ist, zum Beispiel im Darm. Wird der Tumor jedoch im Laufe der Zeit größer, dann verdrängt er das ihn umgebende Gewebe oder wächst infiltrierend in dieses hinein. Auf diese Weise kommt es früher oder später zu Beeinträchtigungen der normalen Organfunktion. So kann zum Beispiel durch das Tumorwachstum im Darm eine Verstopfung auftreten, weil der Tumor die Durchgängigkeit des Darmes beeinträchtigt und den Weitertransport des Nahrungsbreis oder des Stuhls behindert. Durch das Größenwachstum des Tumors können auch Schmerzen auftreten, insbesondere dann, wenn der Tumor durch seinen zunehmenden Platzbedarf Nervenfasern verdrängt oder in diese hineinwächst. Erhält der Tumor während seines Wachstums Kontakt zu Blut- oder Lymphgefäßen, kann er einzelne Zellen in den Blut- oder Lymphstrom abgeben. Diese Zellen werden so verbreitet und können sich in anderen Regionen des Körpers wieder ansiedeln. In den Lymphknoten oder in den Organen, in denen sich diese Zellen ansiedeln, können sie sich vermehren und auf diese Weise Metastasen des ursprünglichen Primärtumors bilden.
Für die Schulmedizin scheint sich klar abzuzeichnen: Krebs ist eine Erkrankung des Erbguts, also bestimmter Gene des menschlichen Organismus, die meist im Laufe des Lebens erworben wird. Aus der molekulargenetischen Forschung konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass Krebs durch nicht wieder zu reparierende Schäden in bestimmten Klassen von Erbanlagen (Genen) entsteht. Derartige genetische Schäden werden durch ein ausgeklügeltes Gen-Reparatursystem überwacht, welches in der Lage ist, genetische Defekte sofort zu erkennen und zu reparieren. Leider kann aber auch dieses Reparatursystem geschädigt werden, sodass die Schäden nicht mehr behoben werden können und die „Programmierung“ der Zelle nicht wieder gutzumachende Schäden erleidet.
Ein weiteres Sicherungssystem ist die sogenannte Apoptose, der programmierte Zelltod. Zellen, deren genetischer Schaden nicht repariert werden kann, erhalten über eine komplexe genetische Information den Befehl zum „Selbstmord“. So wird verhindert, dass der irreparable genetische Schaden bei einer Zellteilung weitergegeben wird. Weil jedoch auch dieser Sicherungsmechanismus selbst zerstört werden kann, ergibt sich auch aus der Apoptose kein zuverlässiger Schutz vor einer Tumorentstehung.
Heute werden hauptsächlich drei Gruppen Krebs auslösender Mechanismen unterschieden, die auch als sogenannte Karzinogene bezeichnet werden:
• Chemische Substanzen
• Viren
• Strahlen
Wie diese verschiedenen Karzinogengruppen im Einzelnen auf die Zelle einwirken, ist erst zum Teil bekannt, wobei im Ergebnis jedoch genetische Veränderungen die entscheidende Rolle zu spielen scheinen. Nach heutiger Kenntnis beruhen etwa fünf bis zehn Prozent aller Krebserkrankungen auf einer erblichen Veranlagung, d.h. nicht der Krebs selbst, wohl aber die Veranlagung dazu kann vererbt werden. Diese Tatsachen lassen sich, wie wir später sehen werden, nahtlos in unsere Ansichten zur Krebsentstehung integrieren, sodass auch hier die Vertreter der Trophoblastentheorie nicht im Widerspruch zu den aktuellen Forschungsergebnissen stehen. Aus Sicht der Naturheilkunde bleibt festzuhalten, dass bereits die Ärzte vor mehr als 2000 Jahren wussten oder zumindest ahnten, dass Krebs durch eine falsche Ernährung hervorgerufen wird. Eine Erkenntnis, die wir hier im Folgenden wieder aufnehmen.
Im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert änderte sich die Situation sehr rasch. Die Erfindung des Mikroskops und die Entdeckung, dass Zellen die Grundbausteine des Organismus sind und dass ein Tumor eine unkontrollierte Zellvermehrung ist, änderte die Sicht und Behandlungsart der Krebskrankheit. Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden stark beachtet und bildeten fortan die Grundlage allen medizinischen Handelns. In dieser wissenschaftlichen Aufbruchsstimmung verwarf man die bewährten Methoden und begann Krebs als lokale Zellerkrankung zu betrachten. Diese medizinische Richtungsänderung hatte gravierende Folgen für die Krebstherapie. Krebs wird heute mit den bereits erwähnten Therapien oft sehr aggressiv behandelt. Nur wenige Therapeuten wissen bzw. akzeptieren, dass es sich bei Krebs um eine Stoffwechsel- oder Mangelerkrankung handelt. Nur die medizinischen „Außenseiter“, die auf eine biologisch-ganzheitliche Behandlung setzen, gehen davon aus, dass ein Tumor lediglich ein Symptom einer systemischen Erkrankung ist. Wie diese Ansicht zu begründen ist, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.