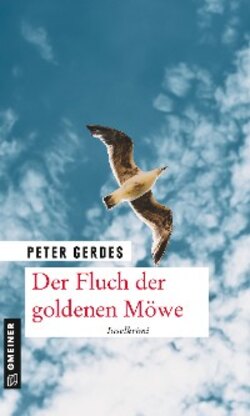Читать книгу Der Fluch der goldenen Möwe - Peter Gerdes - Страница 13
8.
ОглавлениеAls die Wohnungstür ins Schloss fiel, musste Sina lächeln. Natürlich war sie wach geworden, während Stahnke seine Sachen zusammengesucht und im Bad hantiert hatte. Auch die beiden Anrufe hatte sie mitbekommen, noch im Halbschlaf zwar, aber doch deutlich genug, um zu bemerken, dass da schon wieder etwas Dienstliches ablief. Aber sie hatte auch registriert, wie sehr Stahnke sich bemühte, leise zu sein und sie nicht zu wecken. Das fand sie lieb, und so hatte sie sich weiterhin schlafend gestellt und lieber auf einen Abschiedskuss verzichtet, als Stahnke eine Enttäuschung zu bereiten.
Jetzt aber streckte sie sich wie eine Katze, genüsslich und von lautem Gähnen untermalt, und schob die Füße unter der Bettdecke hervor. Denn auch ihr Arbeitstag würde in Kürze beginnen, und aus dem Alter, in dem sie für ein Zusatz-Viertelstündchen Schlaf gerne aufs Frühstück verzichtet hätte, war sie schon eine Weile heraus.
Während der Kaffee durchlief, warf sie sich ihren Bademantel über, zerrte die zusammengerollte Zeitung aus dem Briefkastenschlitz und setzte sich auf den Balkon. Kirchenglocken läuteten anhaltend; ach ja, heute war Karfreitag. Sonderlich warm war es noch nicht, aber hinterm Windschutz ließ es sich in der Morgensonne schon gut aushalten. Auf dem kleinen Campingtisch strich sie die Zeitung glatt. Natürlich las sie den Langeooger Inselboten, trotz seines eher biederen Erscheinungsbildes – das war sie Marian schuldig.
Als sie die Aufmacher-Überschrift las, lachte sie hell auf. »Die goldene Möwe kreist über Langeoog« – Himmel, da hatte Marian aber ganz tief in die Lyrik-Kiste gegriffen! Reichte es denn nicht, dass er schon den zweiten Tag in Folge dieses Thema auf die Titelseite hob?
Anscheinend nicht, stellte sie fest, als sie den Innenteil aufblätterte. Außer dem Aufmacher gab es auch noch ein Interview – nein, sogar zwei – und einen Kommentar, außerdem schon die ersten beiden Leserbriefe, offenbar per E-Mail eingeschickt, beide von eingefleischten Langeoog-Fans aus Nordrhein-Westfalen, einer jung, der andere schon älter, einer pro Hamburger-Restaurant, der andere contra. Sina schüttelte ungläubig den Kopf: Die passten einfach zu gut ins Konzept – hatte Marian die etwa selber verfasst? Aber nein, das denn doch nicht, das passte wiederum nicht zu ihm.
Das kürzere der beiden Interviews war das mit dem Inselbürgermeister, der noch einmal die Rechtslage und die mangelnden Einflussmöglichkeiten der Gemeinde erläuterte, alles in schönstem Amtsdeutsch. Das längere Interview hatte Marian mit zwei eingesessenen Gastronomen geführt, Bea Wulff und Renko Heidergott. Sina kannte und schätzte beide, jeden auf seine Art; auf die Idee, sich mit diesen beiden, die so unterschiedliche Auffassungen vertraten, zur selben Zeit an einen Tisch zu setzen, wäre sie aber nicht gekommen.
Immerhin, Bea und Renko schienen nicht übereinander hergefallen zu sein, nicht einmal verbal. Vermutlich einte sie ausnahmsweise einmal der gemeinsame Feind, und der hieß Heiko Grendel. Sina erinnerte sich, diesem Mann einmal begegnet zu sein; ein irgendwie unreif wirkender, großsprecherischer Typ mit schlechten Manieren und keiner nennenswerten Bildung. Dafür hatte sie sehr bald einen erheblichen Minderwertigkeitskomplex bei ihm diagnostiziert. Nach allem, was die beiden Interviewten über Grendel äußerten, lag sie damit wohl genau richtig.
Auffällig erschien nur, dass die beiden Grendel nach eigenen Bekunden überhaupt nicht zutrauten, solch ein Projekt verantwortlich zu stemmen, andererseits aber eine Heidenangst davor zu haben schienen, dass er es doch schaffte. Auch das zeugte nicht gerade von übermäßig viel Selbstsicherheit. Sina grinste und holte sich einen großen Becher Kaffee.
Auf Marians Kommentar war sie gespannt, fand den Einstieg jedoch enttäuschend. Das roch verdächtig nach einerseits – andererseits, viel Abwägung, wenig Stellungnahme. Von der Unverwechselbarkeit Langeoogs war die Rede, die durch verwechselbare Serien- und Massenprodukte gefährdet werden könnte, eine Entwicklung, die man in den uniformen Fußgängerzonen zahlreicher Städte auf dem Festland längst beobachten könne. Andererseits seien da natürlich die veränderten Bedürfnisse der Touristen, zumal der jungen, die ja die finanzielle Zukunft der Insel seien, weshalb man sie nicht ignorieren könne … Wobei man wiederum das Beispiels Venedigs nicht außer Acht lassen dürfe, das sich gegen die Überhandnahme landesuntypischer Dönerläden ebenso schlicht wie massiv mit einem gesetzlichen Verbot zur Wehr gesetzt habe …
»Schwach, Marian«, murmelte Sina und leerte ihren Becher. Trotzdem las sie den Text zu Ende – und fand dort tatsächlich doch noch etwas, das sie elektrisierte. »Woher kommt das Geld für solch ein Projekt?«, fragte Marian provokant und rhetorisch: »Von der Insel jedenfalls nicht.« Holla, wie kam er denn zu dieser Behauptung? Hatte er tatsächlich herausbekommen, wer hinter diesem Grendel steckte? Dann bekam die Sache noch mehr Brisanz. Streit unter Insulanern war ja eine Sache. Wenn aber Festländer hinter der Sache steckten, dann konnte das mehr bedeuten. »Krieg«, sagte Sina leise. Dann blinzelte sie in die herrliche Sonne, lauschte dem Glockengeläut, dem Rauschen des Windes und der fernen Brandung und musste lachen. Nein, wirklich, nur nicht übertreiben. So schlimm würde das alles schon nicht werden.
Sie schaute zur Uhr und erhob sich. Zeit, sich dienstfertig zu machen. Der heutige Tag war randvoll mit Terminen. Und gleich der erste versprach wieder eine Herausforderung zu werden.
Eine halbe Stunde später überquerte sie den Vorplatz der Klinik Haus Waterkant. Auch um diese Zeit war er schon ziemlich belebt; etwa ein Dutzend Anorexiepatientinnen standen herum, rauchten und tranken schwarzen Kaffee aus Pappbecher. Einige nickten ihr einen sparsamen Morgengruß zu, und Sina antwortete mit einem strahlenden Lächeln. Leicht fiel ihr das nicht. Sie blickte auf Blusen und Sweatshirts, die von eckigen Schultern herabhingen wie an Kleiderbügeln, auf Hosen, die an Hintern und Schenkeln Falten schlugen, weil da einfach nichts war, um ihnen Form zu verleihen. Schlimm genug. Aber sie wusste auch, wie es unterhalb dieser Oberflächen aussah, in den Köpfen dieser Patientinnen, in ihren Seelen, und das war schlimmer. Hier richteten sich Menschen, überwiegend Frauen, überwiegend junge, systematisch zugrunde, um sich und ihrer von Minderwertigkeitsängsten zerrütteten Psyche zu beweisen, dass sie wenigstens das konnten. Dabei waren das doch tolle Frauen, sehr intelligente zumeist, die stolz auf sich und ihr Potenzial hätten sein können. Aber so sahen sie sich eben nicht, so konnten sie sich nicht sehen.
Dafür zu sorgen, dass sie das wieder konnten, war Sinas Job. Vielmehr, ihnen dabei zu helfen, das wieder selbst zu können. Und zwar schnell, denn hier fanden Wettläufe statt. Der Gegner hieß Tod, und es kam allzu oft vor, dass er gewann.
Sie betrat das Gebäude durch die geräuschlosen Automatiktüren, querte die dicke, weiche Fußmatte und sog den inzwischen bereits vertrauten Klinikgeruch ein, der zwischen süßlich und sauber changierte, aber immer noch eine scharfe Gumminote enthielt. Offenbar hatte man beim Bodenbelag allzu sehr gespart. Sina war es recht. So wurde sie wenigstens immer wieder daran erinnert, dass glatte Oberflächen niemals die ganze Wahrheit waren.
Vor dem Empfangstresen, der mehr an ein Hotel erinnerte als an eine Klinik, saßen drei Patientinnen in Rollstühlen. Sie waren schon derart abgemagert, dass ihnen jedwede körperliche Bewegung untersagt worden war, um ihre mittlerweile vollkommen ungeschützten Gelenke nicht dauerhaft zu schädigen. Zwei dieser Frauen waren ganz auf ihr Strickzeug konzentriert, die dritte blickte Sina erwartungsvoll entgegen. Sie war älter als die anderen, vielleicht Ende dreißig. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen, die Wangenknochen traten hart hervor, ihre Haut war wie Pergament und ihre dünnen Lippen schienen die Zähne kaum noch bedecken zu können. Ihre hochgetürmten, glänzenden dunklen Haare bildeten dazu einen bizarren Kontrast. Es war mehr als offensichtlich, dass sie eine Perücke trug.
»Guten Morgen.« Sina zwang sich ein Lächeln ab. Konnte es sein, dass Frau Duismann seit gestern noch mehr abgebaut hatte?
»Guten Morgen, Frau Gersema.«
»Und, wie war es heute früh? Ging alles gut?«
Ein schmerzliches Lächeln, ein bedauerndes Kopfschütteln. »Leider nein. Es ging überhaupt nicht. Tut mir leid.«
»Aber Mareike, Sie müssen doch essen!« Sina hätte sich ohrfeigen können. Was für ein dummer, unprofessioneller Appell! Natürlich musste Mareike Duismann essen, wie jeder Mensch. Aber das konnte sie nicht, und genau das war das Problem, das psychologische. Gutgemeinte mütterliche Ratschläge fruchteten da überhaupt nichts.
»Ich weiß doch«, erwiderte Mareike Duismann prompt. »Ich versuche es ja auch. Aber Sie wissen ja, das Schlucken … es geht einfach nicht.«
Als ob sie sich bei mir entschuldigen müsste, dachte Sina, als ob es um mich ginge, nicht um sie! Diese märtyrerhafte Haltung machte alles nur noch schlimmer. Tapfer lächelte Sina dagegen an. »Das schaffen wir schon, was, Mareike? Wir kommen dem Problem schon noch auf den Grund. Hauptsache, Sie bleiben bis dahin bei Kräften.«
Mareike Duismann unterschied sich äußerlich zwar in nichts von den Anorektikerinnen im fortgeschrittenen Stadium, ihr Krankheitsbild aber war ein völlig anderes. Statt einer krankhaften Fixierung auf ein utopisches körperliches Erscheinungsbild, einer Störung der Selbstwahrnehmung oder dem Gefühl eigener Unzulänglichkeit, für das der Körper büßen musste, lag bei ihr eine panische Angst vor dem Schlucken vor. Sie schaffte es einfach nicht, Nahrung durch die Speiseröhre in den Magen zu befördern. Und diese Blockade war progressiv, wurde also schlimmer. Hatte sie zunächst noch Fleisch bis in einzelne Fasern zerteilt und jeden Bissen Gemüse minutenlang gekaut, so vermochte sie jetzt schon nicht einmal mehr ein Löffelchen Brühe zu schlucken. Selbst Wasser nahm sie nur tropfenweise zu sich.
Die Folgen waren unübersehbar. Sina musste sich zwingen, nicht dauernd auf die skeletthaften Schlüsselbeine zu starren, die aus Mareike Duismanns Halsausschnitt ragten, bespannt mit trockener, runzliger Haut und umgeben von schluchtartigen Vertiefungen, über denen sich ein dünnes Goldkettchen ausnahm wie eine winzige Hängebrücke. Gestern hatte die Frau schon Kochsalzlösung injiziert bekommen, per Tropf, um den Körper vor dem völligen Austrocknen zu bewahren. Als Nächstes würde die künstliche Ernährung kommen. Vor diesem Augenblick hatte Sina Angst, denn dann wäre sie gescheitert.
Mareike Duismann straffte ihr Kinn. Was Entschlossenheit ausdrücken sollte, verstärkte nur noch die Ähnlichkeit ihrer Physiognomie mit einem Totenkopf. »Na denn, gehen wir es an«, sagte sie mit plötzlicher Munterkeit. Sina staunte, wie energisch Mareike Duismann mit ihren mageren Händen den Rollstuhl in Fahrtrichtung rangierte. »Je eher wir anfangen, desto eher sind wir damit durch, nicht wahr? Sie wollen Ihr Pensum ja auch hinter sich bringen. Immerhin ist heute Feiertag.« Schon hatte sie ihr Gefährt in Bewegung gesetzt. Die Automatiktür zum Trakt mit den Besprechungszimmern hatte kaum Zeit, zischend den Weg freizugeben.
Schöner Feiertag, dachte Sina, als sie ihrer Patientin hinterher eilte. Karfreitag, was gibt es denn da zu feiern? Der Gedanke an das Wunder der Auferstehung des Fleisches kam ihr in diesem Augenblick absurder vor denn je.