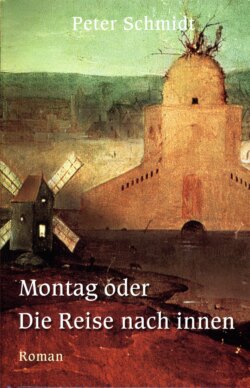Читать книгу Montag oder Die Reise nach innen - Peter Schmidt - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеOffenbar hatte Alexander Montag mich für würdig befunden, sein Schüler zu werden. Ich begriff damals noch nicht, welche Art von Lehrer er war, denn diese Rolle ist ein wenig zu ungewohnt und überraschend in einer Welt, in der die meisten Menschen, wie er richtig bemerkte, mit vierzehn Jahren das Denken eingestellt haben.
Sein Ratschlag, mich selbst dabei zu beobachten, wie ich die Dinge wahrnahm, führte dazu, dass ich in den nächsten vierundzwanzig Stunden etwa fünfhundert bis tausend Gegenstände auf ihre »Gefühlsaura« untersuchte. Die Fassade des Nationalmuseums, unseren verwilderten Garten mit den pausbäckige Engeln und Teufeln, die Zimmerdecke über meinem Bett. Ich ging im Haus umher und betrachtete Vasen und Teppiche.
Montags Beobachtung schien auch für Gedanken und Absichten zu gelten. Aber noch überraschender war die Entdeckung, die ich mit Gesichtern machte. Rolos für einen Elfjährigen viel zu große scharfe Nase kündigte plötzlich verräterisch die spätere Physiognomie eines Perversen an, obwohl das wohl kaum die Dimension des Gefühls war, die Montag im Auge hatte, sondern meine Interpretation. Und um den Kopf meines Oberhirten waberte nicht nur der Widerschein der Obstipation, sondern auch sein künftiger Bankrott.
Ich erprobte fasziniert, was Alexander Montag mir geraten hatte, und starrte auf dem Schulhof an Anne-Marie vorbei auf die Aura der Schönheit, die sie umgab.
Das schwarze Lederstirnband über ihrem feuerroten Haar begann vor meinen Augen zu flimmern.
»Was ist los mit dir, Herzbaum?«, erkundigte sie sich sie. »Hast du plötzlich einen Silberblick? Warum starrst du mich so merkwürdig an?«
»Oh, ich glaube, ich bin einfach nur verliebt in dich.«
»Mit der Liebe soll man keine Scherze treiben.«
»Das würde mir nicht im Traum einfallen.«
»Mein Bruder behauptet, ich müsse mich vor dir in acht nehmen?«
»Dein Bruder ist ein Scheusal. Warum bildest du dir nicht dein eigenes Urteil über mich?«
»Weshalb sollte ich?«
»Weil wir zusammengehören. Was hältst du davon, nach der Schule mit mir Eis zu essen?«
»Jetzt, im Winter?«
»Dann trinken wir eben einen Cappuccino.«
»Einen gemeinsam oder zwei?«, fragte sie und blickte mich auf diese freche oder spitzbübische Weise an, die ich damals noch nicht recht zu deuten verstand.
In diesem Moment vergaß ich völlig Montags Ratschlag. Die silberne Spange, die ihr Stirnband hielt, öffnete sich durch die vereinnahmende Kraft meines Blicks und fiel zu Boden. Ich hob das Band auf und berührte mit der Schulter wie unabsichtlich ihren Arm, als ich mich aufrichtete.
»Soviel du willst …«
»Einverstanden«, sagte sie zu meiner Überraschung und band sich mit beiden Händen – himmlischen schlanken Händen voller winziger blasser Sommersprossen – ihr rotes Haar zusammen, während sie die Spange zwischen ihren makellosen weißen Zähnen hielt. »Wo?«
»Hinter dem Block ist ein italienische Café.«
»Gut, sagen wir um zwei?«
Ich sah ihr ungläubig nach, wie sie ihren schönen jungen Körper einer schwebenden Göttin gleich über den Schulhof bewegte. Unter den sehnsüchtigen Blicken einiger pubertierender Knilche, die es nicht mal im Traum gewagt hätten, sie das Gleiche zu fragen wie ich!
Was war passiert? War sie meinem Silberblick verfallen? Wirkte Montags Gefühlsbetrachtung vielleicht wie ein Zauber? Wieso fand ich plötzlich den Mut, sie einzuladen?
Piper und seine Schwester wohnten mit ihrem Onkel in einem Haus auf den Hügeln der Stadt. In der Klasse nannte man es nur das Hitchcock-Haus, weil es so düster und unheimlich aussah, obwohl Pipers Vater, ein ehemaliger Handelsvertreter, seine Frau und die anderen Kinder gar nicht in diesem Haus, sondern in dem weißgestrichenen Gartenhaus etwa dreißig Meter nördlich davon erschlagen hatte.
Manchmal glaubte ich das ängstliche Flackern in Anne-Maries Blick bei dem Gedanken zu erkennen, dass sie seinem Anschlag nur knapp entronnen war. Man sagte, er sei kurz vor der »Vollendung seines Werkes« zusammengebrochen, er hatte in der geschlossenen Anstalt Selbstmord begangen.
Als ich Anne-Marie nach dem Café nach Hause begleitete, war ihr Bruder gerade Schlittschuhlaufen – ich hoffte, er versank dabei für immer im Eis –, und ihr Onkel Martin befand sich auf einer Studienreise in Italien. Sie hatte ein reizendes rosagestrichenes Zimmerchen im Hitchcock-Turm, das nach Jasmin duftete.
Es gab kein einziges Plakat von Schauspielern oder Sängern an den Wänden – keinen einzigen dieser schwülstig dreinblickenden Burschen in hautengen Lederhosen. Das fand ich beruhigend.
»Magst du Spaghetti?«, fragte sie. »Meine Spaghetti sind überall berühmt.«
»Ich bin der größte Liebhaber von Nudelgerichten außerhalb Italiens«, log ich, um ihr eine Freude zu machen. In Wirklichkeit verabscheute ich Spaghettis, weil die rote Soße beim Essen unweigerlich auf meinem Hemd landete.
Es sah ganz reizend aus, wie sie in der Küche mit einem schwarzen Lederschürzchen hantierte, das nur knapp ihre weißen Oberschenkel bedeckte. Die Spaghetti wurden dampfend in ein Sieb geschüttet. Lediglich die vielen schwarzen Gegenstände im Haus – dazu gehörte auch ihre schwarze Lederschürze – machten mich etwas stutzig. Im Wohnzimmer an der Wand hing eine schwarze Reitpeitsche; nun gut.
Die Aschenbecher, die Untersetzer, selbst die Kerzen waren schwarz, die Tischplatte bestand aus schwarzem Marmor.
Der Korridor war schwarz tapeziert. Auf den schwarzen Bodenfliesen lagen schwarze Kelims mit blassen Indianermustern. Nur der Kolben des Jagdgewehrs an der Wand über der Flurtreppe war aus dunkelbraunem Holz.
»Wann denkst du, werden wir heiraten?«, erkundigte sie sich, während wir eine Flasche Chianti zu den Spaghettis leerten.
Ich war so perplex bei dieser Frage, als hätte ich eine Marienerscheinung.
»Du glaubst doch wohl nicht, dass wir gleich miteinander ins Bett gehen, ohne später zu heiraten, Herzbaum? Das mag sich altmodisch anhören, aber ich bin nun mal keine Nutte.«
»Wer sagt denn, dass wir gleich miteinander ins Bett gehen?«
»Ist es denn nicht das, was ein Junge und ein Mädchen tun, wenn sie eine Flasche Chianti getrunken haben?«
»Schon – aber deswegen gleich heiraten?«
»Heißt das etwa, du liebst mich gar nicht?«
»Ich bin sogar rasend verliebt in dich«, widersprach ich, als ich das gefährliche Flackern in ihrem Blick sah. Das gleiche Flackern, nahm ich an, wie bei ihrem Vater, diesem verrückt gewordenen Handelsvertreter, als er mit dem Beil vor seinen Kindern gestanden hatte.
»Dann lass es uns jetzt tun …«
»Mit oder ohne Heiratsversprechen?«
»Mit natürlich. Ich bin noch Jungfrau. Es ist das größte Geschenk, das ein Mädchen einem Jungen machen kann. Oder bist du tatsächlich impotent, wie in der Schule behauptet wird?«
Damit sprach sie meinen empfindlichsten Punkt an.
»Wer sagt das?«
»Du selbst in deinem Tagebuch, oder?«
Sie ging achselzuckend an die Schublade der Kommode und nahm mein Notizheft heraus. Es roch nach Jasmin wie ihr Zimmer im Turm, als sie es vor mir aufschlug und ihr himmlisch gebogener Zeigefinger suchend über die Zeilen rutschte. Ich las peinlich berührt, welchen Unsinn ich in meinem damaligen Zustand zu Papier gebracht hatte. Ich hatte den genauen Wortlaut schon vergessen.
»Da steht nur, dass ich Schwierigkeiten mit meiner Nachhilfelehrerin wegen zu großer Präservative hatte«, widersprach ich.
»Waren die Gummis zu groß oder dein Schwanz zu klein, Herzbaum?«
Danach trug ich sie wie einer dieser großen starken Löwen in den Spielfilmen zu ihrem rosafarbenen Bett. Irgend etwas war bei ihren Worten von meiner Schädeldecke zur Zimmerdecke aufgestiegen und hatte sich im Äther verflüchtigt; ein Fluidum, der Geist der Zurückhaltung, vielleicht der letzte Rest meiner Skrupel und Hemmungen …
In ihrem Zimmer gab es keinen einzigen schwarzen Gegenstand. Er schien eine Art Gegenwelt zu bilden, wie die Antimaterie im Universum. Die vorherrschenden Farben waren Beige, Weiß und Rosa. Es erleichterte mich ungemein, das zu sehen. Ich fand auch keinen Beweis dafür, dass sie wirklich noch unberührt war, weder den berüchtigten Blutfleck auf der Bettdecke noch irgend etwas anderes. Das passte zum Rest des Bildes, wie ich später erfuhr. Anne-Marie war mit der Größe meiner Schwellkörper durchaus zufrieden.
Und mir fiel ein Stein von der Seele wegen meines Missgeschicks mit Karola. Ich war völlig gefangen von all den Gedanken, die einen jungen Mann in meinem Alter beherrschen, hätte Montag gesagt, wäre er auf dem Stuhl neben dem Bett Zeuge unserer Vereinigung gewesen. In diesem Stadium des Bewusstseins sind wir immer Opfer unserer Gedanken.
Dornenvogel hatte meinem Vater nach dem ersten finanziellen Desaster den Vorschlag gemacht, die Produktion von Betongerippen auf eine kostengünstigere Herstellung umzustellen. Er stehe in Verbindung mit einer kleineren thailändischen Firma, die Bauelemente für den asiatischen Markt produziere. Ihre Maschinen stammten aus der Volksrepublik China. Der Bruder des Fabrikanten arbeite als Baudezernent im Ministerium. Er rechnete ihm vor, dass sich die Kosten dabei um fünfundzwanzig Prozent senken ließen. Und mein Vater, dieser Oberhäuptling der Idioten, murmelte tatsächlich: »Hört sich gut an, klingt plausibel.«
Er hatte einen hundsgemeinen Respekt vor Dornenvogels Steuertricks. Also nahm er in falschem Umkehrschluss an, sein Kompagnon sei auch ein guter Kaufmann.
Oft saßen sie ganze Nächte lang in der Dachetage des Hochhauses, und Dornenvogel demonstrierte ihm an langen Ausdrucken, die Bleistiftspitze auf den Zahlenkolonnen, wo das Geschäft lag. Es war immer unsichtbar, es existierte nur in ihrem Geiste.
Man musste es erst durch lange Rechen- und Gedankenoperationen ermitteln, so wie die alten Philosophen die Existenz Gottes aus Begriffen erschlossen hatten. Dornenvogels leidender Gesichtsausdruck erinnerte mich an Ludwig Wittgenstein. Aber er besaß eine ordentliche Verdauung, und das belegte in den Augen meines Vaters, dass sein Körper und seine Seele intakt waren.
Von der vierzehnten Etage aus konnten sie die Stadt und das umliegende Land überblicken. Das schwache blaue Licht der beiden Lampen auf ihren großen Palisanderholzschreibtischen gab ihren nächtlichen Sitzungen einen verschwörerischen Anstrich. Völlig klar, dass das Leben von dieser Warte aus wie eine unendliche Baustelle wirkte, ein unermessliches Feld, um Bauelemente aus Betongerippen aufzutürmen und der Welt ein neues Dach über dem Kopf zu geben.
Anja studierte unterdessen nach Vorlesungsschluss moderne Tänze bei ihrem Professor, einem jungen Musikwissenschaftler. Van der Held war früher Europameister in Leichtathletik gewesen und betrieb eine Art Gymnastik oder Taekwon-Do, das nicht im normalen Lehrplan vertreten war – »eine revolutionäre neue Art des Tanzes«, wie er es nannte – , und dabei traf er sie mit seinen Tritten oft am Schlüsselbein und unter der Brust.
Eine verklemmte Form der Annäherung, nahm ich an. Ich hatte ihn einmal mit ihr im Café gesehen, da turtelten sie wie die Tauben auf dem Markusplatz. Meiner Meinung nach war er furchtbar verknallt in sie. Immerhin schien Anja nach diesem schweißtreibenden Studium völlig die Lust an ihren wimmernden Schnulzen aus Michael Jacksons elektronischen Musiklabors verloren zu haben. Es wurde totenstill im Haus.
»Sag mal?«, erkundigte sich meine Mutter. »Was ist eigentlich los mit euch beiden?«
»Mit uns? Mit mir ist alles in Ordnung, was mit deinen anderen Kindern los ist, weiß ich nicht.«
»Du läufst durch die Gegend wie in Trance, als hättest du was an den Augen? Und Anja ist plötzlich so still geworden?«
»Oh, das sind wahrscheinlich nur die gewöhnlichen Entwicklungsschübe bei uns Pubertierenden.«
»Wie klappt’s denn mit den Nachhilfestunden?«
»Ausgezeichnet. Wir behandeln gerade die Fresnelsche Zonenkonstruktion, die auf dem Huygensschen Prinzip beruht.«
»Die Fresnelsche … aha.«
Dank Karolas Hilfe verdrückte ich mich nach solchen Kontrollgesprächen problemlos ins Museum. Meine Erzeugerin – dieses altmodisch taktvolle Wesen – hätte niemals die Aufdringlichkeit besessen, sich an Ort und Stelle von meinen Fortschritten in der Theorie der Fresnelschen Zonenkonstruktion zu überzeugen.
Was Karola in ihrer unfreiwilligen Freizeit trieb?
Ich war irgendwann in ihr Zimmer geplatzt, und da lag sie auf ihrem Bett, einen Stapel uralter Modezeitschriften mit aufgefalteten Schnittmusterbogen neben sich, die meine Mutter seit ihrem vierzehnten Lebensjahr sammelte …
Mir klangen Montags Fragen noch deutlich im Ohr, als ich das Nationalmuseum betrat. Seitdem ich mit neuneinhalb Jahren die Welt des Geistes entdeckt hatte – das war eine Taschenbuchschwarte über Leibniz’ Monadologie gewesen, von der ich so gut wie nichts verstand –, hat mich die Magie der Begriffe nie wieder losgelassen.
Auch heute noch, als Arzt und Lehrer, finde ich es immer wieder überraschend, welche andere Realität hinter den ordinären Erscheinungen verborgen liegt, wie tief das Instrument des Geistes reichen kann, wenn wir uns seiner nur mit dem nötigen Scharfsinn bedienen und uns nicht im Dickicht der Begriffe und falschen Schlussfolgerungen verheddern.
An diesem Tag war die Gemäldegalerie ein Tohuwabohu aus durcheinanderwirbelnden Schülern der dritten Klasse. Die Museumswächter hatten eine geschlossene Kordelabsperrung um sie gebildet, die sie in den Händen hielten, um sie wie eine Herde ungestümer junger Schafe von den Bildern fernzuhalten und gleichzeitig von einem Raum zum anderen zu treiben.
Ich musste eine volle halbe Stunde warten, bis der Spuk vorüber war. Doch auf Montags Gesicht zeigte sich nicht die geringste Spur von Ungeduld oder Erschöpfung.
»Du hast über meine Fragen nachgedacht, Marc?«
»Es scheint so, als wenn die Gefühle den Dingen eine Art – na, ja … eine Art Wertprofil verleihen?«
»Hm, was lässt dich bei der Antwort zögern?«
»Wenn sie den Wert der Dinge ausmachen – und was sollte ihn eigentlich sonst ausmachen? –, dann scheint im Leben alles von den Gefühlen abzuhängen?«
»Ja, ausgezeichnet. Die Gefühle haben also die Funktion, den Dingen ihren Wert zu verleihen? Und weiter?«
»Mit den beiden Hauptkategorien meinen Sie vermutlich, dass sie positiv oder negativ sind?«
»Sie sind sogar die einzigen Qualitäten im uns bekannten Universum, denen diese besondere Eigenschaft zukommt, das wichtigste Faktum nach Materie, Energie und Bewusstsein. Man glaubt vielleicht, dass auch Dinge – ein Hammer als Werkzeug, ein Gesetz, das uns vor Verbrechern schützen soll, ein Fahrzeug, das uns ins Krankenhaus befördert, eine Operation, die unser Leben rettet – positive Qualitäten haben könnten.
Aber solche positiven Qualitäten – als Mittel – sind immer nur abgeleitet. Am Ende der Kette muss die positive Gefühlsauszeichnung stehen, das, was sich in der Attraktivität des Gefühls zeigt. Ohne sie wären die Mittel nichts oder nur eingebildet.«
»Und warum ist das wichtig?«, fragte ich.
»Weil es viel mehr Folgen hat, als man auf den ersten Blick übersieht. Du wirst deine Reise nach innen nie erfolgreich antreten können, wenn dir diese fundamentale Einsicht fehlt.«
Ich dachte, dass er mir nun erläutern würde, welche Bewandtnis es damit hatte. Aber Montag schwieg, offenbar in der Annahme, dass ich schon die richtigen Fragen stellte, und setzte sich wieder auf seinen Stuhl.
Seine Hände spielten mit einer der getrockneten Blumen, die in der Vase auf dem Boden neben ihm standen. Diese Blumen – ein großer Strauß bunter Feldblumen – hatten irgendeinen Zweck, sie waren mir schon früher aufgefallen. Manchmal zerkrümelte er die Blüten mit den Fingerspitzen, dann bedeckte der feine Staub seine Hosenbeine und den Boden um ihn her, und seine bewegungslose Gestalt bekam ein wenig vom Aussehen eines Buddhas, den die Gläubigen mit mitgebrachten Blüten bestreut hatten.
»Ich sehe in den Gefühlen zugleich Bedeutungen«, fuhr ich zögernd fort. »Über das, was ist und sein wird. Als könnte ich darin die Zukunft lesen?«
»Nein, darum geht es nicht. Dieses Faktum wäre bloß hinzugedacht. Ein häufiger Fehler.
Was ich meine, ist die reine positive oder negative Gefühlsqualität, ein inneres Phänomen, das nichts mit Sinneswahrnehmungen oder Gedanken zu tun hat.
Genauso, wie der Schmerz oder die Lust unabhängig sind, obwohl sie sich mit anderen Wahrnehmungen vereinigen können.
Das Gesicht einer schönen Frau oder der Gedanke daran mit dem Gefühl der Schönheit.
Wenn du die innere Welt erforschst, wirst du entdecken, dass sich diese inhaltlichen Qualitäten – in unserem Beispiel die Gesichtszüge – mit den Gefühlsqualitäten verbinden und eine dritte, neue Qualität erzeugen.
Weil die Dinge selbst keinen Wert haben, erreichen sie es durch Teilhabe an der Attraktivität des Gefühls und bereichern dabei das Gefühl mit ihrer Eigenart – durch Farben, Formen, Beziehungen.
Das ist der genauere Sinn der Redewendung, die Schönheit liege immer im Auge des Betrachters.
Oder, allgemeiner gefasst, das Glück liege nicht in den Dingen, sondern in der Bewertung durch uns. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt.
So entsteht der Anschein der Objektivität! Da wir den inneren Raum selten in dieser Weise inspizieren, da wir nicht in der Lage sind, ohne Übung von den einzelnen Komponenten zu abstrahieren, gaukelt die Natur uns vor, das Gesicht selbst sei schön.«
»Und weshalb versucht sie das? Wozu spielt die Natur dieses falsche Spiel?«
»Um uns auf die Wertvorstellungen der Gemeinschaft einzuschwören. Aber diese – angeblich objektiven und allgemeingültigen – Vorstellungen sind nicht nur zweckmäßig, sie haben nicht nur die Funktion, Bräuche, Moden und moralische Verhaltensweisen zu schaffen.
Sie hindern uns auch an der freien Entfaltung unseres Wesens und unserer Individualität. Sie schaffen Fanatismus und Rechthaberei. Scheinbar objektive Werte sind die tieferen Ursachen für Faschismus und Nationalsozialismus, für Terrorismus und Fundamentalismus.
Denn ohne als bindend angesehene Ziele gäbe es nur Pluralismus und Abstimmungen, wäre die Toleranz das beherrschende Prinzip unseres Zusammenlebens. Scheinbar objektive Werte waren die geistigen Voraussetzungen für die Ermordung der Juden, um nur ein Beispiel aus der jüngsten Geschichte zu nennen.«
Ich starrte Montag ungläubig an. Die Leichtigkeit, mit der er von einem harmlos erscheinenden inneren Phänomen wie den Gefühlen, die sich mit unseren Wahrnehmungen verbinden, zu den Problemen der Geschichte gelangt war, löste so etwas wie ein Erdbeben in mir aus.
»Es sind nur Bilder – du erinnerst dich? Projektionen unseres Inneren für verschiedene abstrakte Realitäten, um die unser Leben kreist. Es sind Lügen, mit denen wir uns selbst beschwichtigen und unsere Angst vor der grenzenlosen Vielgestaltigkeit des Lebens besänftigen, die uns in diesem groben Zustand des Bewusstseins erdrücken würde. Primitive Krücken für schlichte Seelen, die noch nicht ganz dem Kindesalter entwachsen sind.«