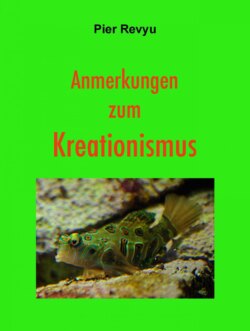Читать книгу Anmerkungen zum Kreationismus - Pier Revyu - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 – Einleitung: (Anti-)Kreationismus – Grundsätzliches
ОглавлениеEs gibt mindestens zwei Motive, sich kritisch mit dem sogenannten Kreationismus auseinanderzusetzen, d.h. mit all jenen religiös geprägten Vorstellungen, in denen der wissenschaftliche Erklärungswert der modernen Evolutionstheorie abgestritten und stattdessen eine göttliche Schöpfung (bzw. eine weitgehende evolutive Unveränderlichkeit „geschaffener“ Lebewesen) als richtige Weltsicht ausgegeben wird.
Das primäre Motiv ist ein übergeordnetes und betrifft die Freiheit des Denkens: Es muss größtes Unbehagen erzeugen, wenn trotz aller Errungenschaften der Aufklärung ernsthaft wieder behauptet wird, bestimmte sogenannte „Offenbarungsschriften“ enthielten Wahrheiten, die man nicht hinterfragen könne oder dürfe. Bekanntlich vermochten schon frühe Aufklärer auf solche Forderungen mit einem naheliegenden Einwand zu reagieren: es gibt sehr viele einander widersprechende Offenbarungsschriften, die allesamt von sich behaupten, göttliche Wahrheiten wiederzugeben – welche von diesen hat Recht? Bedauerlicherweise sind die objektiven Möglichkeiten, eine bestimmte Offenbarungsschrift für „wahrer“ auszugeben als eine andere, arg limitiert: Entweder bleiben die betreffenden Dispute offen für endlose Wiederholungen, oder sie müssen ergebnislos abgebrochen werden – im günstigsten Fall durch Schweigen, im ungünstigsten durch verschiedene Formen von Gewaltanwendung. Das o.g. Unbehagen wird ebenso durch die vermutliche Unlösbarkeit und das andauernde Konfliktpotential religiöser Differenzen hervorgerufen, wie auch aus der Befürchtung heraus, dass weltanschaulicher Dogmatismus eine ernste Gefahr für aufgeklärte, freie Gesellschaftsformen darstellt.1
Ein weiteres Motiv betrifft den direkten Angriff auf die Grundlagen wissenschaftlicher – und hier speziell naturwissenschaftlicher – Disziplinen. Offensichtlich ist es unzumutbar, wenn Anhänger aller erdenklichen „Offenbarungsschriften“ von seriös arbeitenden Wissenschaftlern einfordern, sich in der Interpretation der Faktenlage nach (zumeist archaischen) religiösen Vorgaben auszurichten.2 Die Konsequenz einer solchen geistigen Unterordnung wäre eine Vielzahl separiert vor sich hin existierender Scheinwissenschaften: für jede Offenbarungsschrift3 mindestens eine (wenn man die inhaltlichen Streitigkeiten innerhalb bestimmter Religionen zunächst einmal ausblendet – zählt man diese hinzu, erhöht sich die Anzahl der „gefügigen“ Scheinwissenschaften entsprechend).
Ausgehend von diesen beiden Einwänden bräuchte unter aufgeklärten Menschen eigentlich keine weitere Diskussion um Kreationismus geführt werden, und tatsächlich haben bekannte Evolutionsforscher wie Stephen Jay Gould sich dem Dialog mit Kreationisten explizit verweigert (und diese Strategie des Ignorierens ihren Kollegen als die beste empfohlen – Vorläufer von Gould, wie z.B. Theodosius Dobzhansky, kamen erst über Umwege zu dieser Einsicht, vgl. Numbers 2004 S.96, sowie unten Kapitel 8). Kreationismus in all seinen Spielarten zuzulassen bedeutet in einem ersten Schritt, die Grundlagen objektiver, ergebnisoffener Naturwissenschaft zu opfern; in einem zweiten liefe es darauf hinaus, auch die Grundlagen einer freien Gesellschaft zu verlieren. Wer dies nicht riskieren möchte, kann schwerlich anders, als eine den Erkenntnissen der Naturwissenschaft entgegenlaufende Schöpfungsvorstellung abzulehnen. Abgesehen von diesem konfrontativen Szenario gibt es aber „Mittelwege“, die gar nicht so selten beschritten werden: dass es beim Verzicht auf sogenannte wörtliche Auslegungen von Offenbarungsschriften durchaus Kompromissmöglichkeiten zwischen Wissen und Glauben gibt, ist oft genug festgestellt worden.4 In der wohl bequemsten Kompromissformel stellt sich die wissenschaftliche Rekonstruktion der Kosmogenese als so etwas wie der „menschenmögliche Rückblick“ auf einen göttlichen Schöpfungsakt dar (d.h. auf eine Creatio, die gleichsam als Unbekannte jenseits der mittels Forschung rekonstruierbaren Kausalketten zu verorten ist). Nur wird dabei die Creatio als solche eben in keiner Weise wissenschaftlich bewiesen: Es wäre dies eine rein private Sicht der Dinge, die jedem freisteht, der etablierte naturwissenschaftliche Modellierungen wie die eines „Big Bang“ für sich persönlich mit einer zusätzlichen religiösen Dimension ergänzen möchte. Genau diese individualistisch-kompromisshafte Sicht aber wird typischerweise von Kreationisten nicht zugelassen, da sie auf einer (angeblich! – s.u.) textgetreuen Auslegung ihrer jeweiligen Offenbarungsschrift beharren und auf dieser Grundlage an anderen Abläufen und anderen Zeiträumen als den naturwissenschaftlich ermittelten festhalten (besonders der sogenannte „Kurzzeit“-Kreationismus, auch als young earth creationism bekannt, vgl. folgende Kapitel). Die Zuspitzung „entweder Evolution oder religiös offenbarte Schöpfung“ soll also dem Gegensatz „entweder Unglaube oder (von der richtigen Schrift offenbarter!) Glaube“ entsprechen. Letztgenannte Differenz soll unüberbrückbar sein, und führt mit der doppelt dogmatischen Behauptung einer „einzigen“ Auslegung der „richtigen“ Offenbarungsschrift zu dem zurück, was oben bereits zur Freiheit des Denkens festgestellt wurde.
Im Voranstehenden ist neutral von „Offenbarungsschriften“ die Rede, um die Vielzahl infrage kommender religiöser Vorgaben zu betonen. Im Folgenden wird aus rein pragmatischen Gründen nur noch von der Bibel bzw. der Offenbarungsschrift des Christentums die Rede sein (für die z. Z. zweitgrößte Weltreligion nach dem Christentum, nämlich dem Islam, siehe beispielhaft Riexinger 2009). Ab Kapitel 4 soll dann die in Deutschland aktivste kreationistische Bewegung Wort & Wissen im Fokus stehen, deren fundamentalchristliches Weltbild sich in einigen Besonderheiten von dem anderer radikaler Christen unterscheidet.