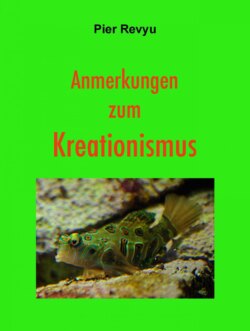Читать книгу Anmerkungen zum Kreationismus - Pier Revyu - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 – Bibelexegese: Wo anfangen, wo aufhören?
ОглавлениеIn seinem autobiographischen Werk Un Uomo Finito („Ein erledigter Mensch“, 1912) schildert Giovanni Papini, wie er als sechzehnjähriger Schüler aus eigenem Antrieb Hebräisch lernt, weil er – aus der Sicht eines Ungläubigen und Freigeistes – die Niederschrift eines Bibelkommentares plant,
»der Vers für Vers alle Bücher des Alten und Neuen Testaments verfolgte und ohne Schönfärberei all die Irrtümer, Widersprüche, Lügen, Lächerlichkeiten, Zeugnisse von Grausamkeit, Schurkerei und Dummheit«
aufdecken soll,
»von denen diese angeblich von Gott inspirierten Zeilen voll sind« (Papini 1980, S.31).
Der junge Papini hofft, mit dieser Aufgabe »in ein paar Jahren bequem fertig werden zu können« (ebd. S.32) – und kommt natürlich über die Anfänge seines Unternehmens nie hinaus. Indes, verfolgt man die Anstrengungen des wissbegierigen Schülers, welcher von Armut und Außenseitertum angespornt ist, so muss man feststellen, dass er – auch nach heutigen Maßstäben – auf Anhieb weitaus mehr erreicht als viele Bibelleser in ihrem ganzen Leben (ebd. S.32 f.):
»Dann schrieb ich wieder den ersten Vers der Genesis (in hebräisch) ab und begann den Kommentar auszuarbeiten: „Am ersten Tag schuf Gott den Himmel und die Erde!“. Sofort stieß ich auf die großen Schwierigkeiten. In diesem Vers sind zwei Wörter, die den Exegeten sehr viel zu schaffen machten, und die Christen haben sie auf ihre Art und Weise übersetzt, wie es zur festgelegten Theologie der Konzilien und ihrer Väter paßte. Heißt es im Text „Gott“ oder „Götter“ – „schuf“ oder „bildete“?
Das heißt: waren die ältesten Juden Monotheisten oder Polytheisten? Glaubten sie an die Erschaffung aus dem Nichts oder stellten sie sich Gott als einen Demiurgen vor, als einen Bildhauer, der einer unerschaffenen und unabhängigen Materie Gestalt gab? Unendliche Probleme, wie man sieht, geschichtliche, sprachliche, philosophische. Doch das bestürzte mich nicht, und ich fing an zu schreiben.«
Sechzehnjährige Menschen vom Schlage eines Papini sind leider eine Ausnahme, oder – um es auf die Gegenwart zu beziehen – anstelle des Alt-Hebräischen eher modernen Programmiersprachen zugewandt. Eben deshalb scheint es den Autoren des „evolutionskritischen“ Schulbuches einen Versuch wert zu sein, gerade jungen Lesern zu suggerieren, dass es eine »Deutung des Lebens unter der Voraussetzung von Schöpfung« gäbe (Junker & Scherer 2006, S.290ff.) – eine ganz bestimmte »Deutung« sogar, wie sie sich angeblich direkt (!) aus Bibelworten herleiten lässt. Dass die ganze Sache dann doch nicht so einfach ist, wurde seitens W&W im Laufe der Jahre eher zögernd eingestanden. In der 5. Auflage (Junker & Scherer 2001) wird auf S.284 in einer separaten Box aus dem 1. Buch Mose 1, 25 zitiert (»Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.«). Alles was im daneben stehenden Haupttext über »Grundtypen als Schöpfungseinheiten« ausgeführt wird muss man mangels weiterer Erklärungen als aus diesem Bibelvers herausgelesen hinnehmen, was man kaum anders als manipulativ und hochgradig unredlich bezeichnen kann. In der 6. Auflage (2006, S.295) hat sich diese Darstellung bemerkenswerterweise geändert (dito: Junker 2005, S.30), die Überschrift »Grundtypen als Schöpfungseinheiten« ist dort nun mit einem »?« versehen, und der Bibelvers wie folgt ergänzt (ebd):
»Was unter den geschaffenen Arten genau zu verstehen ist, kann daraus [aus Mose 1,25] jedoch nicht abgeleitet werden. Der Schöpfungsbericht gibt keine naturwissenschaftliche Art- oder Typdefinition.«
Dies ist nicht nur ein wichtiger Zusatz, sondern ein weitreichendes Zugeständnis, da man nun ja auf die genaue Begründung gespannt wäre, warum ausgerechnet die »Grundtypen« (also eine sehr spezielle, in der Nachfolge von Frank L. Marsh praktisch nur von W&W aufgemachte Einheit) etwas mit »ein jedes nach seiner Art« (Bibeltext) zu tun haben sollen. Ein Argument findet sich ebd. auf S.296 und lautet:
»Die deutliche Abgrenzbarkeit von Grundtypen kann als Hinweis für die Existenz geschaffener Einheiten gewertet werden.«
Ein reichlich vager »Hinweis«, um nicht zu sagen: ein reichlich konstruierter. Und daran liegt es dann wohl auch, dass ganz zu Anfang des „Lehrbuches“, nämlich bei der ersten Erläuterung des Begriffes „Schöpfung“, die Grundtypen noch unmittelbar mit dem Bibeltext in Verbindung gebracht werden (d.h. ohne die Frage zu stellen, was genau in Mose 1,25 gemeint ist):
„Nach biblischer Darstellung wurden alle Lebewesen als fertige Grundtypen geschaffen (...).“ (ebd. S.19);
»Im Rahmen der biblischen Schöpfungslehre wird Bezug auf Offenbarung genommen und z.B. konkret vorausgesetzt, dass am Anfang der Geschichte der Lebewesen fertige Grundtypen standen (...).« (ebd. S.20, Hervorhebung im Original)
Es wird also zu Beginn des „Lehrbuches“ rundheraus behauptet, dank der Offenbarung könne man »Grundtypen« ganz »konkret« als Schöpfungseinheiten ansehen – und erst auf S.296 folgt die Relativierung, dass dies eigentlich gar nicht möglich sei (bzw. dass das einzige Kriterium für diese Identifikation in der angeblich „deutlichen Abgrenzbarkeit“ besteht – auch zu diesem Punkt wird unten noch etwas zu sagen sein)!
Bleiben wir aber bei der Formulierung »konkret vorausgesetzt« von S.20 (die man als konkrete Manipulation der Leserschaft einstufen kann). Besagte »Voraussetzung« erfordert, man ahnt es, schon bald eine weitere Voraussetzung, welche auf S.291 im Kapitel »Kurzzeit-Schöpfungslehren« genannt wird:
»Die in den ersten elf Kapiteln des Genesisbuches (dem ersten Buch der Bibel) geschilderte „biblische Urgeschichte“ wird als reale Menschheitsgeschichte verstanden und für das Verständnis der Geschichte des Lebens vorausgesetzt.«
Die theologische Begründung der Schöpfungslehre sensu W&W ist hiermit zwar noch nicht vollständig wiedergegeben (komplettiert wird diese ebd. in der Box „Theologische Motivation für Kurzzeit-Schöpfungslehre“10), doch es lässt sich folgendes Argumentationsmuster festhalten: 1) Die Genesis soll die »reale Urgeschichte« der Lebewesen einschließlich des Menschen offenbaren (= Offenbarungsargument), 2) Lebewesen sollen laut Bibeltext „ein jedes nach seiner Art“ geschaffen worden sein (= Wörtlichkeitsargument), 3) diese Textstelle soll in irgendeiner Form etwas mit den heute feststellbaren Grundtypen zu tun haben, auch wenn man dies – zugestandenermaßen!, s.o. – nicht aus dem Text ableiten kann (= analogisierendes Argument, welches sich auf das Kriterium der Abgrenzbarkeit der biblischen „Arten“ und der heutigen „Grundtypen“ stützt und hierüber beide Einheiten miteinander gleichgesetzt).
Ersichtlich ist diese Argumentationskette dermaßen schwach, dass man sie insgesamt als wertlos bezeichnen kann. Sogar wenn man sich bereit erklärte, auf die unbeweisbare Behauptung einer echten göttlichen Offenbarung einzugehen (Schritt 1), müsste man sodann W&W glauben, dass ihre Lesart des hebräischen Originals korrekt ist (Schritt 2) und sich im Anschluss auf die Identifizierung jenes hebräischen Begriffes, der mit „Art“ übersetzt wurde, mit den ominösen „Grundtypen“ einlassen (Schritt 3) – letztere spielen in der seriösen wissenschaftlichen Biologie übrigens gar keine Rolle (vgl. weiter unten).
Bevor wir fortfahren, lohnt es sich durchaus noch einmal zu erwähnen, dass Junker & Scherer von sich behaupten, ein „kritisches Lehrbuch“ vorgelegt zu haben, und im Vorwort (ebd. S.6) von der Bedeutung „kritischer Analyse“ die Rede ist. Bereits die oben rekonstruierte Argumentationskette und die bestenfalls inkonsequente, in Wahrheit aber wohl bewusst manipulative Art und Weise, wie am Anfang des Buches eine direkte Herleitbarkeit von „Grundtypen“ aus dem Bibelwort behauptet wird, mag als Beleg dafür dienen, welche Kunst des kritischen Denkens W&W sich zu eigen gemacht haben und in Schulbuchform an den Nachwuchs weiterzugeben gedenken. Vertiefen wir dies also über die beiden Punkte, die jetzt zu betrachten sind: zunächst die angeblich wörtliche Lesart der Bibel (also die laut W&W „reale Urgeschichte“), und danach der Grundtypbegriff sensu W&W.