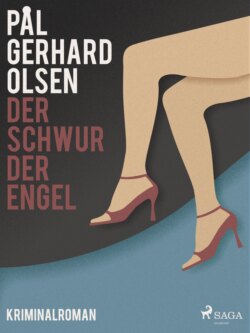Читать книгу Der Schwur der Engel - Pål Gerhard Olsen - Страница 7
5
ОглавлениеDer nicht öffentliche Haftprüfungstermin war für neun Uhr angesetzt. Die Journalisten waren zahlreich erschienen, sie mussten aber auf den Gängen warten. Ich war seit Tagen die Milchkuh für ihre Titelseiten. Das massive Presseaufgebot drängte zu mir hin, aber die Beamten brachten mich sicher in ein Hinterzimmer. Wie eine Sportlergarderobe vor dem großen Kampf, dachte ich. Und wie bei einem bevorstehenden Kampf begrüßte ich den Kapitän der gegnerischen Mannschaft mit Handschlag. Der Staatsanwalt, der die Stichhaltigkeit von Mirjam Paulsens Beweisen bestätigt hatte, war weißhaarig, groß und schlank. Ein wettergegerbter Mann, der offenbar viel im Freien war. Der Richter war eine Frau. Klein und lebhaft, sie hatte ein langes Berufsleben hinter sich. Lindtoft trug den gleichen Anzug wie am Samstag, nur die Bonbontüte war neu. Während der Arbeitszeit brauchte er einen Ersatz für das, was ihm eine Schrumpfleber beschert hatte. Er redete unter vier Augen mit mir.
«Haben Sie das mit der Angelschnur gehört?»
«Ja», sagte ich. «Von der Polizei selbst. Das ist doch eine Falle. Jemand will mich reinlegen. Ich bin kein Angler.»
«Nun gut. Sehen wir zu, dass wir das hinter uns kriegen, Ask.»
Er legte mir seine rundliche, papierleichte Hand auf die Schulter und begleitete mich in den hell eingerichteten, ansprechenden Raum. Ein lockerer, geradezu jovialer Ton herrschte zwischen den Parteien. Nach einem kleinen Eingangsvortrag bat die Richterin mich, vorzutreten, fragte mich nach Namen und Personennummer, Beruf und Einkommensverhältnissen. Ich war froh, dass eine Frau den Vorsitz hatte. Von jeher war da etwas zwischen Frauen und mir. Eine besondere Temperatur, eine Art Energieübertragung. Mit Männern tat ich mich schwerer. Sie waren irgendwie unbeweglicher. Ich sah die Richterin nicht als Objekt, das vom Gesetzbuch neben ihr gegängelt wurde, sondern als Mensch. Ich wollte um ihr sicheres, unabhängiges Urteilsvermögen werben.
Alles auf Anfang.
«Möchten Sie sich zu den Beschuldigungen gegen Sie äußern?»
«Ja. Aber ich möchte keine Erklärung abgeben, ich würde gerne etwas erzählen», sagte ich, um die Richtung vorzugeben.
«Nun denn», sagte die Richterin mit einer Handbewegung, als putze sie im Akkord Fenster. «Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber fangen Sie an.»
«Ich möchte von einer Begegnung erzählen. Der Begegnung zwischen mir und der Frau, die später meine Ehefrau wurde. Das war vor zweieinhalb Jahren. Ich war vor ihr mit vielen Frauen zusammen gewesen. Zu vielen. Aber dann kam Turid in mein Leben. Ich wusste, dass sie meine Endstation war. So einfach war das. Sie machte mich zu einem anderen Mann. Ich weiß nicht, ob ich sie zu einer anderen Frau machte, aber sie machte mich zu einem anderen Mann.»
Ich sah, dass die Richterin sich schüttelte, als hätte ich mich einer unangemessen schwülstigen Sprache bedient. Aber ich redete mit heißem Kopf weiter und bombardierte die erste Dame des Gerichts mit meinen Blicken.
«Sie machte mich frei, indem sie mir die Freiheit nahm. Ich bin auch jetzt frei, verehrte Frau Richterin. Vielleicht kennen Sie das Lied von Janis Joplin, dass Freiheit nur ein anderes Wort dafür sei, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Wenn das so ist, dann bin ich völlig frei. Denn als ich Turid verlor, habe ich alles verloren. Mich verloren. Ich habe kein Interesse daran, mich selbst wieder zu finden. Ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um herauszufinden, wie Turid ermordet wurde. Warum sie nicht mehr Teil meines Lebens ist, mit all den kleinen Alltäglichkeiten, die ein Zusammenleben ausmachen. Und die so groß werden, wenn man sie nicht mehr hat. Sie ist immer noch alles für mich.»
Ich hatte den Eindruck, als erreichten meine Worte ihr Ziel. Die Richterin schüttelte sich nicht mehr, sie hatte sich in dem hohen, rot gepolsterten Stuhl zurückgelehnt. Sie wirkte weniger auf dem Sprung.
«Ich habe mehr als nur sie und unser gemeinsames Leben verloren. Turid erwartete ein Kind. Der Beweis unserer Liebe. Zusammen ein Kind erwarten – was könnte mehr bedeuten. Es klingt vielleicht hoffnungslos altmodisch, dem so viel beizumessen. Aber ich bin ein altmodischer Mann. Ich bitte nicht nur darum, ich verlange, dass man mir glaubt, dass ich nicht getan habe, wessen man mich hier beschuldigt. Damit will ich nicht mich verteidigen, sondern sie. Sie ist nicht diesen himmelschreiend banalen Tod gestorben, auf dem die Polizei besteht. Ich will ihr einen würdigeren Tod geben, der widerspiegelt, wer sie war und wer wir zusammen waren.»
«Sie reden gut. Aber auch sehr unpräzise», sagte sie salomonisch. «Ich hätte Sie zur Abwechslung gern etwas bodenständiger. Was haben Sie zu den Ereignissen am Abend des vergangenen Donnerstags zu sagen?»
«Gut, von der Poesie zum Sachbuch. Ich verweise auf meine Aussage bei der Polizei. Ich bin das Opfer eines Komplotts. Das ist eine Falle, und die Polizei glaubt alles unbesehen. Um es kurz zu machen: Ich bekam einen Anruf von einer Prostituierten im Sagvei. Ich sollte sie vor einem Kunden schützen, der sie belästigte. Auf ihre Bitte machten wir einen Spaziergang zur Aker hinunter, und da fand ich meine Frau. Diese Prostituierte ist in dieses Komplott einbezogen. In meinem Verhör habe ich andere mögliche Täter erwähnt, die gute Motive gehabt hätten. Auch die Angelschnur ist Teil des Komplotts. Turid ist nicht diesen banalen Tod gestorben, den die Polizei ihr anhängen will. Ich bin sicher, dass etwas Größeres dahinter steckt. Und das will ich zeigen.»
«Sie konnten hier schon mehr zeigen als die meisten anderen in Ihrer Situation», antwortete die Richterin bedeutungsvoll und überließ mich dem Staatsanwalt.
Seine Fragen folgten dem, was Paulsen und Svenning ihm vorgegeben hatten. Darüber hinaus hatte er nichts Neues zu bieten, weder im Austausch mit mir noch in seinem Schlussplädoyer. Fingerabdrücke und Blutproben waren hier ohne Bedeutung, und es war ihnen auch nicht gelungen, am fraglichen Abschnitt der Aker etwas zu finden, was mit mir in Verbindung gebracht werden konnte. Aber sie hatten die Zeugenaussage, sie hatten die Schnur, sie hatten alles in allem genug, um eine vierwöchige Untersuchungshaft mit Brief- und Besuchsverbot zu fordern. Was der Staatsanwalt vorbrachte, war kein Plädoyer, sondern eine pisswarme Beweisführung. Als seien ihm Fälle wie der meine bis zum Erbrechen bekannt. Für ihn war ich ein eifersüchtiger Ehemann, der die Kontrolle verloren hatte. Er hatte die statistische Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite.
Lindtoft begann mit dem Nächstliegenden, dass es nämlich der Polizei unbenommen sei, ihre Nachforschungen fortzusetzen, ohne dass der Verdächtige in Gewahrsam genommen werden müsse, sie habe den Untersuchungsrichter bereits so weit überzeugt, dass er zwei Hausdurchsuchungsbefehle ausgestellt habe. Waren ihre Arbeitsbedingungen nicht auch so gut genug? Daraufhin schlug er leise Töne an, wo ich laut gewesen war. Als kompetenter, wenn auch vielleicht etwas phantasieloser Verteidiger folgte er dem kriminalistischen Einmaleins: Drei Kriterien müssten erfüllt sein, um eine Untersuchungshaft zu rechtfertigen. Dann ging er daran, eins nach dem anderen zu entkräften. Aus Sicht der Polizei sei die Annahme einer Fluchtgefahr nicht völlig unbegründet. Das allein aber reiche nicht aus. Dann wäre da die angebliche Verdunklungsgefahr, Frau Blom. Das Gericht habe einen, wie ihm schien, zutiefst verzweifelten Mann gehört, der aus überaus verständlichen Gründen völlig aus dem Gleichgewicht geraten sei und versucht habe, den Mord an seiner geliebten Frau auf eigene Faust aufzuklären. Das mochte tadelnswert sein, nicht mehr. Und eine Wiederholungsgefahr sei aus offensichtlichen Gründen ebenfalls nicht gegeben.
Vor der Entscheidung hatten wir noch Zeit zum Mittagessen. Normierte Sandwichs. Ich bekam nur das abgestandene Wasser aus der Karaffe herunter. Ich sah, dass Lindtoft mit seinem Verlangen nach etwas Stärkerem kämpfte.
Nachdem die Richterin an ihren Tisch zurückgekehrt war, setzte sie die Brille ab. Hatte das etwas zu bedeuten? War das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für mich? Sie rekapitulierte alle Aspekte des Falls bis ins letzte Detail und sah dabei die ihr gegenüberliegende Wand an. Doch dann hörte ich das vergleichsweise umgangssprachliche Wort «überstürzt». Es könne der Eindruck entstehen, als sei die Polizei in dieser Sache etwas überstürzt vorgegangen. Die Grundlage des Antrags auf Untersuchungshaft sei nicht anfechtbar, die Aussagen der Zeugin sowie der Fund von belastendem Beweismaterial in den vom Verdächtigen gemieteten Räumen müssten gebührend gewürdigt werden. Gleichwohl richte sie die Aufforderung an die Polizei, in dem Fall sorgfältiger und weniger einseitig zu ermitteln, als dies bisher geschehen sei. Daher vertrete das Gericht nach eingehender Prüfung die Auffassung, dass die vorgelegten Indizien nicht ausreichten, um dem Antrag der Polizei auf Untersuchungshaft stattzugeben. Aber, sagte sie und sah mich dabei mit einer Miene an, als solle ich mir bloß nicht einbilden, dass sie zu Almosen neige, angesichts der Schwere des Verbrechens verhänge sie etwas, das sie als Haftersatz bezeichnen wolle: Meldepflicht für den Verdächtigen bis zum Abschluss der Ermittlungen.
Der Staatsanwalt wirkte wie vom Donner gerührt und legte sofort Beschwerde ein. Das Gericht tagte nicht mehr, es war aufgehoben. Die Richterin schickte sich an, den Raum zu verlassen.
«Danke», sagte ich, als ich vor ihr stand.
«Wofür?», fragte sie scharf.
«Dafür, dass Sie Turid und mich gesehen haben.»
«Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Nur dass ich das, was ich von den Polizeiermittlungen gesehen habe, schon viel besser gesehen habe.»
Der Staatsanwalt gab mir nicht mehr die Hand, er bewies wenig Sportsgeist, als er mir einfach aus dem Weg ging. Paulsen und ihr Anhängsel Svenning waren, wie angekündigt, nicht zum Termin gekommen. Dafür erschienen sie jetzt danach, sie an diesem Tag mit Pelzbesatz.
«Jetzt hat Ihr Lack einen Kratzer bekommen. Aber einmal ist immer das erste Mal.»
«Vielleicht», sagte sie gefasst, die Ohrläppchen tief im Zobel versenkt. «Ich will Sie nur daran erinnern, dass der Verdacht bestehen bleibt, falls die Richterin das nicht deutlich genug gesagt hat. Wir sind nicht fertig miteinander.»
«Nein, wir haben doch wohl gerade erst angefangen, oder?»
Meine Frage blieb unbeantwortet. Die Kulturschaffenden des Zeitungsgewerbes bedrängten Lindtoft und mich von der Drehtür des Gerichtsgebäudes bis zum Restaurant Gabler einige Straßen weiter. Große Teller, kleine Portionen, gesalzene Preise. In stillschweigender Übereinkunft strebten wir direkt auf die Bar zu, zuvor musste ich allerdings die dreistesten unter den Journalisten in unmissverständlichen Worten über die ethischen Grundsätze ihres Berufsstandes aufklären.
«Ich werde langsam zu alt für so etwas», stöhnte Lindtoft, nachdem er sich auf den Hocker gehangelt hatte.
«Für das Erklimmen eines Barhockers oder für dieses Theater bei Gericht?»
«Eher Letzteres.»
Gin Tonic für Lindtoft. Für mich Bushmill, ohne alles. Er trank genau so, wie ich es erwartet hatte – ohne Rücksicht auf die Schrumpfleber.
«Na, Ask, das haben wir doch gut hingekriegt, oder?», sagte er und stieß mit mir an.
«Mal sehen, wie es weitergeht.» Der Whiskey legte sich wie eine flauschige Decke über mich.
«Irgendwie geht es immer weiter», hobbyphilosophierte Lindtoft. Die über den Schädel gekämmten Haare begannen zu verrutschen. Er kümmerte sich nicht darum. «Kommen Sie über Neujahr mit nach Florida. Share some time with me.» Er kicherte in Moll über seinen eigenen Witz. «Sie sitzen im Schatten. Sitzen einfach da und gucken vor sich hin. Wenn Sie das lange genug gemacht haben, löst sich alles auf. Das können Sie auch.»
«Nein, Lindtoft. Das hat ein anderer für mich getan», antwortete ich, als vor dem Restaurant gerade alle meine Bekannten aus dem Polizeipräsidium auftauchten. Paulsen, Svenning und Vegard Bakke, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Er trottete hinter den anderen her, hob im Vorübergehen den Blick und erstarrte bei meinem Anblick. Ich prostete auch ihm zu. Es war, als seien wir schon im Gespräch miteinander. Als hätten wir schon mehrere Themen angeschnitten, noch bevor wir das erste Wort gewechselt hatten.