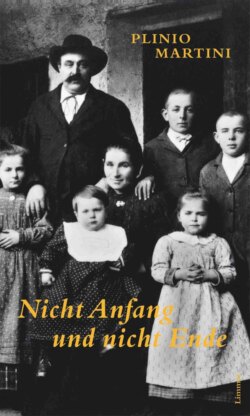Читать книгу Nicht Anfang und nicht Ende - Plinio Martini - Страница 6
ОглавлениеAntonio und ich blieben im Herbst allein in Roseto, um den Mist auf die Felder zu verteilen oder an den Waldrändern Holz zu machen. Die Arbeit war schwer, aber nicht so anstrengend, dass man dabei nicht hätte reden können, und tatsächlich sprachen wir den ganzen Tag miteinander. Der eine sagte etwas, und der andere antwortete ihm vielleicht eine halbe Stunde später.
«Im Mist geboren», sagte ich, als wir uns auf der Wiese begegneten, wo wir unsere Last tauschten, und stellte die leere gerla zu Boden. «Das ganze Jahr stecken wir drin, und wenns kein Mist ist, sind es Steine oder Dornenhecken. Dabei gibts auf der Welt Gott weiß wie viele Länder, wo man es leichter hat.»
Er setzte seine gerla auf der meinen ab, zog die Arme aus den Tragriemen und holte tief Atem. Während ich meinerseits unter die Last kroch, zitierte er:
«In Nachbars Garten ist das Gras grüner.»
Zum Teufel mit den Sprichwörtern! dachte ich bei mir und ging. Kräftig, wie ich damals war, machte mir eine Ladung Mist wahrhaftig nichts aus.
Aber schon beim bloßen Wort «Roseto» verzog ich bitter den Mund, wenn ich wie jetzt, als der neue Haufen sich zu den anderen reihte, rings um mich schaute und sah, mit welch unendlicher Mühe unsere Alten hier ein bisschen Erde zusammengekratzt hatten, gerade genug, um nicht hungers sterben zu müssen. Sie hatten an unzugänglichen Stellen Sennhütten und Wege gebaut, um die Wiesen und für die sòstene kilometerweise Mäuerchen errichtet, den Fluss und die Wildbäche eingedämmt und sogar Erde auf die größeren Felsblöcke hinaufgeschleppt, um ein paar Gemüsebeete anzulegen oder ein Stückchen Wiese, das vielleicht eine Hand voll Heu lieferte. Jahrhundertelange, beharrliche Mühe, und dann rutschte der Berg ab, kaum dass man Zeit hatte, ein Ave zu sagen, oder das Hochwasser durchbrach die Dämme, fegte die Felder hinweg und riss die ganzen Ställe mitsamt dem Heu und den Kühen mit sich fort. Wenn der Fluss heute keine Verheerungen mehr anrichtet, so nur, weil er uns schon alles angetan hat, was in seiner Macht stand, das sage ich dir.
Die wenigen Nachrichten, die unsere Vorfahren uns überliefert haben, betreffen nur Unglücksfälle; wie in Fontana, wo auf einem Felsblock mitten im Geröll ein Aufschrei eingehauen ist, von dem man nicht weiß, ob er ein Gebet oder einen Fluch bedeuten soll: «Jesus Maria, hier war schönes Land!» Damals hatten sie nicht genug Atem, um mehr zu sagen.
Von Sabbione über Ritorto bis Frodone – dieses zwei Kilometer lange Stück, wo der Talboden sich verbreitert, war zur Zeit unseres Großvaters noch Ackerland, das schönste im Bavonatal, wie er erzählte. Die Straße führte durch Gras und Roggen, Wiesen und Felder zu beiden Seiten, die Kühe versuchten, die Mäuerchen zu überklettern. Die Überschwemmung vom Jahr achtundsechzig hat alles fortgerissen. Stell dir nur unsere Alten vor, wie sie hingingen, sobald die Sonne wieder schien, um sich das Unglück zu besehen, ihre Gesichter, als sie dort, wo sie geackert und gedüngt hatten, nur noch Geröllhalden erblickten. Nicht einmal die Grenzsteine konnten sie wiederfinden. Manchen blieb nichts anderes übrig, als heimzugehen und ihr Bündel zu schnüren. Und so war es in Roseto, in Sonlerto, in Bolla; sogar von Gannariente heißt es, dort sei einst gutes Land gewesen.
Hin und her mit unseren Traglasten, und während sich die Reihe der Häufchen verlängerte (nachher musste man sie noch ausbreiten), kaute ich an diesem und ähnlichen Gedanken herum. Ich dachte an die von der letzten Überschwemmung stammenden Sand- und Schutthalden von Ritorto, wo man bei jedem Schritt aufpassen musste, wohin man den Fuß setzte, und fluchte halblaut vor mich hin:
«Ein Land für die Vipern!»
Antonio zuckte die Achseln. Wir hatten eine Weile lang schweigend unsere Arbeit verrichtet, aber er verstand, welcher Gedankengang mich so weit geführt hatte. Antonio zuckte die Achseln, weil er sanften Gemütes war und sich die Lehren von Don Giuseppe zu Herzen nahm: Unglück gab es für alle genug, auch für die Reichen und überall auf der Welt; wir hatten keineswegs ein Monopol darauf. Er sagte:
«Bei uns gibts wenigstens kein Erdbeben.»
Für ihn sah die Welt eben so aus. Das Leben war für alle schwer, das kam von der Erbsünde. Das Paradies musste man sich erst erwerben. Ich aber behauptete, anderswo wäre es besser; wenigstens brauchten die Leute ihre Kinder nicht großzuziehen, um sie dann wegzuschicken, wie unsere Eltern es tun mussten. Wer aber keine hatte, blieb im Alter allein wie ein ausgesonderter Ziegenbock und endete, wenn er seine ganze Habe verkauft hatte, bei der Fürsorge – und was eine arme Gemeinde wie unsere an Unterstützung geben konnte, war gerade genug, um nicht zu verhungern. Freilich, meinte Antonio, aber man müsste das Leben nehmen, wie es eben käme; wer höher hinauswollte, riskierte nur, es noch schlechter zu treffen; wer sich begnügt, der ist zufrieden, und man braucht sich nicht den Kopf zu verbinden, bevor er zerbrochen ist. Dann hielt ich ihm als Beispiel Locarno vor, wo die Leute auf ebenem Boden herumgingen und ruhige Gewerbe betrieben, die ihnen etwas eintrugen, ohne dass sie sich so plagten wie wir; in Locarno hätte man uns als Eindringlinge betrachtet, doch nach Amerika könnten wir, wenn wir Lust hatten, auf der Stelle auswandern.
«Hast du nicht gehört, was Clemente erzählt? In Kalifornien gibts nur hie und da ein paar Hügel, so bequem wie Matratzen. Dort wüsste man gar nicht, wo man hingehen soll, um abzustürzen wie der arme Arturo.»
Arturo hatte es vor ein paar Monaten erwischt, mit neunzehn Jahren. Er war im ersten Morgengrauen ein paar verirrte Ziegen suchen gegangen. Um zehn Uhr vormittags fiel unsere Tante mitten in ihrer Küche ohnmächtig zu Boden, und als man sie aufhob, befahl sie den Leuten, sich auf die Suche nach ihrem toten Sohn zu machen. Von diesem Fall spricht man noch heute im Dorf, denn Arturo war tatsächlich so um zehn herum in der Wand von Mascagna abgestürzt, mehr als zweihundert Meter tief. Sie zogen mit einem Sack aus, um ihn heimzubringen, damit das, was nicht an den Felsen hing, beisammenbliebe.
«Irgendein Loch, in das man hineinfallen kann, werden sie schon auch haben», erwiderte Antonio, und ich ärgerte mich, weil ich sah, dass mit ihm nichts zu machen war. Er glich unserem Vater, der sich mit jedem Unglück abgefunden hätte, so groß war sein Vertrauen in Gott und Gottes Gerechtigkeit, die hier nähme und dort gäbe, je nach Verdienst und Geduld.
Unser seliger Vater ließ uns keinen Abend schlafen gehen, bevor wir nicht alle zusammen gebetet und der Vorsehung gedankt hatten, dass wir in einem christlichen Land geboren waren und in einem Haus, wo wir unser Brot samt Zukost gefunden hatten. Heute, da ich die Welt durchwandert habe und weiß, dass man überall unter der Sonne verhungert, jetzt, da ich weiß, dass die Unglücklichsten die sind, die alles haben, weil sie sich nichts mehr wünschen können, vermag ich fast so zu denken wie er. Aber damals sah ich nur, wie es uns selber erging. Ich dachte an Locarno und an Amerika und war voller Groll, als hätte mir jemand unrecht getan. Wenn der liebe Gott uns liebte, sagte ich einmal zu Don Giuseppe, warum hatte er uns nicht in einer etwas angenehmeren Gegend zur Welt kommen lassen? In einer Gegend ohne Vipern und ohne Steine, an denen man sich die Schienbeine anstößt, ohne Erlendickicht, das einem das Maul zerkratzt, sagte ich, soviel ich mich erinnere. Aber den Vortrag habe ich Don Giuseppe nicht zweimal gehalten, das kannst du mir glauben; wenn man sehen wollte, wie er sich mit seinem Dreispitz auf dem Kopf kerzengerade aufrichtete, brauchte man nur die Vorsehung anzutasten.
Je schwerer das Leben war, desto eher kam man ins Paradies, davon war er überzeugt. Ans Paradies glaubte ich ja auch, aber einstweilen sagte ich zu meinem Bruder:
«In Amerika essen die ärmsten Leute alle Tag Fleisch.»
«Hast du hier vielleicht Hunger gelitten, groß und stark, wie du bist?»
«Groß und stark bin ich von Natur aus, und du weißt sehr gut, dass wir uns hier dreimal täglich mit Polenta voll stopfen. Allzu viel davon hats auch nicht immer gegeben, und ein richtiges Glas Wein haben wir, so groß wir sind, jeweils nur bei einem Leichenmahl getrunken.»
Polenta und Milch, Kartoffeln und Käse, focaccia, das wars. Roggenbrot war schon eine Ausnahme, und Fleisch sahen wir zu Weihnachten und zu Ostern oder etwa einmal im Sommer, wenn eine Kuh sich zu Tode stürzte. Wir hatten es so satt, ständig das Gleiche zu essen, dass wir zur Zeit der mazza, des Schweineschlachtens, Zimtrinde und Gewürznelken stibitzten; und die Knechte auf den Alpweiden leckten an der Salzschüssel, die das Vieh wer weiß wie oft abgeschleckt hatte. Es war das Bedürfnis nach einem Geschmack. Danach lechzten wir wie die Ziegen, bei denen du immer Gefahr läufst, dass sie dich in einen Abgrund stoßen, so gierig stürzen sie sich auf dich, wenn du ihnen das Salz bringst.
Im Herbst gab es Kastanien, die aßen wir drei Monate lang, früh, mittags und abends. Wir, die wir oben auf der Alp hockten, hatten ganz vergessen, wie andere Früchte schmeckten, denn Obst ist zu schwer, um es den Berg hinaufzuschleppen. Wir aßen die Heidelbeeren von den Alpweiden und vielleicht ab und zu ein paar Weintrauben; wir hatten nämlich ein Weinspalier, kelterten aber nicht, denn in unserer Gegend lohnt sich das nicht mehr. Die Trauben brachten sie uns nach Roseto hinüber, wo Antonio und ich bis zur Weihnachts-Novene blieben.
Dann kehrten wir mit dem Vieh ins Dorf zurück. Es gab sogar der Lawinengefahr wegen ein altes Gesetz – es besteht wohl noch immer, hat aber ausgedient –, das den Leuten befahl, spätestens bis zum Heiligen Abend wieder in Cavergno zu sein. An diesem Tag hielt der Gemeindevorsteher auf dem Platz einen Appell ab, und wenn einer dabei fehlte, ging man nach ihm schauen.
Bis auf die Leute, die unten blieben, um zu heuen, führten alle anderen das gleiche Leben wie wir; im Frühling und Herbst auf den Weiden im Val Bavona, im Sommer oben auf den Alphütten, die stundenweit voneinander entfernt lagen. Die ganze schöne Jahreszeit lang gab es im Val Bavona eine ständige Plackerei, den Saumpfad entlang und die steilen Fußwege hinauf, vom Dorf auf die Wiesen, von den Wiesen auf die Alpweiden, von einer Alp auf die andere, von einer unbequemen Hütte zur nächsten, die noch schlimmer war, einen Steig um den anderen, bis zu den höchsten Matten hinauf, wo die Kühe mehr Flechten als Gras wiederkäuten und der Mensch sich zum Heulen einsam fühlen kann. Um hinzukommen, brauchte es damals bis zu zehn Stunden Muskelkrampf unter den schweren Lasten. Wenn einige wenige sich die Mühsal des Aufstiegs ersparen konnten, so bedeutete das nur, dass sie noch schlechter daran waren als die anderen, denn falls sie nicht Land und Kastanien in Fülle besaßen, konnte es ihnen, sofern das Geringste passierte, ganz lausig ergehen.
Nein, heute macht sich niemand mehr einen Begriff davon, wie wir uns damals plagen mussten. Einsam und verloren – aber heute scheint es mir, dass ich alles gern wieder auf mich nehmen möchte, wenn ich das Roseto von einst wiederfinden könnte: ohne Auto, ohne einen einzigen Motor, nichts als das Rauschen des Baches unter den Erlen … Doch damals lastete die Stille schwer auf uns. Auf der Alp sahen wir oft wochenlang keine anderen Gesichter als unsere eigenen; und wir konnten noch von Glück sagen, wenn das Wetter schön war und wir einander überhaupt sehen konnten, sooft wir die Augen vom Melkeimer hoben. Es gab Jahre, in denen es nicht aufhören wollte, zu regnen und zu nebeln. Wenn wir morgens aufwachten, spürten wir schon in allen Knochen die Nässe, die draußen auf uns lauerte. Dann hatten wir den ganzen Tag lang nicht einmal Lust zum Reden; gerade nur das Allernötigste, ein paar einsilbige Worte und hie und da einen Fluch, den unser Vater absichtlich überhörte. Täglich wurden wir wilder und rabiater, bis wir keinen christlichen Gedanken mehr zusammenbrachten. Als wir noch klein waren, das erinnere ich mich, pflegte der Vater Samstag von der Alp Sologna bis Costa herunterzukommen, der Mutter entgegen, die ihm die Vorräte für die nächste Woche brachte. Wir Kinder, Antonio, Maria und ich, sahen vom Motto della Croce in Corte Grande aus zu, wie das weiße Pünktchen, die gerla unserer Mutter, den Weg hinanstieg, so weit er zu erblicken war; wir schrien und riefen, obwohl sie uns nicht hören konnte. Als alte Frau erzählte uns die Mutter, dass sie auf diesem Stück Weges langsam ging, weil sie wusste, dass wir dort standen und nach ihr ausschauten. Ich erinnere mich auch, dass der Südwind uns auf der Alp ein paar Mal den Widerhall der großen Glocke zutrug, und der ferne Klang machte uns sehr traurig. Es war jemand gestorben, und wir wussten nicht, wer.
Doch wenn sonntags schönes Wetter war, riefen wir uns gegenseitig von einem Berghang zum anderen mit lang gezogenen, vielstimmigen Tönen an, ganz vergnügt, dass wir einander hören und mit dem Fernglas sehen konnten. Das Glas ging von Hand zu Hand, wir schwenkten die weißen Käsetücher und stießen im Chor einen weiteren Ruf aus. Dann sagten wir: «Das muss Paolo sein. Die dort ist wohl Maria», und es fehlte nicht viel, dass wir davon überzeugt waren.