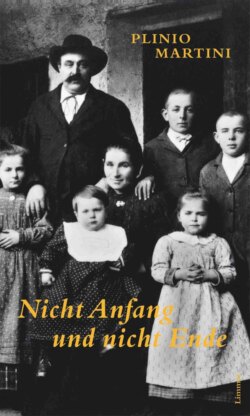Читать книгу Nicht Anfang und nicht Ende - Plinio Martini - Страница 7
ОглавлениеAber siehst du, wie schwer wir es dort auch hatten, mir scheint, es gab, solange ich in Amerika war, keinen einzigen Tag, an dem ich nicht mit einem tiefen Seufzer an unser Tal gedacht hätte. Es liegt in der Natur des Menschen, sogar den Stechginster lieb zu gewinnen, wenn er mitten darin geboren ist, sogar eine Gegend, wo du dich nicht gemütlich ins Gras legen kannst, ohne dass dir Kastanienschalen ihre Stacheln in den Hintern bohren.
In meinen letzten Jahren in Amerika musste ich hin und wieder eine Nacht in den Nightclubs von San Francisco verbummeln. Das hätte ich mir wahrhaftig nicht träumen lassen, als ich zum ersten Mal hinkam und kaum wusste, wie ich mich vor dem Tram, den Autos, den Wagen retten sollte. Mich dünkte, das Ende der Welt sei gekommen, denn bis dahin hatte ich nur den Postwagen von Lavizzara gesehen. Die durchlumpten Nächte musste ich auf mich nehmen, um geschäftliche Beziehungen zu pflegen. Damals betätigte ich mich als Grundstück- und Häusermakler und verdiente gut. Von Zeit zu Zeit kam es mir in den Sinn, wie ich in Cavergno den ganzen Tag lang Mist geschleppt hatte, und dann hatten sie mir zwei Franken gegeben … Was für ein Jammer! dachte ich voller Sehnsucht.
Unser Vater hatte sein Leben lang gearbeitet. Ferien gab es nie, nicht einmal an seinem Hochzeitstag. Als sie fertig gegessen hatten, gingen sie zusammen die Kuh versorgen. Ich kann es mir nicht einmal ausmalen, wie sie dort allein im Stall standen und sich befangen anblickten, weil sie jetzt doch Mann und Frau waren – und wie sie einander dann schüchtern halfen, die Kuh melken, Heu herunterholen, die Streu ausbreiten – wer weiß … Und wie sie später Tag um Tag morgens aufstanden, immer nur die Arbeit im Sinn, die vor ihnen lag. Die einzige Zeit, in der er sich nicht mit der Sorge um die Arbeit quälen musste, be-vor er sich noch daranmachte, war für meinen Vater der Militärdienst. Die Mutter hatte nicht einmal das gehabt; als Mädchen hatte man sie ein, zwei Mal nach Locarno mitgenommen, das war auch alles. Und nach all der Müh und Plage und Rappenspalterei mussten sie sich noch damit abfinden, uns in eine andere Welt fortziehen zu sehen. Hier verdiente ich mit meiner Unterschrift auf einem Blatt Papier mehr, als sie in fünfzig Jahren zusammengekratzt hatten … Welche der beiden Welten war die gerechtere? Gab es eine gerechtere Welt? Ich schloss die Augen und dachte: «Ihr wisst nicht, dass ich aus Roseto bin, dass ich in Corte Nuovo geboren wurde und mein Vater mich in einer gerla zur Taufe und wieder zurück getragen hat.» Das war meine Methode, es mir leichter zu machen, mein Gewissen zu beruhigen. Nicht dass ich unredliche Geschäfte betrieben hätte – aber das viele Geld, für das ich keinen Finger gerührt hatte, wo kam das her? Wer hatte es für mich erworben?
Gewöhnlich war ich bei solchen Anlässen mit Ranchern zusammen, die verbissen gespart hatten, um Geld zu machen, Leute, die es vorzogen, nicht von vergangenen Dingen zu reden, sondern rasch abzuschließen, um sich dann amüsieren zu können. Natürlich hatten wir Frauen dabei, Frauen, die so anders waren als unsere Frauen zu Hause: Sie tranken, sie tanzten, sie taten, als amüsierten sie sich, möglicherweise amüsierten sie sich wirklich. Ich nicht, ich langweilte mich. Vielleicht weil eine anfing, zärtlich zu tun und unter dem Tisch mit der Hand nach mir tastete, kam mir plötzlich meine Mutter mit ihrem baumwollenen Kopftuch in den Sinn und gleichzeitig mit dieser Erinnerung eine Art Reue, ein Überdruss an allem, was ich tat. «Wenn sie mich jetzt sähe!», dachte ich erschrocken und drehte mich um, um das alles mit den Augen unserer Mutter anzuschauen, diese Vergeudung an Licht, an Getränken, an Zigaretten, diese Weiber, diese Tänze. Letzten Endes lief das alles auf das gleiche Ziel hinaus und kein sehr hohes …
Schluss machen, sich davonmachen, nach Hause zurückkehren.
In solchen Augenblicken war mir die Musik ein Trost. Ich erinnere mich, dass mich einmal ein Neger fixierte, während er auf seiner Trompete spielte, und es war, als schrie er sein uraltes Leid, das dem meinen glich, einzig für mich aus sich heraus. Das Orchester, die Gäste, die Tische, die Kellner, alles verschwand.
Es gab nur noch ihn und mich, durch eine Kette andersartiger, aber irgendwie verwandter Erinnerun-gen miteinander verbunden. Dieses Erlebnis bewegte mich über Gebühr, denn bis dahin hatte ich die Neger mit den Augen der Rancher angesehen.
Auch in Roseto pflegten wir manchmal nach dem Rosenkranz vor der Kapelle zu sitzen und zu singen. Wir sangen Alpenlieder oder unser Valmaggia-Lied, das voraussagte, wie es später kommen würde:
E la sü in Valmagia gh’è pü da guadagn,
gh’è dumà’l me Pedro che fa sü i cavagn …*
«Jetzt gehn wir heim», befahl die Mutter an einem gewissen Punkt, und wir folgten ihr schweigend im Gänsemarsch den schmalen Weg entlang. Ringsherum sangen die Quellen, die man nachts in Roseto immerfort rieseln hört.
«Well, friend, what’s the matter?»
Ich wandte mich seufzend wieder den anderen zu.
Wann immer ich wegkonnte, nahm ich mein Auto und fuhr ins Salinas-Tal hinauf oder an der Küste gegen Santa Cruz zu, dem Grün der Weinberge entgegen. Der Wind fegte mir die Seele rein. Im ersten Morgenlicht streckte ich mich wohl auch unter einem Baum aus.
An der Küste lag die Bar eines Italieners, der seine Schürze zusammenrollte, um mir entgegenzulaufen. Er kam aus dem Val Camonica und unterhielt sich gern mit mir. Er erzählte von seinem Tal, ich von dem meinen, und dabei entdeckten wir, wie groß die Ähnlichkeit zwischen beiden war und wie viele Dinge wir auf die gleiche Art taten. Denen, die immer hier sitzen, scheint Italien ein fremdes Land zu sein, aber wenn man in der Welt herumkommt, merkt man leicht, dass die Italiener und wir aus dem gleichen Topf stammen.
Dieser Wirt aus dem Val Camonica war eines Tages aus sich herausgegangen, als er hörte, wie ich mit einem Mann aus dem Centovalli über den guten Weichkäse sprach, den wir im Mai in unseren Bergen machten.
«Ach ja», hatte er von seiner Theke her gesagt, «eher flach abrahmen und die Milch nicht zu stark erhitzen.»
Im ersten Moment blickten wir ihn beide scheel an, ohne zu antworten. In Amerika mischt man sich nicht in ein fremdes Gespräch ein, und er begann auch gleich wieder, mit seinem Tuch an der Theke herumzupolieren. Aber später wurden wir gute Freunde und unterhielten uns ganze Tage lang miteinander. Wir lachten und klopften uns gegenseitig ausgiebig auf die Schultern, und manchmal stieg uns beiden ein Kloß in den Hals, der mit einem weiteren Glas hinuntergespült werden musste. Dann kam seine Frau und schimpfte, dass sie die ganze Arbeit allein tun müsse. Der Mann blinzelte mir zu und verschwand, doch nach zehn Minuten war er wieder da.
«Weiber und Ochsen», sagte er, sich vorsichtig umblickend.
«Ja, ja», seufzte ich, und wir saßen mit gesenktem Kopf da und folgten diesem Gedankengang. Doch als wir dann aufblickten und jeder den anderen so belämmert sah, brachen wir in ein schallendes Gelächter aus. So begannen wir von unseren Frauen daheim zu sprechen, die in ihren zu langen Kleidern so spröde, aber letzten Endes begehrenswerter sind.
«Machts dir etwa Spaß, wenn du dich eine halbe Stunde abarbeiten musst, um nur ein Knie zu erblicken?»
Über alles redeten wir. Ich erinnere mich, dass wir einen ganzen Nachmittag lang verglichen, wie man einerseits bei uns und andererseits bei ihnen drüben die Messe sang. Wir probten die einzelnen Motive in lang gezogenen Tönen durch und freuten uns über die Ähnlichkeiten, die wir entdeckten.
Ein so armes Dorf wie unseres – und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Erinnerungen es im Herzen eines Menschen zurücklässt, der fortmusste. Ich sage dir, in Amerika trugen wir Auswanderer unser Heimweh wie eine Krankheit in uns herum, und mit einem reden zu können, der aus unserer Gegend kam und unsere Art kannte, das war nicht das Gleiche wie mit anderen Leuten. Wir waren alle aufgewachsen, ohne je Zeit zum Spielen zu finden, und dann hatten wir den großen Sprung hier herüber getan, um zwölf Monate im Jahr zwölf Stunden täglich zu arbeiten. Das wäre nicht so schlimm gewesen, nicht anders als vorher jedenfalls, wenn wir nicht dieses große Heimweh mit uns herumgeschleppt hätten. Es zog uns zueinander, wir brauchten uns nur in die Augen zu schauen, um uns weniger einsam zu fühlen.
Im Herbst sah ich immer öfter auf den Kalender und dachte an die Arbeiten, die sie jetzt daheim verrichteten. Dann schrieb ich und erkundigte mich nach der zweiten Ernte und nach den Kastanien. Die Antwort kam zu Weihnachten, wenn ich gern gewusst hätte, ob schon Schnee gefallen war und wie viel. Die Mutter schrieb: «Dieses Jahr gibt es wenig Kastanien, aber Gott sei Dank sind sie gesund und süß, und die Kartoffeln sind schön, obzwar man sie nicht im Skorpion gesetzt hat.» Diese Nachrichten machten mich träumerisch, und ich schnupperte sogar an dem Brief, ob er nicht ein bisschen nach zu Hause roch. Dem Antonio schrieb unsere Mutter über die verschiedenen Leute, wer geboren, gestorben oder neu verheiratet war, und von außergewöhnlichen Festen. Aus den Briefen war zu sehen, dass die Welt sich auch hier ein klein wenig verändert hatte und dass es den Leuten in unserem Tal allmählich besser zu gehen begann.
Doch schon zu unserer Zeit und bei all unserer Mühsal war der Herbst im Grunde eine christliche Jahreszeit und brachte lauter Arbeiten, die einem Freude machten. Wir kamen mit dem Vieh von der Alp zurück und trafen einander auf den Straßen im Dorf oder draußen im Tal. Die Arbeit war leichter als oben auf den Bergen, und wir zogen gern die Zeit im Wald oder auf dem Feld in die Länge, vor allem weil das eine der wenigen Gelegenheiten war, einem Mädchen allein zu begegnen. Nicht dass wir dann etwas Besonderes getan hätten. Sobald wir uns Guten Tag gewünscht hatten, sprachen wir gleich vom Wetter, denn jeder Bauer ist bekanntlich ein Astrologe.
Se piove per l’Ascensione
tutte le vacche a borlone.
Quando tuona di novembre
chi ha due vacche una la vende.*
Wenn die Sprichwörter es richtig trafen, wenn die ersten Märztage wirklich das Wetter im Juni bestimmt und die Saaten sich nach den Sternbildern gerichtet hatten – denn der Skorpion macht Bauchweh, die
Fische verwässern, die Jungfrau geht in die Blüte, mit dem Stier und dem Löwen ist gut pflanzen –, dann beredeten wir das, um uns noch länger ansehen zu können, und wer kann sagen, welch heimliche Wärme dabei in uns aufstieg.
Zu Allerheiligen quollen die Lauben vor Fülle über. Da hingen die Maiskolben und Zwiebeln, und auf dem Boden reihten sich Körbe voller Kastanien, Nüsse, Rüben, Randen, Bohnen und Kürbisse. Unser ganzer kärglicher Reichtum bot sich der Sonne dar. Manchmal genügte er nicht, um die Familie durch den Winter zu bringen, aber hier will ich nur sagen, wie schön es war. Im Gegensatz dazu sind die Lauben heutzutage ein wahrer Jammer, und anstatt Bohnen zu pflanzen, kauft man sie in Büchsen bei der Migros. Wir brachten die Kastanien in die Mühle, und der Müller gab uns das süße Mehl zurück. Sein Duft drang in die Gänge und Stuben, durchtränkte die Dielen und Zimmerdecken, die Schränke und die Kleider darin. Das ganze Haus roch danach, es war unser ureigener Geruch.
Dann kam das Schlachten und danach Weihnachten. Im Januar schafften wir das Holz aus dem Val Bavona mit Schlitten ins Dorf hinunter. Wir dachten, die Welt ginge immer im gleichen Schritt weiter, aber mit diesem Schritt traten wir auf der Stelle, und zu unserem Unglück oder unserem Glück wussten wir es nicht. Während wir die Talgkerzen mit canapuli anzündeten, um die Zündhölzer zu sparen, die dreißig Centesimi per Paket kosteten, gab es woanders Häfen und Städte, wo die Menschen sich in Wolkenkratzern zusammendrängten. Wir waren eine Insel außerhalb der Zeit, die letzte Hand voll Mehl auf dem Grunde des Sackes. Schon damals begannen die Sommergäste aus dem Hôtel du Glacier in Preda ins Val Bavona und bis auf die Alpweiden vorzudringen, um uns zu besichtigen, als ob wir Rothäute wären. Sie fotografierten uns sogar, und wir Trottel stellten uns mit unserer gerla auf dem Rücken in Positur. Weiß Gott, in welchen Häusern von London oder den englischen Kolonien unsere Gesichter schließlich endeten, um luxusübersättigte Menschen zu amüsieren.
Der Winter war die Zeit der Frömmigkeit und Andacht. Allerheiligen, Weihnachten, Neujahr, Quarantore, San Faustino – Don Giuseppe striegelte unsere Seelen nach Kräften. Der Winter gehörte ihm, und er zwang uns, zu Gottes Ehre in der Kirche mit den Zähnen zu klappern. Manchmal war das Weihwasser im Becken gefroren. Sogar die Kleinsten riss man früh um sechs aus dem warmen Bett, um sie in die Messe zu schleppen, und es kam vor, dass man so ein armes Kerlchen nach dem Gottesdienst wachrütteln musste, weil es in der Bank eingeschlafen war. Don Giuseppe wusste jeweils genau, wer geschwänzt hatte, und wusch dann den allzu zärtlichen Müttern im Beichtstuhl kräftig den Kopf. Auch wenn man es nicht eigens darauf anlegte, gab es immer besondere Andachtsübungen, von Oktober bis Mai wimmelte der Kalender nur so davon: der Monat des Rosenkranzes, die Oktave von Allerheiligen, die Novene der unbefleckten Empfängnis und die Weihnachtsnovene; dann die Bußgebete für den Karneval, den sie anderswo feierten, die Fastenzeit und die Viae Crucis, die Karwoche, der Monat des heiligen Joseph und schließlich der Marienmonat – all das, ohne die Novenen und Tridua für die Gunst der Jahreszeit oder für irgendeine von einer frommen Person erbetene besondere Gnade mitzuzählen. Dazu kamen noch die Totenwachen und die verschiedenen Seelenmessen. Zuweilen häuften sich die frommen Anlässe, man wurde überhaupt nicht mehr fertig damit. Wenn Don Giuseppe in der Karwoche nach der nicht enden wollenden Frühmesse, die auf Lateinisch (wovon unsereiner kein Wort verstand) gelesen, deklamiert, gesungen wurde, noch den Rosenkranz zu beten begann, hasste ich ihn geradezu. Und ich denke an die ledigen Frauen, die nie den Trost einer männlichen Liebkosung empfangen hatten und denen es bestimmt war, so ihr Leben zu beschließen, Jungfrauen wie dürre Blätter, die Hände zum Gebet gefaltet; wenn die Arbeit in Feld und Stall getan, wenn sie zu ihren verheirateten Schwestern gelaufen waren, die ihre Hilfe brauchten, mussten sie sich auch noch in der Kirche sputen, fegen und putzen, Leuchter auf Glanz bringen, Chorhemden und Standarten flicken und dabei den gewohnten Rosenkranz für die Rettung unserer Seelen beten.
Wenn der Gottesdienst eine langweilige Angelegenheit war, muss man hingegen zugeben, dass es schön war, wie wir an den hohen Feiertagen alle gemeinsam sangen. Manchmal legten sich die Burschen ins Zeug, als riefen sie die Ziegen zusammen, so dass Don Giuseppe sich zum Eingreifen bewogen sah, gerade auf dem Höhepunkt. Dann drehte er sich finster um und ließ den Blick eine gute Minute lang auf den gesenkten Köpfen ruhen. Der Gesang brach ab, und es wurde ganz still in der Kirche. Don Giuseppe wandte sich wieder dem Altar zu. Man vernahm ein allgemeines Rauschen und Regen, ein Aufatmen bis ganz hinten zu den Frauen, und der Gottesdienst ging in einem anderen Tempo weiter.
Im März mussten wir Ziegenhirten schon das Tal hinaufwandern. Wir ließen Don Giuseppe mit seiner lästigen Heiligkeit im Dorf zurück, aber wir kamen auch um jede andere Gesellschaft, denn in der Regel waren wir jeweils allein oder zu zweit auf einer Weide, ganz verlassen mitten im Schnee. Allmählich begann ein Weg nach dem anderen zu dampfen, der Schnee zog sich gegen die Gipfel zurück, die Veilchen kamen heraus, wir säuberten die Wiesen von der alten Streu, die Bäume belaubten sich, und zum Fest von Gannariente war das ganze Tal bevölkert.
Sonntags kehrten alle, die es konnten, in die Dörfer zurück. Samstagabend oder Sonntag früh kamen wir gruppenweise daher, jeder mit der gerla oder der cadola auf dem Rücken, um Butter, Käse, Quark und geschlachtete Zicklein hinunter- und Brot, Mehl, Zucker und Kaffee zurückzuschleppen. Sogar die Buben waren bepackt wie die Maultiere.
Peter und Paul war das letzte Fest für uns, die auf die Alp hinaufmussten, von da an verlor sich die Zeit in den Sommer. Der Sommer war groß, er schien nie enden zu wollen, und wir blickten von der Höhe auf die Mulde unseres Dörfchens hinab wie auf ein verlorenes Glück. Mit Gottes Hilfe kam Sant’Abbondio heran. Die Hausväter stiegen zu den Hütten auf, um ihre Kühe ins Tal zu treiben, und ein paar Tage später, zum Fest der Madonna di Fontanellata, konnten wir hinunter, um unsere Älplerbärte bewundern zu lassen. Dann warfen die heiratsfähigen Mädchen rasche Blicke umher, und wir standen in Gruppen beisammen und sangen. Es war Herbst, die Jahreszeit, da man weder schwitzen noch zähneklappern muss, die Zeit, in der auch der Ärmste etwas im Suppentopf hat. Wir durften sogar lustig sein, und wenn man in Amerika an all das zurückdachte, schien es noch schöner als in Wirklichkeit.