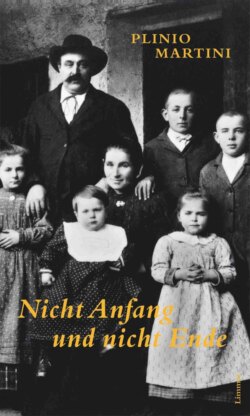Читать книгу Nicht Anfang und nicht Ende - Plinio Martini - Страница 9
ОглавлениеJa, in unserem Dorf gab es Not und Elend genug, aber gerade darum kümmerte man sich umeinander und half sich gegenseitig weiter. Wir, die Valdi, konnten uns noch zu den Glücklichen zählen, denn unser Vater besaß das Weiderecht für fünfzehn Kühe und zwei Fuß auf der Alp Sologna, und zwischen Roseto und Cavergno brachten wir Heu für anderthalb Kühe und zwei Dutzend Ziegen zusammen. Dank dem Käse von der Alp hatten wir zu Hause niemals richtigen, nackten Hunger kennen gelernt. Um zu merken, wie gut wir dran waren, brauchten wir nur die Tuni- oder die Cavergni-Kinder anzusehen oder gar die neunzehn Sprösslinge des armen Brasca; die waren so elend, dass keines von ihnen auf den Beinen stehen konnte, bevor es vier Jahre alt war, und die wenigen, die überhaupt davonkamen, blieben ihr Leben lang krumm und schief.
Den Cavergni bin ich viele Jahre später in Kalifornien begegnet, wohin alle drei Söhne auswanderten.
Als wir dort von unserer Kindheit sprachen und wie schwer wir uns durchgeschlagen hatten, erzählten sie mir, wie ihr Vater es anfing, sie satt zu machen, nachdem die Mutter gestorben war; die war allzu oft mit leerem Magen schlafen gegangen, weil sie den Kleinen nichts wegessen wollte. Nun, der Vater pflegte für ein paar Soldi den Abfall von den Sennhütten zu kaufen, verdorbenen Quark und Käse, den man sonst den Schweinen verfütterte. Das füllte er, tüchtig gesalzen und gepfeffert, in eine Holzbütte, und die Kinder mussten es essen, womöglich mit den Würmern darin; oder er tat das Zeug in die Wassersuppe, die dadurch zu einem Schweinetrank wurde. Aber Hunger tut weh, die Kinder aßen, und die Bütten waren ständig leer und harrten der Nachfüllung. Der Vater Cavergni betrank sich, sooft er konnte, und ich dachte bei mir, auf diese Weise hätte er sich wohl das Geld für seine Räusche zusammengespart; damals war ich noch nicht einsichtig genug, um zu begreifen, dass die Trunksucht eine Krankheit ist, die man sich zuziehen kann wie jede andere.
Das ist der traurigste Fall, den ich von Cavergno weiß, bis auf die Geschichte von dem Jungen, der vom Lehrer heimgeschickt wird, um sein vergessenes Heft zu holen, und niemand zu Hause findet. Er hört aber ein Geräusch im Keller und steigt mit angehaltenem Atem hinunter. Da sieht er seine Eltern, die sich im Geheimen gütlich tun, an Brot und Salami und Wein, lauter Sachen, die man nie im Haus gesehen hatte. Der Junge, auch so einer, dem vor lauter Wassersuppe die Gedärme heraushingen, wagte keinen Mucks zu tun und lief davon.
Am allerschlimmsten erging es den Brasca. Ihr Vater stammte nicht aus unserer Gegend, er war aus Bergamo zugewandert und hatte ein Mädchen von Cavergno geheiratet, das einen Fehltritt begangen hatte. Nicht dass die Leute ihn deswegen scheel ansahen; im Gegenteil, die wenigen, die es vermochten, halfen ihm, sozusagen hinterrücks und mit List, denn der Brasca war überempfindlich und behauptete, er könne alles aus eigener Kraft leisten. Doch außer ein paar Wiesen, die seine Frau in die Ehe gebracht hatte, besaß er kein Land, keine Kastanien und weder Holz- noch Weiderechte, wie sie uns als Gemeindebürgern zustanden. Du kannst dir vorstellen, wie es da mit den vielen Kindern ging.
Ich sehe sie noch vor mir, wie sie mit ihren struppigen Köpfen und ihren zerfetzten Lumpen in der Schule saßen, und in diesen Lumpen und Fetzen konnte ich für mein Teil die Hemden meines Vaters, meine eigenen Hosen und Don Giuseppes Soutane erkennen. Schulhefte hatten sie, weil die von der Gemeinde bezahlt wurden, aber schmutzigere Hefte hat es nie gegeben: große, zittrige Buchstaben und dazwischen Fettflecken, Tintenkleckse, Tränenspuren, zerquetschte Läuse und was man sonst noch will. Wo immer die armen Kinder hinkamen, wimmelte es nachher von Flöhen und Läusen. Die Läuse waren am schlimmsten, aber ich muss sagen, dass sie sich bei uns zu Hause niemals richtig einnisteten, denn unsere Mutter sparte nicht mit Wasser; wenn wir welche von der Schule heimbrachten, weil wir die Köpfe mit den Brasca zusammengesteckt hatten, sagte die Mutter seufzend, wir müssten Geduld haben, das Jesuskindlein in Nazareth hätte sicher auch Läuse erdulden müssen. Uns rasierten die Eltern den Schädel – wenn es Not tat, sogar den Mädchen – und wuschen uns immer wieder mit Wasser und Tabaklauge, aber wie konnte es bei den Brasca aussehen? Eine solche Kinderschar, der Brunnen weit entfernt, und die Mutter erholte sich zwischen einer Geburt und der nächsten nicht mehr so weit, dass sie das Bett verlassen konnte. Zum Glück schaute der Herrgott von Zeit zu Zeit hinab und holte sich ein Engelchen.
Ich weiß nicht, wie viele von den neunzehn am Leben blieben, denn ich ging nach Amerika, und sie verschwanden der Reihe nach aus dem Dorf, das eine dahin, das andere dorthin. Benedetto – auch ein passender Name für einen Brasca! – schaffte es sogar, nach Kalifornien zu kommen. Weil er verkrüppelt war und keine Frau fand, schrieb er seiner Mutter von dort einen Brief voller Anklagen und Beschimpfungen – wenn ichs recht bedenke, hätte man ihn lieber aufhängen sollen, ehe er einen solchen Brief verbrach. Ich erinnere mich, wenn wir auf dem Feld waren und den Klang der Kindertotenglocke hörten, der unsere Mutter so traurig machte, pflegte sie ein wenig nachzudenken und dann zu seufzen:
«Das ist sicher eins von den Brasca.»
Und gewöhnlich hatte sie richtig geraten.
Allerdings wusste unsere Mutter ungefähr, was bei den Brasca vorging, denn bei all ihren eigenen Sorgen packte sie ab und zu ein Bündel zusammen und brachte es der armen Frau auf ihrem Lager; was man aus Barmherzigkeit gibt, gereicht einem zum Segen, nicht wahr. Die Sachen wuchsen auch bei uns nicht auf den Bäumen, und um uns milder zu stimmen, erzählte die Mutter die Geschichte vom Lämpchen.
Die Mutter Brasca hatte mitten in der Nacht das Lämpchen mit einem Bröselchen Butter angezündet, um einen Blick in die Wiege zu tun, wo das Jüngste lag. Und als der Mann über die Verschwendung schimpfte, hatte sie weinend geantwortet: «Jetzt können wir nicht einmal mehr Licht machen, um unsere Kinder sterben zu sehen.» Tatsächlich hatten sie am nächsten Morgen zum Ave wieder einmal die Totenglocke für ein Brasca-Kind geläutet.
«Merkt es euch, Kinder, auch wenn ihr so alt werdet wie der allocco, werdet ihr nicht Zeit genug haben, dem Herrgott für alles zu danken, was er euch gegeben hat», sagte unsere Mutter. Dann wischte sie sich die Tränen ab und blieb eine lange Weile stumm, weil sie sich an unsere Vittorina erinnerte.
«Ich bin mit schuld daran, dass die Kleinsten sterben mussten», erzählte mir vor ein paar Jahren die arme Caterina, die Älteste der ganzen Brasca-Schar, die als Einzige im Dorf geblieben und alt geworden war. Und sie erklärte: «Ich sollte sie füttern, aber ich hatte solchen Hunger – wenn ich kostete, ob der Brei richtig warm war, konnte ich nicht der Versuchung widerstehen, ihn zu verschlingen …»
Und dazu machte sie ein Gesicht, als schmecke sie jetzt noch die paar Löffel Brei.