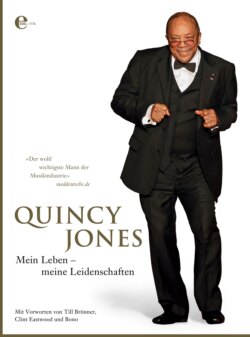Читать книгу Quincy Jones - Quincy Jones - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJoseph Powe war mein erster Musiklehrer. Ich passte kostenlos auf seine Kinder auf, als ich elf war, damit ich seine Bücher über Arrangement und Notation lesen konnte. Er war elegant und würdevoll. Ich fand, dass man als Erwachsener so sein sollte wie er. – Q
SCHULJAHRE
Als Quincy in den späten 1940er-Jahren die Garfield Highschool besuchte, galt diese als die fortgeschrittenste integrierte Schule in Seattle. Weiße, Asiaten, Afroamerikaner – alle wurden in einen Schmelztiegel gesteckt. Wenn man Musik für alle Menschen machen will, ist es hilfreich, allen Arten von Menschen zu begegnen – Jimi Hendrix machte dieselbe Erfahrung, als er ein Jahrzehnt später auf die Garfield ging. Das multiethnische Umfeld war die Basis für den bunten Mix aus Stilen und Menschen, der Jones’ Arbeit und Leben durchziehen sollte. In Garfield – zu jener Zeit waren Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen selten – lernte er ein weißes Mädchen namens Jeri Caldwell kennen.
»Über den Rassenunterschied habe ich mir nie Gedanken gemacht, der spielte überhaupt keine Rolle«, betont sie ein halbes Jahrhundert später. »Er war ein sehr angenehmer und charismatischer Mensch.« Gleich bei der ersten Begegnung mit ihrer Mutter verkündete Quincy, er wolle Jeri heiraten. Obwohl sie ihre Tochter drängte, die Sache bis zur Abschlussprüfung auf sich beruhen zu lassen, konnte Jeri nicht so lange warten. Einige Jahre später wurde seine erste Frau auch die Mutter seines ersten Kindes.
In der Highschool lernte Quincy allerhand Dinge, und er lernte die Liebe kennen. Aber seine wahre Ausbildung fand außerhalb des Klassenzimmers statt. Schon als Schüler verdiente er Geld in vielen lokalen Bands. »Wir hatten jeden Abend drei Auftritte«, berichtet er stolz. »Wir spielten auf den Dinners der weißen Tennisclubs und anschließend für die Stripper der schwarzen Clubs. Wir machten Comedy, spielten Tanzmusik, Rhythm &Blues, Schottische, Sousa, Debussy … und auf Bar-Mitzwas. Wir ließen nichts aus, Mann. Und ich war froh darüber.«
Von Ray Charles lernte Jones etwas sehr Wichtiges: »Wir versuchten, die Schottischen wie Bebop klingen zu lassen. Und Ray Charles sagte dann immer: ›Lasst jeder Musik ihre eigene Seele.‹ Das ist ein toller Rat. Zwing einer anderen Seele nicht deine Vorstellung auf. So denke ich inzwischen auch über andere Kulturen – und das Leben allgemein.«
Quincy Jones hatte ein Musikstipendium von der Seattle University erhalten, doch er fand das Angebot nicht besonders interessant. Mit dem Stipendium vom Bostoner Schillinger House hatte er es zwar aus Seattle herausgeschafft, aber in den Mauern der Lehranstalt wurde es ihm bald zu eng. Den Verlockungen des Big Apple lässt sich schwer widerstehen, wenn man nur in den Zug zu springen braucht, und so dauerte es nicht lang, bis Jones das Studium an den Nagel hängte und sich in das Zentrum des Jazzuniversums, New York City, stürzte.
© Courtesy of Quincy Jones
© Courtesy of Berklee College of Music
Q und Larry Berk, der Gründer des Berklee College
© Courtesy of Quincy Jones
© Courtesy of Quincy Jones
Mit diesen Noten erhielt Q das Musikstipendium.
© Courtesy of Quincy Jones
Q und Jeri Caldwell
RAY CHARLES
Kurz nachdem seine Familie von Bremerton nach Seattle gezogen war, ging Jones in den Elks Club, um sich einen 16-jährigen Sänger anzusehen, der neu in der Stadt war. Quincy, selbst erst 14 Jahre alt, war begeistert von dem blinden Musiker, der sich in Florida in einen Bus gesetzt hatte, um seine Heimat so weit wie möglich hinter sich zu lassen, ohne im Pazifik zu landen. Ray Charles’ Musik, dieser Mix aus Gospel und R&B faszinierte ihn, aber nicht nur das: »Ray war kaum in Seattle angekommen und hatte schon zwei Freundinnen und seine eigene Wohnung, während ich noch zu Hause wohnte – mit zwei Anzügen und einem Plattenspieler. Er war mir hundert Jahre voraus, Mann !«
Wenn man am Anfang seiner Karriere steht und dabei ist, sein Potenzial zu entdecken, ist ein Freund sehr hilfreich, der einem zeigt, wo es langgeht – vor allem, wenn dieser Freund schon einen steinigen Weg hinter sich hat. Wenn er es geschafft hat, schaffst du’s auch. »Man hat Ray wohl vergessen zu sagen, dass er blind ist«, staunt Jones. »Ray benahm sich nie wie ein Blinder, außer wenn ein attraktives Mädchen in der Nähe war. Dann wurde er plötzlich ganz hilflos, stieß gegen Wände und Türen und versuchte so, sie ins Bett zu kriegen. Ich schneite oft bei ihm zum Essen rein. Er bereitete ein Hähnchen in seiner Küche zu – ohne Licht und bei heruntergelassenen Jalousien. Nach dem Essen setzte er sich ans Klavier und zeigte mir, was er konnte. Und ich verschlang alles: sein Brathähnchen, sein Wissen, seine Freundschaft. Er brachte mir sogar Blindenschrift bei. Ray war für mich ein Vorbild, eines von wenigen in dieser Zeit. Er wusste mehr vom Leben als ich.«
Ray Charles wusste etwa, dass Musik ein riesiges Gumbo war, dessen Zutaten in einem Topf zusammengerührt werden müssen, statt sie getrennt zu kochen. Zu Beginn seiner Karriere »sang Ray Charles wie Charles Brown und Nat Cole und spielte Altsaxofon wie Charlie Parker. Aber als er aus Kalifornien zurückkehrte, hatte er sich neu erfunden und spielte auf einmal Gospel. Er wollte sich keine Grenzen setzen. Wir liebten beide Bebop. Ray war so gut, dass er sich im Elks Club in der Jackson Street Battles mit dem großen Saxofonisten Wardell Gray lieferte – auf dem Saxofon! Aber Ray liebte auch Blues, Country-and-Western und klassische Musik«. Und er scheute sich nicht, etwas zu riskieren und sich dafür Spott einzuhandeln, wie zum Beispiel, »als er ein Wurlitzer-Klavier kaufte und sich ins Wohnzimmer stellte. Es hörte sich dünn und blechern an. Zuerst lachten alle über Rays albernes kleines Elektropiano, aber als er darauf den Hit ›What’d I Say‹ geschrieben hatte, lachte niemand mehr«.
Eines der größten Geschenke von Ray an Quincy war, dass er ihm zeigte, wie er die Musik, die ihm im Kopf herumschwirrte, in ein Arrangement umsetzen konnte. Nur so wurde daraus echte, lebendige Musik mit mehr Soul und Tiefe als alles, was die zwei unter sich ausbrüten mochten, egal wie viele Instrumente sie beherrschten. »Ray eröffnete mir die Welt des Arrangierens«, sagt Jones. »Ich versuchte hinter das Geheimnis zu kommen, wie man vier Posaunen, vier Trompeten und fünf Saxofone denselben Song spielen lässt. Ray erklärte mir, wie man ein Arrangement schreibt. Ich war unglaublich wissbegierig und sog alles auf.«
In den frühen 1950er-Jahren spielte Quincy Jones in Lionel Hamptons Band und Ray Charles in der Band von Lowell Fulson, aber ihre Wege kreuzten sich häufig. Jones sagte allen: »Ihr müsst euch meinen Mann aus Seattle anhören.« Auch als Jones an die Ostküste zog, konnte das die musikalische Gemeinschaft der Freunde nicht ernsthaft stören. Er arrangierte einige von Rays besten Aufnahmen aus den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren. Auf dem Album Genius + Soul = Jazz von 1960, das unter anderem Charles’ Top-Ten-Instrumentalhit »One Mint Julep« enthielt, gaben die beiden sich sanft und rau zugleich. Weitere gemeinsame Projekte folgten. So sang Charles den von Jones mit Alan und Marilyn Berman komponierten Titelsong des Films In der Hitze der Nacht von 1967, zu dem Jones die gesamte Filmmusik schrieb. Wie Charles transzendierte Jones musikalische Genres, als er ein klassisches Stück schrieb, dass Charles Anfang der 1970er-Jahre mit dem Houston Symphony Orchestra aufführte: »Black Requiem«, das Jones zufolge »den Kampf der Schwarzen in den USA seit Beginn der Sklaverei« thematisiert.
Ray und Quincy gingen einen weiten Weg von den Clubs in Seattle, in denen sie sich einst kennenlernten. Doch beide hatten ihn bewusst zurückgelegt, jeder in seiner unverkennbaren Art – und auch als Team, wenn sich die Gelegenheit ergab. »Ray und ich träumten früher von all den Sachen, die unmöglich schienen, die es noch nie gegeben hatte«, sagt Jones. »Schwarze Komponisten, die Filmmusik schreiben oder Symphonien. Aber schließlich machten wir genau das. Ich schrieb ›Black Requiem‹ für ihn, und wir machten ›In the Heat of the Night‹ zusammen und ›I’ll be Good to You‹ mit Chaka Khan. Wir machten auch ›We Are the World‹ zusammen. All unsere Träume verwirklichten wir gemeinsam.«
© James Roark
Qs Bigband 1971 mit Ray Charles in der Merv Griffin Show
Ankündigung eines Konzerts anlässlich von Qs 50. Geburtstag, 1983
© Quincy Jones Productions
Q und Ray im Musikvideo zu »I’ll Be Good to You«
© Courtesy of the American Academy of Achievement
Q und Ray bei Qs Aufnahme in die American Academy of Achievement in Minneapolis 1984
© Courtesy of Quincy Jones
Q, nicht Ray!
LIONEL HAMPTON
Quincy Jones erzählt, wie er mit der Band des Vibrafonisten und großen Swingjazzers Lionel Hampton beinahe auf Tour gegangen wäre. »Hampton wollte mich in seiner Band haben, als ich 15 war. Ich saß schon Stunden vor der Abreise im Tourbus, damit er seine Meinung nicht mehr änderte oder meine Eltern Wind von der Sache bekamen. Schließlich stiegen die Jungs aus der Band ein, und Lionels Frau sagte: ›Was macht dieses Kind denn hier?‹ Lionel antwortete: ›Den hab ich gerade engagiert.‹ Darauf sagte sie zu mir: ›Komm her, Schätzchen. Steig aus dem Bus aus und geh zurück zur Schule. Wir unterhalten uns später.‹ Das hat mich so verletzt und traurig gemacht wie nie etwas zuvor, weil es mein Traum war, mit dieser Band zu spielen. Sie war größer als Louis Armstrong, Count Basie oder Duke Ellington. Hampton und Louis Jordan hatten in den 1940er-Jahren so was wie die ersten Rock-’n’-Roll-Bands.« Kurz nachdem er sein Studium im Schillinger House begonnen hatte, wurde Quincy, damals noch immer ein Teenager, erneut in Hamptons Band eingeladen. Diesmal hielten ihn keine familiären oder schulischen Verpflichtungen mehr zurück, und so sagte er überglücklich zu.
Jones merkte bald, dass es ziemlich anstrengend war, in einer der berühmtesten Bigbands zu spielen, denn Hampton »war gnadenlos. Er ruhte nicht eher, bis das Publikum tobte! Jede Nacht … er kannte da keine Grenzen. Die alten Hasen warnten mich: ›Pass auf, wenn du total aufgedreht bist und eine große Show abziehst, weil du das dann jede Nacht machen musst. Du kannst das nicht einmal tun und dann plötzlich aufhören – das gehört dann einfach zur Show.‹
Das Klatschen machten wir mit Handschuhen, die im Dunkeln leuchteten. Das war Showbusiness. Hamps Band war eine Showband, er hatte fünf Sänger und Tänzer. Ich hab’s geliebt«.
Aus einem seiner ersten Interviews von 1954 wird klar, dass Quincy Jones schon damals wusste, dass seine Zeit mit Hampton etwas ganz Besonderes war. »Diese anderthalb Jahre auf Tour mit Hampton brachten mir zehn Jahre an Erfahrung«, sagte er dem Downbeat. »Ich beobachtete alles und lernte viel dazu.« Nicht nur musikalisch, auch in seinem äußeren Erscheinungsbild musste er sich in die Band einfügen. Dabei lief man allerdings Gefahr, in peinliche Situationen zu geraten, wie Jones am eigenen Leib erfuhr, als sein Bandleader ihm »ein besonderes Outfit« aufdrückte, das aus »lila Shorts, Socken und Schuhen, lila Mantel und Tirolerhut« bestand. Hamp ging die Treppe hoch und wir hinter ihm her, und da standen plötzlich Miles, Charlie Mingus, Thelonious Monk, Bud Powell, Bird, all diese coolen Typen. Unsere Idole! Wir wären vor Scham gestorben, wenn die uns in diesen Klamotten gesehen hätten. Also liefen Clifford [Brown] und ich die Treppe wieder runter und taten so, als würden wir unsere Schuhe zubinden. Weil wir es nicht über uns brachten. Es war uns zu peinlich. Da prallten die Stile echt aufeinander.«
© Courtesy of Quincy Jones
Von links nach rechts: Anthony Ortega, Clifford Scott, Jimmy Cleveland, Q und Oscar Estelle performen »Kingfish«.
© Courtesy of Quincy Jones
Art Farmer, Q, Lionel Hampton (im Hintergrund) und Walter »Suede« Williams
© Courtesy of Quincy Jones
Zeitungsausschnitt, indem Q als neues, brillantes Mitglied von Hamptons Band erwähnt wird.
© Courtesy of Quincy Jones
Sitzend von links nach rechts: Joyce Bryant, Lionel Hampton, Johnny Ray; stehend von links nach rechts: Gil Bernal, Billy May, Jimmy Scott, Junior Parker, Q, unbekannt
© Courtesy of Quincy Jones
Aufnahmesession mit Hamptons Band
© Courtesy of Quincy Jones
Gladys Hampton
© Courtesy of Quincy Jones
Rechte Seite: Erinnerungen von Quincy Jones an Gladys Hampton
EUROPATOURNEEN
Jazz ist eine große amerikanische Kunstform, die in erster Linie von schwarzen Amerikanern ausging. Deshalb ist es eine grausame Ironie des Schicksals, dass viele schwarze Jazzmusiker erst nach Europa reisen mussten, um die verdiente Anerkennung zu bekommen. Wie alle schwarzen Jazzmusiker in den 1950er-Jahren hatte auch Quincy Jones in seiner Heimat den Rassismus am eigenen Leib erfahren müssen. Zu seiner Freude stellte er bei seinem ersten Besuch in Europa fest, »dass man dort Jazz als reine Kunstform ansah. Wir waren alle sehr empört, weil Amerikaner das offensichtlich nicht so sahen. Die denken wohl, wenn das was zu tun hat mit Afroamerikanern, die in einem Bordell spielen, kann es nicht besonders wichtig sein.
Ich werde nie die höchst einfühlsamen Worte vergessen, die uns ein Führungsmitglied einer politischen Organisation mit auf den Weg gab, kurz bevor wir in den Flieger stiegen: ›Ich möchte Sie und IHRE LEUTE nur daran erinnern, dass Sie dort drüben die Vereinigten Staaten repräsentieren. Wir bitten Sie deshalb, Ihren Veranlagungen möglichst diskret nachzugehen‹«.
Jones erlebte die erstaunlichsten Dinge 1953 auf seinen Welttourneen mit Hampton und drei Jahre später als Trompeter, Arrangeur und musikalischer Leiter von Dizzy Gillespies Band, auf der ersten Tour dieser Art, die vom Auswärtigen Amt der USA unterstützt wurde. Die Ankunft in Beirut etwa war »ein Schock. Als wir am Flughafen ankamen, warteten da 3000 Menschen. Wir sahen Außenminister John Foster Dulles aus einer Regierungsmaschine steigen, die auf dem Weg nach Israel war. Wir dachten erst, die Menge wäre seinetwegen gekommen, aber die Leute waren da, um uns zu begrüßen. Es war heiß und schmutzig, und die Lage war wegen politischer Unruhen gerade ziemlich angespannt. Wir waren sehr weit weg von zu Hause, in einer fremden Welt, unter Menschen, die für Dinge kämpften, über die wir rein gar nichts wussten. Als das Konzert bevorstand, konnte niemand sagen, ob wir auf der Bühne sicher sein würden, aber Dizzy dachte gar nicht daran, den Auftritt abzublasen. Er sagte: ›Fuck it, wir sind hier, um zu spielen‹, und das taten wir dann auch. Überall wurde uns große Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit entgegengebracht. Die Fremden behandelten uns besser als unsere Landsleute«.
Lionels Band war mein Traum. Sie bot das volle Programm: ernsthafte Musik, Unterhaltung und Showbusiness. Für mich war das die erste Rock-’n’-Roll-Band, der es darum ging, einen großen funky Beat zu spielen und das Publikum zu verführen, genau wie Louis Jordan und seine Tympany Five. Über den Beat legte Hamp dann Swing, Bebop oder was immer gerade passte. Das Ganze war wie eine Musikhochschule auf Reisen. – Q
Ein Jahr später, im Sommer 1957, zog es Quincy Jones wieder nach Europa, diesmal um als musikalischer Leiter, Arrangeur und Dirigent für das französische Jazzlabel Barclay Disques zu arbeiten. Der aufstrebende junge Mann war sich bewusst, dass es mehr brauchte als die üblichen Tricks und Kniffe, um so tief in die Musik einzusteigen, wie er es vorhatte. Im Amerikanischen gibt es eine Redensart, die besagt, dass Jazzer mit der Musik zunächst ins Bett gehen und ihr erst später den Hof machen und sie heiraten. In Frankreich studierte Jones Komposition bei der international angesehenen Musikpädagogin Nadia Boulanger und entdeckte klassische Komponisten wie Strawinsky und Ravel für sich. Er erkannte langsam, dass seine wahre Stärke im Arrangieren von Stücken für andere Musiker lag, nicht im Spielen eines Instruments. »Ich hatte immer das Gefühl, das Orchester wäre mein Instrument. An einem bestimmten Punkt musste ich mich entscheiden, und beim Arrangieren war ich wagemutiger als beim Spielen des Horns. Mit Clifford Brown, der sich gelegentlich an Arrangements versuchte, schloss ich spaßeshalber eines Nachts in Malmö einen Pakt. Er sagte: ›Ich spiele und du schreibst.‹«
In den 1940ern versuchten viele, Miles zu kopieren, weil man Dizzy nicht kopieren konnte – seine Töne waren zu hoch, und er spielte zu schnell. Mit seiner schwarzen Baskenmütze, der Hornbrille und dem Ziegenbärtchen war er auch die visuelle Personifizierung des Bebop. Ich liebte Dizzy, seit ich zwölf war. Er besaß Stil, Seele, Witz, Technik, Substanz. Er sah wirklich komisch aus, wie ein Kobold, mit den dicken Brillengläsern, den Backen, die sich beim Spielen wie bei einem Frosch aufblähten, der gebogenen Trompete, den Hosenträgern und den Hüten. Er war einer der humorvollsten und großzügigsten Menschen, die ich kennengelernt habe. – Q
Schließlich wurde es Zeit, das Gelernte in die Tat umzusetzen: Quincy Jones stellte ein 18-Mann-Orchester zusammen (darunter sein alter Mentor Clark Terry, der zusammen mit Quentin »Butter« Jackson Duke Ellingtons Band verließ, um sich Jones anzuschließen), um das Musical Free and Easy in Utrecht, Amsterdam, Brüssel und Paris aufzuführen. Anschließend tourte die Band 1960 zehn Monate lang durch Europa. Besser kann es kaum laufen für den Leader einer Bigband, der noch keine 30 ist. Aber auch nicht viel härter, wenn man sich um die Gehaltsschecks kümmern muss. Die Betriebskosten eines so großen Ensembles brachten Quincy Jones bald auf den harten Boden der Tatsachen zurück. »Hier mit meiner Band über die Runden zu kommen, war eine echte Herausforderung«, gab er damals zu. »Wir haben keinen Agenten, keinen Manager, und ich mache das zum ersten Mal. Es muss so viel organisiert werden. Ich muss 18 Musiker bezahlen und mich unterwegs um insgesamt 33 Menschen kümmern. Wenn es mal nichts zu tun gibt, kann ich nicht einfach wie zu Hause sagen: ›O.k., heute legst du mal eine Studiosession ein‹ – hier gibt es nämlich keine … Ich habe in Europa 145 000 Dollar verloren. Ich musste Tantiemen abschreiben und mir Geld leihen und auf vieles verzichten, um das Ganze am Laufen zu halten.«
Ich verlor viel Geld, aber die Band wurde zur beliebtesten Band Europas. Diese Erfahrung macht man nur einmal im Leben. – Q
»Ich war kurz davor, mir was anzutun«, gestand Jones später. »Ich ertrug den Druck einfach nicht mehr, mich neben den Auftritten um die Gehälter zu kümmern und die Termine zu buchen und alles andere.« Der Traum hatte sich in einen Albtraum verwandelt, und seine größte Angst war, bei einer Pleite mit der ganzen Truppe in Europa festzusitzen. In Turku, Finnland, dachte Jones schließlich an Selbstmord – obwohl er nur etwas Ruhe gebraucht hätte.
Da er die Verantwortung trug, die Band nach Hause zurückzubringen, verkaufte er seinen Musikverlag (und kaufte ihn später für fast das Zehnfache zurück) und lieh sich auf seine Lizenzrechte Geld von seinem alten Freund Irving Green. Green bot ihm auch eine Stelle bei Mercury an, die Jones unter den gegebenen Umständen nicht ablehnen konnte. Der Traum war zwar geplatzt, aber eine neue Tür hatte sich geöffnet und führte zur nächsten Etappe seiner Karriere.
Diese Erfahrung lehrte ihn, dass man bei der Erfüllung seiner Träume viel verlieren, aber auch unschätzbar viel gewinnen kann. »Ich hätte wahrscheinlich früher nach Hause kommen sollen, anstatt dort drüben die Dinge so lange am Laufen zu halten«, gestand Jones kurz nach seiner Rückkehr in die USA, »aber ich bereue es nicht. Ich verlor viel Geld, aber die Band wurde zur beliebtesten Band Europas. Diese Erfahrung macht man nur einmal im Leben.«
© Courtesy of Quincy Jones
Die Lionel Hampton Band trifft 1953 im Pariser Bahnhof Palais d’Orsay ein.
© Courtesy of Quincy Jones
Q in Stockholm, der zweiten Station der Europatournee mit Hamptons Band. Hier in seinem gerade erworbenen Wintermantel.
© Herman Leonard Photography LLC
Die Trompeter in Dizzy Gillespies Band. Von links nach rechts: Joe Gordon, E. V. Perry, Dizzy, Carl »Bama« Warwick und Q
© Shaw Artists Corp.
Gillespie und seine Band bei ihrer Rückkehr aus der Türkei 1956, von oben nach unten: Rod Levitt, Q, Phil Woods, Lorraine und Dizzy Gillespie
© Jean Pierre Leloir
Qs Showband für Free and Easy in Paris 1959
MENTOREN
Quincy Jones, der heute für viele in der Unterhaltungsindustrie ein Vorbild ist, blickte am Anfang seiner Karriere selbst zu vielen Künstlern auf und lernte von ihnen. Die Jazzmusiker, die er am meisten bewunderte, brachten ihm nicht nur musikalische Fertigkeiten bei, sondern lehrten ihn auch, Verantwortung zu übernehmen und dass es wichtig ist, sich als Musiker und als Mensch weiterzuentwickeln.
Clark Terry, Count Basie, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Sarah Vaughan, Billy Eckstine, Nadia Boulanger, Billie Holidays musikalischer Leiter Bobby Tucker, »all diese Leute haben mir geholfen, meinen eigenen Weg zu finden. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür, weil sie das nicht tun mussten und die meisten anderen es auch nicht getan hätten«.
Manche Lektionen waren rein musikalischer Art. »Dizzy war wie ein Guru. Er spielte den Akkord auf dem Klavier, sodass man eine klare Vorstellung davon bekam, was die Blechbläser zu tun hatten. Er brachte afrikanische Einflüsse in den Jazz ein, etwa afro-kubanische Klänge. Und er ließ andere immer gern an seinem Wissen teilhaben, um den Jazz mit all seinen möglichen Variationen voranzubringen.«
Und manchmal waren es auch Lektionen fürs Leben – nicht immer schonend beigebracht. »Einmal hatte Basie zu viele Gigs in einer Nacht und überließ mir einen davon, oben in Connecticut in einem Tanzsaal, weil er wusste, dass ich und meine Band ihn gebrauchen konnten. Wir fuhren also hin und spielten, aber es kamen nur 700 oder vielleicht 800 Leute, obwohl 1700 reingepasst hätten. Als man uns bezahlte, sagte Basie: ›Gib dem Mann die Hälfte vom Geld wieder zurück.‹ Ich sagte: ›Was? Machst du Witze? Wir müssen die Musiker bezahlen.‹ Aber er sagte: ›Gib ihm die Hälfte zurück. Er hat deinen Namen im guten Glauben da oben hingesetzt, und du hast es nicht gebracht. Bestraf ihn nicht dafür.‹ Man sollte sich auch im Showbusiness an gewisse moralische Regeln halten und fair sein. Aber die meisten Menschen gehen in dieser Sache nicht ehrlich mit einem um.«
© Jack Bradley, courtesy of the louis armstrong house museum
Q blickt zum Meister auf: Louis Armstrong. Sie arbeiteten am Song »Faith« aus dem Musical I Had a Ball zusammen, das Q produzierte.
© Carol Friedman
Q mit Count Basie
© Jim Marshall
Duke Ellington am Set von Duke, We Love You Madly, einer frühen Fernsehproduktion von Q, realisiert mit Bud Yorkin und Norman Lear
© Herman Leonard Photography
Q mit Cannonball Adderley
© Courtesy of Quincy Jones
Foto von Duke Ellington mit Widmung: »Für meinen Freund, den großen Meister, der die amerikanische Kunst entkategorisiert hat – Quincy und seine wunderbare Familie. Viel Glück, Duke 2/73.«
© Henry Diltz
Q mit Ella Fitzgerald
© Herman Leonard Photography LLC
Q produziert und arrangiert für seinen »Mentor und Bruder« Clark Terry, ca. 1955.
© Jean Pierre Leloir
Q mit Sarah Vaughan bei der Arbeit an einem neuen Album
© Courtesy of Bobby Tucker
Bobby Tucker und Billie Holliday ca. 1948, neun Monate, nachdem sie mit der Bumps Blackwell Band im Eagles Auditorium in Seattle aufgetreten waren.
© Ron Wolfson
Mit Miles Davis während der Aufnahmen zu Back on the Block
NADIA BOULANGER
Von Nadia Boulanger lernte Jones, dass es nicht nur eine Frage von harter Arbeit und Technik ist, in seinem Metier Herausragendes zu leisten, sondern dass man dabei alle in sich ruhenden Begabungen, Gefühle und Ebenen der Sensibilität aktivieren muss. Als Jones einmal Strawinsky, den er gerade kennengelernt hatte, ein Genie nannte, entgegnete Boulanger: »Wenn Sie unbedingt mit dem Begriff ›Genie‹ hantieren wollen, sollten Sie ihn auf jemanden anwenden, der die höchste Stufe seines Könnens durch Empfindung, Glauben, Engagement und Wissen erreicht hat.« Ob Nadia Boulanger Quincy Jones heute als Genie angesehen hätte, bleibt offen, aber auf jeden Fall war er ein begabter Schüler. Er erinnert sich, dass sie der Meinung war, »die Musik eines Künstlers könne niemals mehr oder weniger sein als das, was er als Mensch darstellt. Das habe ich nie vergessen«. Diese Lehre setzte er nicht nur in seinen Kompositionen um, sondern in sämtlichen Bereichen seiner Arbeit als Produzent und Musiker.
© AP Images