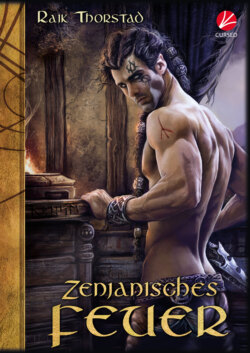Читать книгу Zenjanisches Feuer - Raik Thorstad - Страница 10
Kapitel 5
ОглавлениеDie Unbesiegbaren
Sobald die Sonne aufging, wusste Sothorn, warum die Zenjaner ihre Insel so verbissen gegen Eindringlinge verteidigten. Er hatte im Dienst vom alten Meerenburg beinahe den gesamten Kontinent bereist und doch nie einen Ort gesehen, der ihm friedlicher oder einladender erschienen war.
Von ihrem Standort auf einem Felsvorsprung aus konnten sie beinahe das ganze Kernland überblicken und in der Ferne sogar das Küstenstädtchen erkennen, das sich einen Namen mit der Insel teilte und neben dem einzigen Hafen auch einen Großteil der Werkstätten Zenjas beheimatete. Das Inland dagegen war Landwirtschaft und Viehzucht vorbehalten.
Sothorn erkannte Wiesen, auf denen selbst im Winter Vieh weidete, dazu endlose, von Buschwerk umrandete Äcker; manche unter dem Raureif kahl, andere von einem dichten grünen Teppich bedeckt, hinter dem er Kohl vermutete. Auf dem See im Süden entdeckte er Fischerboote, die mit der Dämmerung hinausgefahren waren, und über dem Wasser kreisten die ersten Vögel. Von den Minen in den Bergen sah und hörte er nichts, aber er wusste, dass sie dort waren, und ihrerseits dafür sorgten, dass es den Bewohnern an nichts mangelte.
Dieser Wohlstand wurde von hohen, größtenteils unmöglich zu erklimmenden Gipfeln beschützt. Sie schufen eine abgeschiedene kleine Welt jenseits der Herrschaft der Handelsherren mit ihren Intrigen und ständig wechselnden Bündnissen.
Ja, Sothorn hätte diesen Ort und seinen Frieden auch bis aufs Blut verteidigt.
Geryim, der neben ihm auf dem Bauch lag und seinerseits in die Ferne spähte, regte sich. »Wir sollten uns auf den Weg machen. Laut Theasa müsste unser Ziel dort drüben liegen…« Er deutete auf eine Ansammlung Wohnstallhäuser jenseits des Sees. »In zwei Stunden sollten wir dort sein, aber wir müssen uns beeilen. Heute Nachmittag zum vierten Stundenschlag will Theasa ihre Absichten verkünden.«
Sothorn musterte die fernen Häuser mit verengten Augen. »Woher wissen wir, dass das der richtige Ort ist?«
»Weil die Zenjaner so dumm waren, Janis und Theasa bei ihrem letzten Besuch ins Kernland zu lassen.« Geryim schob sich rückwärts und kam im Schutz einer schief gewachsenen Kiefer auf die Beine. »Außerdem nimmt Syv entsprechende Bewegung in dem hellen Gebäude an der Kreuzung wahr. Komm, es wird Zeit.«
Sothorn warf einen letzten sehnsüchtigen Blick auf das erwachende Tal, dann folgte er Geryim.
Sie waren noch vor Sonnenaufgang aufgebrochen. Den Abstieg ohne Lichtquelle zu wagen, war ein Risiko gewesen, das sie mehr als einmal in gefährliche Situationen gebracht hatte. Doch von nun an würden sie besser vorankommen, auch wenn sie sich von der staubigen Straße fernhalten wollten, die sich am Flusslauf entlangschlängelte. Je länger sie unentdeckt blieben, desto besser.
Während sie schräg zum Hang den letzten Bergkamm hinter sich ließen, hielt Sothorn den Blick auf Geryims breiten Rücken gerichtet. Ihr gemeinsamer Abend in der Höhle war anders verlaufen, als Sothorn erwartet hatte. Nach dem schwierigen Aufstieg über den Wasserfall und zwei Beinah-Abstürzen war er fest davon ausgegangen, dass Geryims Laune auf dem Tiefpunkt sein würde. Stattdessen war er abgesehen von einigen wenigen bissigen Bemerkungen so ruhig gewesen, wie Sothorn es selten erlebt hatte.
Ob das eine Folge des Rituals war? Doch wenn ja, warum hatte sich Geryim dann während der Überfahrt nach Zenja oftmals genauso kurz angebunden und zornig gezeigt wie früher? Nicht, dass Sothorn nicht für jede gemeinsame Stunde dankbar gewesen wäre. Nur gab es tief in ihm einen kaum greifbaren Teil, der enttäuscht war. Und obwohl es sich nur um einen winzigen Funken seines Selbsts handelte, schämte er sich für ihn.
Was hatte er sich denn erhofft? Ein bürgerliches Leben vielleicht, in dem es zu seinen täglichen Verrichtungen gehörte, mit Geryim Hand in Hand über blühende Wiesen zu tanzen? Kaum. Es ging eher darum, Geryim zu berühren – nicht nur seinen Körper –, und…
Ein paar lose Steine gerieten unter Sothorns Stiefelsohlen ins Rutschen. Stumm verfluchte er sich, als er sich mit rudernden Armen vor einem Sturz retten musste. Kaum, dass er sein Gleichgewicht zurückerobert hatte, schritt er umso schneller aus, um Geryim zu folgen.
Sie waren auf dieser Insel, um der Bruderschaft ihre größte Sorge zu nehmen. Was würden die anderen wohl sagen, wenn er sich in seiner Grübelei ein Bein brach und seinen Teil der Aufgabe nicht erfüllen konnte? Was, wenn er Geryim in eine Lage brachte, in der er allein weitergehen musste?
Das kam nicht infrage. Für jede Überlegung – mochte sie auch noch so wichtig sein –, die nichts mit einer Schiffsladung Zenjanischer Lotus zu tun hatte, war später Zeit.
Im Verlauf der folgenden Stunde hielt Sothorn seine Gedanken im Zaum und seine Sinne geschärft. Selbst Gwanja verwies er mit dem mentalen Gegenstück einiger scharfer Worte auf ihren Platz, damit sie ihn nicht ablenkte. Ihr betroffener Rückzug tat ihm körperlich weh.
Bald darauf erreichten sie den See und bewegten sich im Schutz des mannshohen Schilfs auf die nahe Siedlung zu. Mehr als einmal schreckten sie gewaltige Wasservögel auf, nur um genau wie die Tiere zusammenzufahren.
Man konnte über den Lotus sagen, was man wollte, aber solange er einen in sein eigentümliches Gespinst aus Ruhe und niemals versiegender Kraft spann, war man eindeutig weniger schreckhaft. Besonders, als Sothorn auf einem feuchten Uferabschnitt das erste Wasser in die Stiefel zu sickern begann, vermisste er die kalte Gelassenheit, die ihm lange bester Freund und ärgster Feind gewesen war.
Sie erreichten die kleine Siedlung zu einem günstigen Zeitpunkt. Einsetzender Regen hatte dafür gesorgt, dass sich die meisten Bewohner eine Arbeit in Häusern und Stallungen gesucht hatten, statt sich draußen nützlich zu machen. Kurz bevor sie sich dem niedrigen Gebäude mit dem Strohdach näherten, das Geryim und Syv aus der Ferne ausgemacht hatten, blieben sie stehen.
Genau genommen war es Geryim, der auf einmal leise pfiff und Sothorn mit gekrümmtem Zeigefinger hinter eine Dornenhecke lockte. Sobald sie sich beide dahintergekauert hatten, sah Geryim hinauf in den Himmel. Als Sothorn seinem Blick folgte, entdeckte er Syv, der hoch über ihnen seine Kreise zog.
Einen Augenblick später ging ein Ruck durch Sothorn. Geryims Hand war so rasch in seinem Nacken aufgetaucht, dass er im ersten Moment befürchtete, es nähere sich jemand und Geryim wollte ihn ins feuchte Gras drücken. Doch dann fand er sich in einer im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Umarmung wieder.
»Gors Schutz für dich. Für uns beide«, raunte ihm Geryim ins Ohr, küsste ihn hastig auf die Schläfe und zog sich zurück, bevor Sothorn wusste, wie er mit diesem plötzlichen Übergriff umgehen sollte. Sie waren bei Weitem nicht zum ersten Mal miteinander unterwegs, waren gemeinsam in Häuser eingestiegen und hatten zusammen halb Auralis bestohlen. Doch nie hatte Geryim sich zu einer solchen Geste hinreißen lassen.
Damals wart ihr aber auch keine… was auch immer ihr jetzt seid, flüsterte eine leise Stimme in seinem Kopf. So verschwommen der Gedanke auch war, er ließ eine unerwartete Leichtherzigkeit in Sothorn aufsteigen und ihn im besten Sinne unruhig werden. Er konnte weder das eine noch das andere gebrauchen, während er sich darauf vorbereitete, eine der größten Schandtaten seines ehrlosen Lebens zu begehen. Dennoch sandte er ebenfalls zögernd eine stumme Bitte an Gor: Wer immer du bist, nimm uns das hier nicht weg. Trenn uns nicht. Wir haben noch so viel gemeinsam zu erleben.
Danach fühlte er sich seltsamerweise besser.
Geryim kroch zum Rand des Gestrüpps. Seine glasigen Augen verrieten Sothorn, dass er einmal mehr mit Syv in Verbindung getreten war. Der alltägliche Austausch war Geryim so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man ihn als Außenstehender nicht bemerkte. Anders war es, wenn er tatsächlich mit Syvs Augen sah und gleichzeitig von seinen eigenen Eindrücken überschwemmt wurde.
»Wir haben Glück«, flüsterte er nach einer Weile so leise, dass Sothorn sich anstrengen musste, um ihn zu verstehen. »Es ist niemand unterwegs. Nicht auf der Straße in Richtung Minen, nicht hier in der Siedlung. Aber wir sollten uns beeilen. Aus der Stadt sind gerade ein paar Karren aufgebrochen. Sie werden bald hier sein.«
Mit einem knappen Nicken streifte Sothorn den Umhang ab und band ihn an sein Bündel. Er hasste es, mit Waffen zu hantieren, während ihm Stoff um die Schultern wallte und beim ersten Windstoß ein widerwilliges Eigenleben entwickelte, das ihm zum Verhängnis werden könnte.
»Gehen wir«, murmelte er. »Schnell rein, genauso schnell wieder raus und…« Er sprach nicht aus, dass er möglichst kein Blut vergießen wollte. Er wusste, dass Geryim ihn verstand.
Seite an Seite lösten sie sich aus dem Schutz der Hecke. Sothorn verzichtete auf sichernde Blicke und vertraute sich seinen beiden Begleitern an.
Ihr Zielgebäude verfügte auf allen Seiten über winzige Fenster, die jedoch mit dichtem Leder bespannt worden waren, um die Winterluft fernzuhalten. Nur an der Vorderseite befanden sich zwei verglaste, die den zusätzlichen Schutz nicht nötig hatten. Es gab nur eine einzige Tür, was Sothorn als weiteren Fingerzeig des Glücks für sie verbuchte.
Stumm bedeutete er Geryim, dass sie sich dem Eingang von hinten nähern würden, bevor er hastig die letzten Schritte hinter sich brachte. Er hörte, dass Geryim ihm folgte, und auch, dass er seine Waffen aus den Scheiden zog. Mit zusammengebissenen Zähnen tat Sothorn es ihm nach; der Widerwillen in seinem Innern beißender als je zuvor.
Dann barst er durch die schwere Holztür. Sie schlug mit einem Krachen gegen die Wand und ließ das Dutzend Kinder, das an einer Reihe hölzerner Tische saß, erschrocken zusammenzucken. Ein paar schrien auf.
Das galt jedoch nicht für den jungen, pausbäckigen Mann, der an der Stirnseite des Zimmers stand und gerade einige Zahlen an eine Wandtafel geschrieben hatte. Verärgerung breitete sich auf seiner Miene aus. »Wer seid ihr?«, fuhr er sie an. »Und was habt ihr…« Er beendete den Satz nicht. Sein Blick war an den gezogenen Klingen hängen geblieben.
»Kein Wort mehr.« Geryim drängte sich an Sothorn vorbei und näherte sich dem ersten Kind, das er erreichen konnte. Er packte den vielleicht neunjährigen Jungen am Handgelenk, riss ihn von seiner Schulbank hoch, legte ihm einen Arm um die dürre Brust und drückte ihm die flache Seite einer seiner Dolche an die Wange.
Sothorn stieß die Tür hinter sich zu und versuchte, sich gegen das Entsetzen im Schulzimmer abzuschirmen. Versuchte, die weit aufgerissenen Augen der Kinder nicht zu sehen und auch nicht zu riechen, dass eines von ihnen die Beherrschung über seine Blase verloren hatte.
Glück gehabt, kleiner Wurm, dachte er zynisch. Dich nehmen wir bestimmt nicht mit.
Stattdessen näherte er sich zwei nebeneinandersitzenden Mädchen und bedeutete ihnen, auf die Beine zu kommen. Die beiden sahen sich in ihren schlichten Bauernkitteln und den langen Winterröcken so ähnlich, dass sie Zwillinge sein mochten. Der einzige Unterschied war, dass die eine leise weinte, während ihn die andere wutentbrannt anfunkelte. Damit bewies sie mehr Mut als der Lehrer, der zwar ein paarmal den Mund öffnete, um etwas zu sagen, aber letztendlich stumm blieb.
Während Sothorn eine Reihe kurzer Seilstücke aus seinem Beutel zerrte, den Mädchen in Windeseile die Hände band und sie anschließend mit einem längeren Tau aneinanderfesselte, schubste Geryim sein Opfer ruppig Richtung Tafel.
»Aufgepasst, Bübchen«, sagte er an den Lehrer gewandt. »Du hast genau zwei Möglichkeiten. Du kannst dir anhören, was wir zu sagen haben, oder du kannst schon einmal einen Eimer und einen Schrubber auftreiben. Denn wenn du uns nicht sehr genau zuhörst, wird Blut fließen, verstanden?«
Selbst Sothorn nahm die Kälte in Geryims Stimme wahr und spürte, dass sie etwas mit ihm anstellte. Oder war es die Sorge, dass Geryim seine Drohung wahrmachen könnte? Sothorn wollte glauben, dass die Kinder vor ihnen sicher waren. Aber für die überforderte und zitternde Narrengestalt von einem Lehrer galt das nicht, auch wenn es für sie alle günstiger war, wenn er am Leben blieb.
Geryim sah sich kurz im Raum um, richtete seine Aufmerksamkeit jedoch rasch wieder auf den an die Tafel zurückgewichenen Lehrer. »Gut«, sagte er barsch. »Wir werden jetzt ein paar von deinen Schützlingen mitnehmen. Und du, mein Freund, wirst dir ein Pferd besorgen und so schnell wie möglich zum Hafen reiten. Wie vielen deiner Nachbarn du unterwegs zubrüllst, was vorgefallen ist, schert mich nicht. Aber sobald du angekommen bist, wirst du den Stadtvätern bestätigen, dass wir eure Kinder haben. Hast du das verstanden?«
Der Lehrer reagierte nicht sofort. Sein Blick schien durch Geryim hindurchzugehen und kurz befürchtete Sothorn, dass er das Bewusstsein verlieren könnte.
»Hast du mich verstanden?«, zischte Geryim erneut und drehte langsam die Klinge an der Wange des Jungen, bis die Schneide nach innen gerichtet war.
In Sothorns Rücken erklang ein leiser Aufschrei, der in ein erstickt klingendes Schluchzen überging. Am liebsten hätte er Geryim den Jungen abgenommen, ihn mit den Mädchen zusammengebunden und es damit bewenden lassen. Aber es war weiser, mehr von ihnen mitzunehmen. Je mehr Familien in Angst waren, desto mehr Druck wurde auf die Stadtväter ausgeübt und eben diesen Druck brauchten sie. Er war die einzige Münze, in der sie zahlen konnten.
Schweren Herzens scheuchte er zwei weitere Kinder auf und fesselte sie. Das Schauspiel vor der Tafel ließ er dabei nicht aus den Augen.
Der sichtlich bebende Lehrer schien endlich seine Stimme wiedergefunden zu haben. »Aber was mache ich, wenn die Stadtväter gar nicht im Hafen sind?«
Geryim stieß ein freudloses Lachen aus. »Glaub mir, sie werden da sein.«
Sothorn erkannte genau, wann der Lehrer begriff, dass er es keineswegs mit zwei Einzelkämpfern zu tun hatte. Seltsamerweise schien ihm das schiere Entsetzen über einen Angriff auf Zenja etwas Mut einzuflößen. »Das werden sie euch nicht durchgehen lassen. Sie werden… Sie werden… Die Wachen werden…«
»Eure Wachen werden gar nichts tun«, unterbrach Geryim ihn. »Bis sie hier ankommen, sind wir mit den Kindern längst in den Wäldern verschwunden.« Eine Finte. Sie wollten gar nicht in die Wälder, die sich jenseits der Siedlung erstreckten. Sie würden denselben Weg nehmen, den sie gekommen waren und der ihnen halbwegs vertraut war. »Das kommt davon, wenn man sich darauf verlässt, dass das Inland sicher ist.«
Sothorn zerrte an dem Seil, das die Kinder zusammenhielt, und gesellte sich zu Geryim nach vorn. Dort schob er unzeremoniell dessen Klinge beiseite und übernahm seinen Gefangenen. Der Junge fuhr heftig zusammen, als er gepackt wurde, und sah so verängstigend drein, dass Sothorn ihm am liebsten ein paar beruhigende Worte zugeraunt hätte. Aber das musste warten, bis der Lehrer außer Hörweite war.
Der schien inzwischen halbwegs zu sich gekommen zu sein und bewies, dass er genug Verstand besaß, um seine Anstellung zu verdienen. Wahrscheinlich hatte er innerlich seine Möglichkeiten abgewogen und war zu dem Schluss gekommen, dass sein Hauptaugenmerk auf der Sicherheit der Kinder liegen musste.
Mit einem sauertöpfischen Blick auf Geryims wohlbestückten Waffengürtel nickte er. »Gut. Ich werde tun, was ihr verlangt. Aber glaubt nicht, dass ihr davonkommen werdet. Wenn wir euch nicht zu fassen bekommen, dann mit Sicherheit die Götter.« Er spuckte vor ihnen aus und drehte sich zu den verbliebenen Kindern um, die sich still in einer Ecke zusammengedrängt hatten. »Ihr werdet sie kaum alle mitnehmen können. Also lasst die anderen gehen.«
Geryim wechselte einen kurzen Blick mit Sothorn, dann hob er unbeeindruckt die Schultern. »Mir soll es recht sein. Wir haben, was wir brauchen.«
Sothorn nickte zustimmend und zerrte erneut am Seil. »Mitkommen«, sagte er scharf. »Und denkt nicht einmal daran, euch unterwegs absichtlich fallen zu lassen oder uns anderweitig Ärger zu machen. Wenn einer von euch etwas anstellt, zahlen alle.«
Die Kinder schienen ihm jedes Wort zu glauben. Er war nicht sicher, ob er darüber froh oder entsetzt war. Mit langen Schritten ging er voran, wissend, dass Geryim ihm rückwärtsgehend folgte und so dafür sorgte, dass der Lehrer nicht doch noch auf dumme Gedanken kam und vielleicht ein schweres Buch als Waffe einsetzte.
Sothorn öffnete die Tür und sammelte sich einen Herzschlag lang, bevor er mit seiner unwilligen, größtenteils weinenden Gefolgschaft aus dem Gebäude trat. Nun würde es nicht mehr lange dauern, bis jemand auf das befremdliche Treiben aufmerksam wurde.
Er ließ einen seiner Dolche in der Scheide verschwinden. Den anderen hielt er warnend erhoben. Hinter sich hörte er Geryim eine letzte Drohung knurren, ehe er ein unmissverständliches Marsch! ausstieß.
Zu siebt setzten sie sich in Bewegung. Sothorns lange Schritte zwangen die Kinder zu rennen. Er konnte nur hoffen, dass sie durchhielten, bis sie Deckung gefunden hatten. Über ihnen hörte er Syvs Raubvogelschrei. Er wagte nicht, Geryim zu fragen, was Syv sah. Sie würden es bald genug erfahren.
Sie hatten kaum die Wegkreuzung erreicht, als hinter ihnen eine Stimme laut wurde. »Schnell! Ein Pferd! Bringt mir ein Pferd! Sie haben die Kinder!«
Türenknallen. Schreie. Wehklagen. Und immer wieder das leise Weinen ihrer Opfer.
Sothorn biss sich auf die Innenseite seiner Wange, bis er Blut schmeckte. Sie hatten es begonnen, sie würden es zu Ende bringen. Zum Wohl der Bruderschaft. Aber er hatte keinerlei Zweifel, dass ihm sein Gewissen in Zukunft manche schlaflose Nacht bescheren würde. Er konnte nicht behaupten, dass er es nicht verdiente.
* * *
Der Steilhang hatte die Kinder die letzten Kräfte gekostet. Geryim wäre es lieber gewesen, wenn sie weiter nach Süden vorgedrungen wären. Aber sie konnten die fünf unmöglich tragen. Es war klug von Sothorn gewesen, sich die Älteren als Geiseln herauszusuchen. Sie hatten gut mit ihnen Schritt gehalten. Doch nun wünschte Geryim, einige von ihnen wären jung genug, um sie sich über die Schultern zu werfen.
Die Bergwiese oberhalb des Flusslaufs war ein ebenso guter oder schlechter Rastplatz wie jeder andere auf dieser verfluchten Insel. Geryim sprang auf einen hohlen Baumstamm und spähte in die Ferne, konnte aber bisher keine Verfolger erkennen. Er machte sich nichts vor: Sie würden kommen, spätestens dann, wenn das ungleiche Geschäft im Hafen abgewickelt war.
Als er seinen Aussichtspunkt verließ, hatte Sothorn die Kinder in der Nähe eines schräg in den Himmel ragenden Monolithen zusammengetrieben. Inzwischen weinte keines mehr. Selbst die kleine Wildkatze, die als Einzige einen Fluchtversuch gewagt hatte, wirkte zu erschöpft, um weiter auf dumme Gedanken zu kommen. Dennoch nahm Geryim sich vor, in ihrer Nähe vorsichtig zu sein. Sie hatte Sothorn bereits zweimal gebissen und Geryim mit ihren Holzschuhen so kräftig vors Schienbein getreten, dass er das Pochen noch immer spürte.
»Ist Syv schon in der Stadt?«, erkundigte sich Sothorn, während er seinen Umhang auf dem Boden ausbreitete und die Kinder knapp anwies, sich hinzusetzen.
»Gleich.«
Anfangs war Syv in ihrer Nähe geblieben, um ihre Flucht zu überwachen und Geryim über die Geschehnisse aus der Siedlung auf dem Laufenden zu halten. Natürlich hatte der Lehrer sämtliche Bewohner zusammengeschrien, bevor er in die Stadt aufgebrochen war. Entsprechend herrschte dort große Aufregung, aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich Syv von seinem Posten gelöst hatte, hatten sich keine Helden gefunden, die den Kindern nachgeeilt wären. Inzwischen mochte es anders aussehen.
Theasas Plan hatte eine Schwachstelle, was Geryim und Sothorn betraf. Er konnte nur hoffen, dass sie ihnen nicht teuer zu stehen kommen würde. Gerade Sothorn zahlte ohnehin schon einen zu hohen Preis.
Mit gerunzelter Stirn sah Geryim zu, wie Sothorn leise auf die Kinder einredete. Was genau er ihnen sagte, konnte er nicht verstehen. Aber es hätte ihn sehr gewundert, wenn es nicht das Versprechen gewesen wäre, dass ihnen nichts zustoßen würde. Schon unterwegs hatte er versucht, ihnen die größte Angst zu nehmen und ihnen versichert, dass sie nichts zu befürchten hätten.
»Wenn ihr brav seid, heißt das«, hatte Geryim hinzugefügt, um zu verhindern, dass aus entspannten Kindern langsame Kinder wurden. Er hatte an Ailys kleine Tochter Gilla und all die anderen kleinen Bruderschaftler gedacht, die auf einem abgelegenen Eiland auf die Rückkehr der Henkersbraut warteten, und sich ein bisschen gehasst.
Das tat er auch jetzt, während er zusah, wie Sothorn den Führstrick mit einem schwer zu lösenden Seemannsknoten an einen Busch band und gleich darauf zum Wasser hinunterlief, um seinen leeren Schlauch zu füllen. Seine Bewegungen waren genauso geschmeidig wie am Morgen, als sie aufgebrochen waren, aber er war wachsbleich im Gesicht und sein Blick so leer, dass es Geryim innerlich beutelte. Er hatte vor langer Zeit begriffen, dass Sothorn im Grunde seines Herzens ein mitfühlender Mensch war. Nur das Schicksal hatte verhindert, dass er diese Seite an sich selbst kennenlernte, und nun bereitete sie ihm Schwierigkeiten.
Und du bist ein liebeskranker Narr, wies Geryim sich selbst zurecht. Stehst dumm herum und zerbrichst dir mitten in einem Auftrag den Kopf über Sothorns Herz. Dabei hing es ab diesem Zeitpunkt maßgeblich von ihm ab, ob sie mit heiler Haut davonkommen würden.
Als Sothorn mit dem vollen Wasserschlauch zurückkam, nahm Geryim ihn beiseite. »Hältst du ein Auge auf die Kinder? Ich will mir ansehen, was in der Stadt geschieht, und das wird mich einiges an Aufmerksamkeit kosten.«
Sothorn sagte nichts, nickte nur.
Geryim widerstand dem Drang, ihm die Hand auf die Schulter zu legen, ihn zu küssen und auch allen anderen aufmunternden Gesten. Dafür würde er sich später Zeit nehmen.
Unwillig kehrte er zu dem Baumstamm zurück und setzte sich. Gleichzeitig tastete er behutsam nach Syvs Sinnen und spürte dessen Einladung. Sie war von großer Aufregung überlagert. Eine fremde Stadt lag unter ihm und mit ihr viele Menschen, von denen die meisten so aufgebracht waren, dass selbst ein Adler es merkte.
Lass mich sehen, bat Geryim sanft. Setz dich auf einen Giebel und ruh dich aus, während ich mir deine Augen leihe. Dir steht heute noch ein langer Flug bevor.
Einen Moment später tauchte in seinem Geist das Bild eines Hafengeländes auf. Geryims eigene Augen wurden durch die Verbindung jedoch nicht blind, sodass es für ihn wirkte, als wären die steinernen Mauern und wuchtigen Wachtürme von blassem Gras bewachsen.
Sofort entstand ein Spannungsgefühl hinter Geryims Stirn und er schloss die Lider, um seine Sicht auf ein Bild zu begrenzen.
Syv hatte recht: Im Hafen herrschte große Unruhe. Die Henkersbraut lag vor Anker und war über eine breite Planke mit dem Kai verbunden. Um sie herum hatte sich eine gewaltige Menschenmenge versammelt. Dennoch war es in diesem Teil der Stadt erstaunlich still. Nur das Rollen von schweren Fässern, die über die Planke donnerten, war zu hören.
An einem leeren Anlegeplatz neben ihrem Schiff entdeckte er Theasa. Sie beaufsichtigte die Anlieferung der Fässer. Kara und Morkar standen mit gezückten Schwertern neben ihr.
Ihnen gegenüber hatten sich fünf Männer in der Tracht der Zenjaner aufgebaut. Die blinkenden Ketten um ihre Hälse ließen vermuten, dass es sich um die Stadtväter handelte. In ihrer Körpersprache las Geryim eine Mischung aus Zorn und Angst, in ihren Gesichtern Hass und Entrüstung. Das war nicht weiter verwunderlich, nachdem man sie hatte wissen lassen, dass einige ihrer Kinder als Geisel genommen worden waren und nur für den gesamten Bestand an Zenjanischem Lotus in ihren Lagerhäusern wieder freikommen würden.
»Es scheint alles nach unseren Wünschen zu verlaufen. Sie haben sich unseren Forderungen unterworfen«, berichtete Geryim, ohne die Augen zu öffnen.
Er erhielt keine Antwort, doch Sothorn murmelte etwas, das an die Kinder gerichtet sein musste. »Hört ihr? Bald könnt ihr zurück zu euren Eltern.« Er klang so angestrengt, dass Geryim seine Stimme ausblenden musste.
Im Hafen bat er Syv, sich auf seinem Platz auf dem Giebel etwas zu drehen. Er wollte mehr von der Stadt sehen und besonders das Tor zum Inland im Auge behalten, ob dort vielleicht Reiter ausrückten. Es hatte den Anschein, als wäre ausnahmslos jeder Bewohner auf den Beinen. Viele hatten sich in kleinen oder größeren Gruppen versammelt. Andere säumten den kurzen Weg vom Lagerhaus zum Hafen und beobachteten, wie die Fässer verladen wurden.
Geryim wünschte, er wäre von Anfang an dabei gewesen, um zu zählen, wie viele in den Laderäumen der Henkersbraut verschwanden.
Plötzlich ruckte Syv mit dem Kopf und flog auf. Geryim wurde kurz schwindelig, als die Welt unter ihm zu kreisen begann. Dann gewöhnte er sich um und verfolgte Syvs Flug. Dessen unmenschlich scharfe Augen hatten im Kern der kleinen Stadt eine Bewegung erfasst. Zu Geryims Sorge erkannte er, dass es in einer engen Gasse zu einem Handgemenge gekommen war. Zwei Gestalten gingen aufeinander los, die eine unbewaffnet, die andere mit einer Streitaxt in der Hand. Aus Sorge wurde Schrecken, sobald Geryim den waffenlosen Kämpfer erkannte: Es war Szaprey.
Kälte sickerte ihm in den Nacken. Was tat Szaprey so weit vom Hafen entfernt? Und was hatte er angestellt, dass einer der Zenjaner alle Vorsicht in den Wind geschlagen und ihn angegriffen hatte?
Hilflos musste Geryim zusehen, wie Szaprey von gewaltigen Axthieben rückwärts getrieben wurde. Er hatte die Lefzen hochgezogen und die mit Krallen bewehrten Hände erhoben, doch die Reichweite der Streitaxt war zu groß, als dass er sie unterlaufen und einen Angriff hätte wagen können. Warum nur hatte dieser dreimal verfluchte Roaq keine Waffe bei sich? Wusste Theasa überhaupt, dass er die Henkersbraut verlassen hatte?
Geryim hielt es nicht länger auf seinem Platz. Er sprang auf die Beine. Was in jener Gasse geschah, konnte nicht nur ihre Pläne zum Scheitern bringen. Es sah auch danach aus, als hätte sich Szaprey in eine ausweglose Lage manövriert. Ausgerechnet ihr fähigster Heiler und zugleich der Mann, dem Geryim sich in vielerlei Hinsicht am engsten verbunden fühlte. Der sein Freund war.
»Verdammt!«, entfuhr es ihm, als Szaprey rückwärts über eine Steinkante stolperte und kaum rechtzeitig auf die Beine kam, um der niedersausenden Axt auszuweichen. »Lauf, verfluchter Flohhaufen!«
Auf einmal stand Sothorn neben ihm. »Was ist los?«
»Schwierigkeiten. Szaprey. In der Stadt«, erklärte Geryim abgehackt, während er mit angehaltenem Atem verfolgte, wie Szaprey sich plötzlich umwandte und rannte. Es war beinahe, als hätte er ihn gehört. Die ersten Schritte brachte er auf zwei Beinen hinter sich, krümmte sich dann jedoch, bis er auf allen vieren und mit gesträubtem Nackenfell auf den Hafen zujagte.
Was Szaprey fürs Erste rettete, erwies sich bald als neues Problem. Die aufgebrachte Menge hieß das Herumstürmen des Roaqs nicht gut und Geryim spürte förmlich, wie die Stimmung umschlug. Hatte es vorher den Anschein gemacht, als würden sich die meisten mit dem Überfall abfinden, sahen einige nun ihre Gelegenheit, sich für die entstandene Schmach zu rächen.
»Geryim!« Sothorn hatte sein Gesicht umfasst und schlug ihm auf die Wangen. »Sag mir, was geschieht!«
Flatternd öffnete Geryim die Lider und stemmte sich gegen das zunehmende Reißen in seinen Schläfen. »Ich weiß es nicht!«, fauchte er. »Szaprey ist im Handwerkerviertel unterwegs. Er muss dort irgendeinen Blödsinn angestellt haben und ist auf einen Gegner gestoßen. Jetzt versucht er, zur Henkersbraut zurückzukommen, aber…«
Bevor er fortfahren konnte, sah er vor seinem geistigen Auge ein Beil aufblitzen. Der ersten erhobenen Waffe folgten andere. Syv, der Szaprey gefolgt war, flog nun über die Lagerhäuser hinweg auf die Henkersbraut zu. Theasa tauchte in seinem Sichtfeld auf. Sie war auf einen Poller gesprungen und starrte ungläubig in die Richtung, aus der sich Szaprey näherte. Noch erkannte sie wahrscheinlich gar nicht, was geschah, aber das Umschlagen der Stimmung entging ihr sicher nicht.
»Geht an Bord«, murmelte Geryim. Sein Herz raste, als würde er selbst durch eine fremde Stadt gejagt oder miterleben, wie vor seinen Augen aus gelähmtem Entsetzen Wut wurde. »Zieht die Planke ein. Sie werden angreifen.«
»Nein…«, stieß Sothorn neben ihm aus. Eines der Kinder schien zu begreifen, was vor sich ging, und begann wieder zu weinen.
Indessen hatte Szaprey fast den Kai erreicht. Einer der Stadtväter drohte Theasa, Kara und Morkar inzwischen offen, die anderen vier hatten ebenfalls den Ernst der Lage erkannt und riefen ihren Bürgern zu, die Ruhe zu bewahren.
Es half nichts. Nur wenige Sprünge vor der Planke wurde Szaprey in die Seite getroffen. Geryim konnte nicht erkennen, durch wen oder was, aber er hörte den unmenschlichen Schrei, den sein Freund ausstieß. Er sah, wie er ins Torkeln geriet und sich abfing, nur um im letzten Augenblick von einem weiteren Angriff zu Boden gestoßen zu werden. Sobald er im Staub lag, verloren die Zenjaner die Beherrschung.
Männer wie Frauen strömten auf die Henkersbraut zu. Die meisten versammelten sich um Szaprey, traten und schlugen nach ihm. Andere stürzten auf Theasa und ihre Begleiter zu und drängten sie gegen die Bordwand. Gleich darauf schossen die ersten Pfeile vom Deck des Schiffs und trieben einen Teil der Angreifer zurück. Eine Strickleiter flog über die Reling und bot den Eingekesselten einen Fluchtweg.
Um Szaprey stand es schlimmer. Geryim konnte ihn längst nicht mehr sehen, sondern erahnte nur, dass sich unter dem Berg wütender Menschen noch etwas bewegte. Wie lange würde es wohl dauern, bis einer von ihnen einen Treffer landete, den selbst ein so zäher Haudegen wie Szaprey nicht verwinden konnte?
Die Hilflosigkeit zerriss Geryim. Nichts unternehmen zu können, während einer der ihren um sein Leben kämpfte, war grausamer, als er sich je hätte vorstellen können. Warum griffen die anderen nicht ein? Warum richteten sie nicht eine der Schiffskanonen auf ein nahes Gebäude und setzten einen Warnschuss ab? Es hatte sich doch gar nichts geändert. Die Kinder waren immer noch in ihrer Hand. Das konnten die Zenjaner unmöglich vergessen haben.
Da huschte eine andere Bewegung durch Syvs Sichtfeld. Jemand stürmte die Treppe zum oberen Laderaum herauf. Jemand, der zwar keine Rüstung trug, dafür aber eines der wuchtigsten Breitschwerter, die Geryim je gesehen hatte. Auch wenn der Schatten des Mastes die Gestalt verbarg, wusste er, wem diese Klinge gehörte.
»Janis…«, flüsterte er tonlos. An seiner Seite vernahm er ein scharfes Einatmen und eine Frage, die er nicht verstand.
Obwohl ausnahmslos alle Assassinen an Deck standen – die meisten mit Bögen bewehrt –, bemerkte offenbar keiner von ihnen, was vor sich ging. Erst, als Janis die Freitreppe zum Steuerrad erklomm und von dort auf den Kai sprang, stieg ein vielstimmiger Schrei auf. Theasas Krächzen war am deutlichsten zu vernehmen.
Janis drohte niemandem und forderte niemanden heraus. Er lief mit gesenktem Kopf in die Menge hinein, als würde ihn sein ausgestrecktes Breitschwert nach vorn reißen. Geryims Knie wurden weich, als er das erste Blut aufspritzen sah. Es gehörte einem älteren Mann, der ungläubig auf die abgetrennte Hand zu seinen Füßen starrte, und sich nicht erklären konnte, wie sie dorthin gelangt war.
Für einen Augenblick wurde es still im Hafen. Den Stadtvätern standen die Münder offen und die Bewohner Zenjas starrten den Verrückten an, der so sorglos in ihre Mitte gesprungen war. Selbst der Tumult um Szaprey hatte nachgelassen.
Dann setzte eine Wellenbewegung ein. Ein erster Bürger trat einen Schritt nach vorn und stellte sich Janis entgegen. Ihm folgte ein weiterer. Dann zwei Frauen, die Dreschflegel in den Händen hielten. Das Letzte, was Geryim von Janis zu sehen bekam, war ein breites Grinsen. Dann wurde er von den Zenjanern überrollt.
Wie durch einen Schleier wurde Geryim Zeuge, wie sich der Kampf verlagerte. Plötzlich sah er Szaprey, der auf allen vieren die Planke hinaufkroch. Er erlebte mit, wie sich die Luke zum Laderaum schloss und die Henkersbraut fast im selben Moment den Anker lichtete.
Er wollte Theasa – oder wer immer den Befehl zum Auslaufen geben hatte – anschreien, sie daran erinnern, dass mit Janis das Herzstück ihrer Bruderschaft noch an Land war. Doch dann wurde ihm bewusst, dass niemand den Kampf gegen einen Mob überleben konnte. Nicht einmal einer von ihnen. Janis hatte sich für sie in die Bresche geworfen und Theasa würde nicht erlauben, dass sein Opfer vergebens war.
Geryim verlor den Zugriff auf Syvs Sinne, als ihn ein harter Schlag am Kinn traf. Sothorns erhobene Faust tauchte vor ihm auf und versprach weitere Prügel, wenn er nicht sofort zu sich kam.
»Red mit mir! Was geht da vor sich?«, forderte Sothorn zweifelsohne zum wiederholten Male.
In Geryim stieg eine Ernüchterung auf, wie er sie selten empfunden hatte. Teilweise fußte sie auf Erschöpfung. Er nutzte Syvs Augen selten so lange. Doch in erster Linie nährte sie sich aus Leere. Tatsächlich kam es ihm vor, als hätte ihm jemand ein Stück Fleisch aus der Brust gerissen und nichts als einen Hohlraum zurückgelassen.
»Janis ist tot.« Er war nicht in der Lage, die Wucht der Nachricht abzudämpfen oder zu erklären, dass Janis in diesem Moment vielleicht noch atmete, aber trotzdem unrettbar verloren war. »Die Henkersbraut verlässt gerade den Hafen.«
In Sothorns Augen spiegelte sich dieselbe schmerzhafte Verwirrung wider, die auch Geryim empfand. Ihm war anzusehen, dass ihm hundert Fragen auf der Zunge lagen. Geryim war dankbar, dass er sie nicht stellte, denn er hätte sie nicht beantworten können. Auch er konnte nicht fassen, was geschehen war, oder wie es dazu kommen konnte. Wie sollte er sich da jemandem erklären, der kein Augenzeuge gewesen war?
Sothorn fing sich zuerst. Er sah zu Boden, rieb sich heftig im Nacken, als hätte ihn ein besonders angriffslustiges Insekt gestochen, und murmelte dann: »Wir müssen die Kinder gehen lassen. Und dann von hier verschwinden.«
Geryim nickte schwerfällig. Es waren kluge Worte, wahre Worte, aber sie drangen nicht ganz bis zu ihm vor.
Deshalb war es Sothorn, der eine Fessel nach der anderen durchtrennte, Sothorn, der sich einen letzten Tritt von dem kampflustigen Mädchen einfing und ebenfalls Sothorn, der den Kindern sagte, dass sie nach Hause laufen sollten.
Geryim stand indessen wie in Eisfäden eingewoben an seinem Platz und sah hinaus auf das Ackerland. Mit einer befremdlichen Mischung aus Hass und Sorge fragte er sich, wie es um Szaprey stehen mochte. Er wollte keinen weiteren Freund verlieren. Gleichzeitig zuckten seine Finger vor Gier, sich um Szapreys haarige Kehle zu schließen. Ohne sein unbedachtes, eigenmächtiges Handeln wäre kein einziger Tropfen Blut vergossen worden. Genauso, wie Sothorn es sich gewünscht hatte.
Wenigstens hatten sie den Kindern nichts antun müssen. Geryim beobachtete, wie eines nach dem anderen an ihm vorbeistob. Sie rannten, als hätten sie an diesem Tag noch keinen einzigen Schritt getan. Ihr Anblick ließ ihn fast übersehen, dass sich in der Ferne etwas regte.
Gerade, als er die ersten Reiter bemerkte, die sich im Galopp auf ihren Standort zubewegten, sagte Sothorn neben ihm: »Sie kommen. Wenn sie erst auf die Kinder gestoßen sind, werden sie uns bald auf die Spur kommen.«
Wieder dauerte es zu lange, bis die Worte Geryims Verstand erreichten. Sothorn versetzte ihm einen Stoß. »Komm schon!«
Endlich erwachte er aus seiner Starre. Keine weiteren Toten, sang es in ihm und trieb ihn vorwärts. Erst mit einigen langsamen Rückwärtsschritten, dann, sobald Sothorn an seiner Seite war, im vollen Lauf und mit den Gipfeln vor Augen.
Anfangs hörten sie nichts außer ihrem eigenen Atem und dem Wind, der sich in den Berghängen verfing. Dann setzten fast gleichzeitig das ferne Trommeln von Pferdehufen und das Rauschen des Wasserfalls ein. Sie schrien sich gegenseitig an, um sich anzustacheln, und stützten sich, wenn einer von ihnen ins Straucheln geriet. Irgendwann gesellten sich zu dem Donnern der Hufe auch Rufe. Der Berg, der ihnen mit seinen unwegsamen Hängen jede Luft aus den Lungen trieb, wurde plötzlich zu ihrem Verbündeten, da er all seine Bezwinger gleichermaßen verlangsamte.
Als sie den Wasserfall erreichten, wagte Geryim einen Blick nach hinten. Ihre Verfolger hatten die Pferde zurücklassen müssen. Umso entschlossener arbeiteten sie sich den Hang hinauf und übersprangen mit Leichtigkeit Hindernisse, die Geryim und Sothorn nur mit Mühe überwunden hatten.
»Wir schaffen es nicht«, behauptete Sothorn plötzlich atemlos. Seine Stimme drohte im Rasseln seines Keuchens unterzugehen. Oder war es Geryims Herz, das so laut schlug, dass es alles andere auszulöschen drohte?
Zu ihren Füßen schoss das Wasser in die Tiefe. Es traf auf mehrere Felsstufen mit niedrigen Wasserbecken, bevor es sich weiß schäumend ins Meer ergoss. Hinter ihnen näherten sich die wütenden Zenjaner.
»Wir müssen.« Geryim wusste nicht, woher er seine Entschlossenheit nahm. Alles, was er wusste, war, dass er nicht aufgeben konnte. Nicht, nachdem er endlich den ersten Schritt zu seinem wahren Selbst getan hatte. Nicht jetzt, da er endlich haben konnte, was ihm bisher schmerzhaft gefehlt hatte.
Sothorn erwiderte nichts. Sein Umhang war auf der Bergwiese zurückgeblieben, sodass er stärker denn je der winterlichen Luft ausgesetzt war. Geryim beneidete ihn darum. Sein eigener Umhang schnürte ihm die Luft ab und würde wie ein Amboss an seinen Schultern hängen, wenn er erst mit Wasser getränkt war. Aber er konnte es sich nicht leisten, ihn aufzuschnüren. Er konnte sich überhaupt keine Verzögerungen mehr leisten.
Sothorn schien zu demselben Schluss gekommen zu sein. Er lächelte dünn. »Hoffen wir, dass Gor weiterhin ein Auge auf uns hält.« Dann machte er sich rückwärts an den Abstieg zur ersten Felsenstufe. Geryim ließ ihm einen kleinen Vorsprung, dann folgte er ihm.
Sie wussten beide, dass ihnen nicht genug Zeit blieb. Es war nicht zu übersehen gewesen, dass einige der Zenjaner lange Jagdbögen mit sich führten. Es ging ihnen gar nicht darum, die Küstenlinie zu erreichen. Nur darum, so viel Höhe wie möglich hinter sich zu lassen.
Irgendwann schwirrten ihnen die ersten Pfeile um die Ohren. Der Winkel, in dem die Schützen auf sie anlegten, war zu ungünstig, als dass ihnen ein Blattschuss gelingen konnte. Doch wenn sie nur genug Pfeile abschossen, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie irgendwann trafen oder sie so sehr störten, dass sie fehlgriffen. Der Wasserfall hatte sie bereits zweimal erfasst und mit jedem Griff an den schlüpfrigen Stein verlor Geryim weiter an Gefühl in den Händen.
Dann schrie Sothorn auf. Angst legte sich fest um Geryims Herz und drohte, es zu zerquetschen. Er sah Sothorn bereits getroffen den Halt verlieren und in die Tiefe stürzen. Doch stattdessen stellte er fest, dass Sothorn ihm etwas zeigen wollte. Er hatte sich eng an den Felsen gedrängt und deutete in die Ferne. Da entdeckte Geryim, was seine Aufmerksamkeit geweckt hatte: Hinter der Südspitze der Insel waren die Segel der Henkersbraut aufgetaucht.
Geryim blickte zwischen seinen zitternden Armen hindurch in die Tiefe. Vor ihm türmte sich schwarzer Stein wie eine Wand auf. Die letzte Felsstufe war ganz nah. Er suchte Sothorns Blick und hob fragend die Brauen. Die Antwort bestand aus einem zähen Grinsen.
Beinahe zeitgleich setzten ihre Füße auf. Auf der untersten Felsstufe angekommen, wateten sie durch das reißende Wasser. Sobald sie die Kante erreichten, sahen sie sich an. Geryim wollte nichts mehr, als Sothorn zum Abschied zu küssen. Aber die Bogenschützen würden gleich wieder anlegen und sie hatten ihr Glück an diesem Tag bereits weidlich herausgefordert.
Also beließen sie es bei einem Nicken und einem unausgesprochen Versprechen.
Dann sprangen sie.