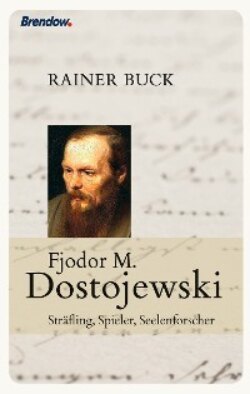Читать книгу Fjodor M. Dostojewski - Rainer Buck - Страница 10
Gegenwind
ОглавлениеNoch während die „Armen Leute“ ihrer Erstveröffentlichung harren, arbeitet Dostojewski an einer zweiten längeren Erzählung. Inspiriert von E. T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“, behandelt „Der Doppelgänger“ das Thema Persönlichkeitsspaltung. Die Groteske dreht sich um den achtbaren Angestellten Goljadkin, der in einem Anfall von Liebeskummer seinem verdrängten anderen „Ich“ begegnet, das daraufhin langsam, aber sicher die Kontrolle über sein Leben übernimmt.
Als die Erzählung nur wenige Monate nach „Arme Leute“ in einer Monatszeitschrift veröffentlicht wird, entpuppt sie sich nicht als das, was die Verehrer des literarischen Debüts erwartet hatten. Belinski ist zwar von der sprachlichen Kunstfertigkeit angetan, aber er warnt den Autor davor, sich „auf Kosten der Kunst zu stark auf pathologische Zergliederung einzulassen“. Dabei geht der Kritiker natürlich von seinem eigenen Kunstbegriff aus. Die Kunst soll in seinen Augen vornehmlich als Gewissen und als Enthüllerin gesellschaftlicher Missstände dienen.
Die Reaktionen auf den „Doppelgänger“ verunsichern den gerade noch auf Wolke sieben schwebenden Dostojewski hochgradig. Auf gesellschaftlichem Parkett macht er ohnehin keine gute Figur. Als er von Freunden in den Kreis des Dichters Panejew eingeführt wird, ist dessen Frau von der neuen Bekanntschaft nicht gerade angetan: „Aufgrund seiner Jugend und Nervosität gelang es ihm nicht, sich den Umgangsformen anzupassen“, beschreibt sie sein Auftreten. Möglicherweise verhält sich Dostojewski besonders ungeschickt, weil er in die Panejewna eine Zeit lang ernsthaft verliebt ist.
Der ehrgeizige und überspannte Neuling wird zur Zielscheibe zunächst milden Spottes, der sich aber zunehmend verschärft. Turgenjew, der Dostojewski zunächst enthusiastisch zugetan schien, macht eines Abends im Kreis eine Bemerkung über einen „Provinzler, der sich für ein Genie hält“. Für den tiefgetroffenen Dostojewski ist dies der Anlass, sich für immer aus dem Zirkel zu verabschieden. Zu den drückenden Geldnöten, seiner Dauerbegleitung, kommen jetzt Phasen der Melancholie und der Selbstzweifel.
In dieser Situation kommt Dostojewski in Kontakt mit einem Kreis ernsthafter junger Männer, angeführt von dem Brüderpaar Beketow, von denen einer ein Mitstudent Dostojewskis an der Ingenieursschule gewesen war. In diesem Kreis wird nicht nur über einen utopischen Sozialismus philosophiert. Man versucht zugleich, nach den eigenen Idealen zu handeln. Die Männer gründen auf Dostojewskis Initiative hin sogar eine Wohngemeinschaft.
Bruder, ich mache nicht nur eine moralische, sondern auch eine physische Wiedergeburt durch, schreibt er im November 1846 an Michail. Noch nie war in mir solche Klarheit, solch innerer Reichtum, noch nie war mein Charakter so ausgeglichen, meine Gesundheit so zufriedenstellend wie jetzt. Dies verdanke ich in hohem Maße meinen Freunden, mit denen ich lebe. Dostojewski erwähnt hier ausdrücklich seine Gesundheit, da er in den Monaten zuvor stark an einer Nervenkrankheit gelitten hat. Möglicherweise sind es schon die Anzeichen seiner späteren Epilepsie. Die Anfälle sind zwar nicht von Krämpfen, aber von zeitweiliger Bewusstlosigkeit begleitet.
Der Beketow-Zirkel besteht nur kurze Zeit, da die Brüder Petersburg verlassen, doch ein anderes Brüderpaar aus dem Freundeskreis, Walerian und Apollon Maikow, bleibt Dostojewski als Stütze erhalten. Walerian ist Literaturkritiker und bricht öffentlich eine Lanze für ihn. Tragischerweise stirbt Walerian schon 1847, während der Dichter Apollon Maikow ein lebenslanger Freund wird.