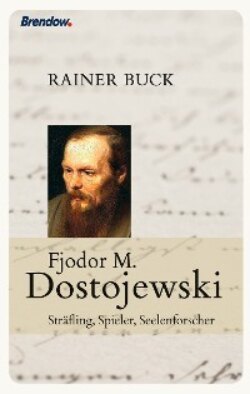Читать книгу Fjodor M. Dostojewski - Rainer Buck - Страница 9
„Der herrlichste Augenblick in meinem Leben“
ОглавлениеWährend er seinen ersten Roman „Arme Leute“ fertigstellt, ist Fjodor M. Dostojewski starken Stimmungsschwankungen unterworfen. Einerseits fühlt er sich wie ein literarischer Ikarus, dem kein Ziel unerreichbar erscheint, andererseits hat er das Gefühl, mit dem ersten Roman alles auf eine Karte zu setzen und sich bei einem Misserfolg aufhängen oder in die Newa gehen zu müssen. In den Briefen an Michail spiegeln sich teilweise innerhalb eines einzigen Absatzes die höchsten Hoffnungen und schlimmsten Befürchtungen. Dimitri Grigorowitsch, ein ehemaliger Kommilitone aus der Akademie und später selbst ein Schriftsteller von Rang, wohnt in diesen Monaten mit Dostojewski zusammen. Er beschreibt dessen rastlose Arbeit und zähe Verbissenheit: „Dostojewski konnte tage- und nächtelang ununterbrochen am Schreibtisch sitzen. Er verlor kein Wort darüber, woran er gerade schrieb … Sowie er mit dem Schreiben aufhörte, nahm er gleich wieder das eine oder andere Buch zur Hand.“
Die akribische Arbeit am Roman-Erstling zieht sich bis Ende Mai 1845 hin. Nachdem er allerdings die letzte Überarbeitung bewältigt und zunächst seinem Mitbewohner Grigorowitsch das Manuskript vorgelesen hat, geht es Schlag auf Schlag. Grigorowitsch ist derart begeistert, dass er den Aufschrieb noch am selben Abend zu einem gemeinsamen Freund, dem Dichter Nikolai Nekrasow, mitnimmt. Hingerissen lesen sich die jungen Literatur-Enthusiasten das komplette Werk gegenseitig vor, klingeln den Urheber dann in den frühesten Morgenstunden aus dem Bett, fallen ihm in die Arme und beglückwünschen ihn zu einem Geniestreich. Als der herrlichste Augenblick in meinem Leben geht diese Begebenheit in Dostojewskis Erinnerung ein.
Das Erfolgserlebnis wird komplettiert, als der bekannte Literaturkritiker Wissarion Belinski ebenfalls begeistert auf das Erstlingswerk des jungen Dostojewski reagiert. Nekrasow hatte es ihm mit dem Versprechen präsentiert, hier sei „ein neuer Nikolai Gogol“ zu entdecken. Der hochgegriffen erscheinende Vergleich löst bei dem Petersburger Literaturpapst anfänglich eher Skepsis aus, doch diese wandelt sich während der Lektüre rasch in Überschwang. Belinski drängt es daraufhin, den Verfasser der „Armen Leute“ möglichst schnell persönlich kennenzulernen. Bei der ersten Begegnung findet er gegenüber Dostojewski bemerkenswerte Worte: „Die Wahrheit ist Ihnen kund und offenbar geworden wie ein großes Geschenk. Halten Sie dieser Gabe gegenüber die Treue, und Sie werden ein großer Schriftsteller.“
Auch wenn „Arme Leute“ heute gegenüber Dostojewskis Spätwerk eher ein Schattendasein fristet, blitzt darin schon bemerkenswert viel von seinem Genie auf. Die Bemerkung „Gabe der Wahrheit“ wählt Belinski, weil er in dem jungen Autoren einen sozialistischen Gesinnungsgenossen sieht. Man könnte dieses Prädikat trotzdem mit Fug und Recht schon bei diesem Erstling auf Dostojewskis Talent übertragen, Feinheiten menschlicher Seelenregungen mit besonderem Einfühlungsvermögen in seinen Romanfiguren abzubilden. Der Leser kann in diesen Charakterzeichnungen Menschen aus Fleisch und Blut wiederfinden, mit denen er mitzufühlen und mitzuleiden vermag, nicht zuletzt, weil sie ihm manche Selbsteinsicht vermitteln. Auch wenn Dostojewskis Charaktere selten Menschen sind, mit denen man sich tatsächlich identifizieren möchte, treten sie einem doch so plastisch vor Augen, dass man die Bruder- oder Schwesterbeziehung zu ihnen am Ende der Begegnung nicht mehr leugnen kann und will. Dies gilt zumindest für Leser, die unbehagliche Erkenntnisse nicht scheuen, sondern einen Blick auf ihre inneren Abgründe riskieren.
Ohne sich dessen am Anfang seines Schreibens wohl vollständig bewusst zu sein, setzt Dostojewski zugleich das um, was Jesus im Evangelium allen, die sich Christen nennen, kategorisch zur Pflicht macht: die „Kleinen und Bedrückten“ anzunehmen. „Wer diese meine geringsten Brüder aufnimmt, nimmt mich auf“, sagt der Prediger aus Nazareth. Dostojewski widmet sich den Schicksalen von gesellschaftlichen Randsiedlern. Seine Protagonisten gehören zu den „Stillen im Lande“, hinter denen man gemeinhin keine besondere Gefühls- und Gedankentiefe vermutet. Ohne ihr Los zu beschönigen oder sie äußerlich aus den engen Fesseln ihrer Lebensumstände zu befreien, verleiht er ihnen eine völlig eigene Art von Würde. Dostojewski versteht es, die Aufmerksamkeit des Lesers in einer Weise auf die „Armen Leute“ und ihre Hoffnungen und Ängste zu richten, dass dieser sie mit ihren Eigenheiten und Schwächen anzunehmen lernt und sie als „Menschengeschwister“ wahrnimmt.
„Arme Leute“ ist ein Briefroman und beschreibt den anrührenden Gedankenaustausch des ältlichen Amtsschreibers Makar Dewuschkin und der jungen, mittellosen Valenka Dobrosjovola. Die Geschichte spielt in einem Armenviertel in Sankt Petersburg. Sprachlich fühlt sich Dostojewski in das Milieu ein, wenn er den schüchternen und grundgütigen kleinen Beamten in einer eigentümlichen Art stammeln lässt. Der übermäßige Gebrauch der typischen Verkleinerungsformen gibt seinen Briefen an die verzweifelte Nachbarin, die das Opfer einer Kupplerin und eines gewissenlosen Reichen ist, etwas Zärtliches. Dazu erschien es mir noch, schreibt Makar an die nahe und doch schmerzlich ferne Valenka, dass auch Ihr liebes Gesichtchen flüchtig am Fenster auftauchte, dass auch Sie aus Ihrem Zimmerchen nach mir ausschauten … Und wie es mich verdross, mein liebes Täubchen, dass ich Ihr reizendes Gesichtchen nicht deutlicher sehen konnte!
Die beiden Protagonisten schaffen es in ihrer rührenden und zugleich schmerzenden Unbeholfenheit nicht, das Verständnis füreinander nachhaltig dazu zu nutzen, sich gegenseitig aus der Vereinsamung und Verzweiflung zu helfen. Dostojewski weckt noch für die Schicksale weiterer eindrücklicher Gestalten tiefes Mitgefühl. Da ist zum Beispiel Petinka, mittelloser Student und Sohn eines hoffnungslosen Säufers. Valenka liebt den verzweifelten jungen Mann, aber dessen todbringende Krankheit macht eine gemeinsame Zukunft von vornherein aussichtslos. Von unvergesslichem Eindruck bleibt die Szene, in der Petinkas Vater dem Sarg des Sohnes durch das ganze Stadtviertel nachtorkelt, weil er den Verstorbenen, dessen Achtung er durch die Folgen seiner Trunksucht verloren hatte, nicht loslassen kann.
Dostojewski zeigt, wie Menschen unter dem Druck der Verhältnisse versuchen, ihre Würde zu bewahren, nur, um dann doch immer wieder den zerstörerischen Kräften zu unterliegen. Die Skrupellosigkeit Stärkerer dominiert über die wehrlose Einfalt und beraubt die Armen ihrer lange bewahrten letzten Refugien: der Selbstachtung und der inneren Freiheit.
Zwar findet man in Dostojewskis Werk einige Parallelen zu anderen Autoren, vor allem zu Nikolai Gogol, doch kaum ein anderer wartet mit vergleichbar vielschichtigen Charakteren auf. Dabei ergreift der Erzähler nie offensichtlich Partei oder sortiert seine Figuren nach „gut“ und „böse“. Selbst Valenka, eigentlich zur tragischen Heldin prädestiniert, ist nicht nur hilfloses Opfer, sondern missbraucht zeitweise die Güte ihres Freundes Makar Dewuschkin. An Dewuschkin selbst könnte der Leser wiederum, wie an vielen späteren Helden bzw. Antihelden Dostojewskis, verzweifeln, weil er mehr ein Dulder als ein Gestalter ist.
Belinski sieht in „Arme Leute“ den ersten ernst zu nehmenden sozialen Roman in der russischen Literatur. In den literarisch interessierten Kreisen Petersburgs rückt das Werk noch vor seiner Erstveröffentlichung in Nekrasows „Petersburger Almanach“ in den Fokus des allgemeinen Interesses. Dem vielgelobten Autor steigen die Lobeshymnen zu Kopf. Er ist berauscht vom eigenen Talent und schafft es innerhalb von Monaten, die allgemeine Gunst zu großen Teilen schon wieder zu verspielen.
Das liegt freilich nicht vornehmlich daran, dass er in Gesellschaften ein überzogenes Selbstbewusstsein zur Schau stellt (womit er in erster Linie Unsicherheiten zu kaschieren versucht), sondern weil er als Literat ganz offensichtlich nicht dazu angetreten ist, fremde Erwartungen zu erfüllen. Was ihm im Auftreten an echter Selbstsicherheit fehlt, das zeigt er, wenn es um die Entwicklung literarischer Eigenständigkeit geht. Zwar hat er durchaus seine Vorbilder unter den großen Autoren und ist nicht unbeeinflusst vom Zeitgeist, doch wenn er ein Thema als Erzähler angeht, wird in seiner Hand daraus erstaunlich oft etwas Unvorhersehbares.
Außerdem passt er weltanschaulich in kein Raster. Der überzeugte Sozialist Belinski, tatkräftiger Starthelfer für Dostojewskis Karriere, muss bald feststellen, dass der junge Autor nur bedingt ein verlässlicher Mitstreiter für seine politischen Ideen ist. Zwar zeigt Dostojewski zu dieser Zeit keine starke Bindung mehr zur orthodoxen Religion, mit der er aufgewachsen ist, aber Belinskis antireligiöse Einstellung stößt ihn im Laufe der Zeit ab. So, wie Dostojewski während der Jahre an der Akademie zuweilen fast in einer Art Trotzreaktion die orthodoxen Rituale gepflegt hat, um sich damit von der allgemeinen Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit abzusetzen, bringt es ihn jetzt fast in Rage, wenn abfällige Äußerungen über Christus und den Glauben gemacht werden. Der Konflikt mit Belinski schwelt zu dieser Zeit nur, doch in späteren Jahren findet Dostojewski kein gutes Wort mehr für den 1848 im Alter von nur 37 Jahren verstorbenen Kritiker und Publizisten.
Im Kreise Belinskis
Dostojewski kann zwar jeden Weg des Zweifels an der christlichen Dogmatik mitgehen und alles an der Religion hinterfragen, ist jedoch gleichermaßen skeptisch den Ideologien der Religionskritiker gegenüber. Sein Bild vom Menschen entwickelt und pflegt er nicht in Salongesprächen, sondern dadurch, dass er tatsächlich keine Scheu hat, sich mit Bettlern und Verzweifelten abzugeben, selbst wenn diese Kontakte manchmal dazu führen, dass er bestohlen wird oder er einem „Unwürdigen“ Geld schenkt.
Offensichtlich bekommt Dostojewski durch den Verkauf seiner Manuskripte und kleinere literarische und journalistische Aufträge immer wieder Geld in die Hand. Zwischendurch leistet er sich größere Wohnungen, die über seine Verhältnisse gehen. Außerdem trägt er zu dieser Zeit etwas Geld in die Petersburger Freudenhäuser, in denen viele deutschstämmige Mädchen tätig sind: Die Minchen, Klärchen, Mariannen usw. sind überaus hübsch, aber auch sehr kostspielig, berichtet er Michail und kokettiert: Kürzlich haben Turgenew und Belinski kein gutes Haar an mir gelassen wegen meines liederlichen Lebenswandels.
Kurz zuvor noch hatte sein ehemaliger Quartiergeber Dr. Riesenkampf eine völlig andere Beobachtung gemacht: „Mit zwanzig Jahren suchen die jungen Leute gewöhnlich ihr Ideal bei den Frauen und laufen schönen Weibern nach. Auffallender Weise war bei Dostojewski nichts dergleichen wahrzunehmen. Er verhielt sich völlig gleichgültig in Hinsicht auf die Gesellschaft von Frauen, und es sah fast so aus, als habe er eine gewisse Antipathie gegen sie!“
Dostojewski kann sich über lange Phasen hinweg in seiner Arbeit vergraben und wie ein Asket leben. Trotzdem ist er nicht unempfänglich dafür, sich zeitweise im Rausch von Vergnügungen zu vergessen. In seinen Erzählungen zeigt er, dass er durchaus keine geringe Meinung von Frauen hat. Dostojewski ist wohl in den frühen Petersburger Jahren einfach noch nicht reif für eine Partnerschaft. Und vermutlich wäre er bei den meisten Frauen, die ihn auch intellektuell als Partnerinnen hätten interessieren können, aufgrund seiner praktischen Lebensuntüchtigkeit nicht unbedingt angekommen.