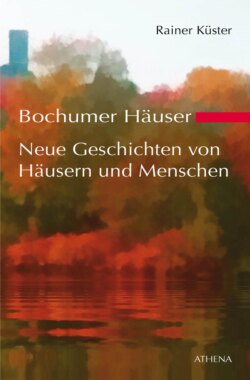Читать книгу Bochumer Häuser - Neue Geschichten von Häusern und Menschen - Rainer Küster - Страница 5
Hämmerchenbier
ОглавлениеMan darf wirklich nicht allzu lange darüber nachdenken, welche und wie viele Zufälle unser Leben bestimmen. Dass ich zum Beispiel im Jahre 1967 mein Studium hier in Bochum fortsetzte und dann ein Leben lang auch hier geblieben bin, hat wesentlich damit zu tun, dass ich bei meiner ersten Visite in der neuen und noch unfertigen Universität, unten vor der alten Mensa, Kalle von Lengerke wiedertraf. Wir stammen beide aus derselben Gegend im Weserbergland, er aus Vlotho, ich aus Rinteln. Kennen gelernt hatten wir uns aber erst während unseres Englischstudiums an der Hamburger Universität.
Noch ein Jahr zuvor hatten Kalle und ich gemeinsam bei Broder Carstensen im Altenglisch-Seminar gesessen und uns auch gemeinsam mit einem gewissen Erfolg auf die abschließende schriftliche Prüfung vorbereitet. Dann hatten wir uns erst mal wieder aus den Augen verloren und trafen uns nun zufällig vor einem Anschlagbrett vor der provisorischen Bochumer Mensa. Kalle, damals schon ausgestattet mit Frau und Kind, hatte sich bereits für Bochum entschieden. Und weil das so war, blieb ich am Ende auch, denn ich wollte irgendwie ins Westdeutsche. Meine damalige Freundin und spätere Ehefrau arbeitete zu der Zeit in Wesel, und ich verspürte Lust, ihr nah zu sein. Aber es hätte natürlich genauso gut Münster sein können oder meinetwegen auch Köln. Ich entschied mich kurz entschlossen für Bochum, weil Kalle schon da war, weil er zur rechten Zeit am rechten Ort war und, ganz wichtig, weil ich nun nicht mehr länger suchen musste. Ob er mir damals auch diesen seltsamen, durchlöcherten Studentenausweis gezeigt hat, habe ich vergessen.
Im Übrigen war mir Bochum völlig fremd, bis auf ein kleines Detail, das, wie ich fand, Kalle von Lengerkes Votum für Bochum noch Rückhalt verlieh. In meinen drei Hamburger Studienjahren hatte ich bei Vetter Hartwig Küster in Altona gewohnt, und zwar in der Altonaer Bahnhofstraße, die heute Max-Brauer-Allee heißt. Wenn man links um die Ecke ging, war man auf der Ehrenbergstraße, die nach einem Onkel des Bochumer Pfarrers Hans Ehrenberg benannt war, von dem ich in diesem Buch an anderer Stelle erzählen werde. Damals sagte mir der Name Ehrenberg noch nichts. Ich ging auch vorzugsweise rechts um die Ecke herum, bis zur »Großen Bergstraße«. Dort gab es eine beschauliche Hamburger Kneipe. Sie hieß »Bodega« oder so ähnlich. Aber für meinen Vetter Hartwig und mich war sie nur die Schlegel-Kneipe. Der Wirt war ein bisschen muffelig oder, genauer gesagt, norddeutsch einsilbig, was uns aber nicht im Mindesten störte, denn das Pils, das dort ausgeschenkt wurde, war Schlegel-Pils, und es schmeckte uns wunderbar und gar nicht so selten.
Immer nämlich, wenn wir das Gefühl hatten, wir seien über Gebühr von den Lasten unseres jugendlichen Daseins gezeichnet, dann vertraten mein Vetter und ich uns abends noch ein wenig die Füße und kehrten mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit in der Schlegel-Kneipe ein. Der Wirt nahm sich trotz, vielleicht auch wegen seiner kommunikativen Defizite stets sieben bis acht Minuten Zeit, um auf die Tulpe einen hoch aufgeschossenen Feldwebel, also eine Schaumkrone, zu zaubern. Er murmelte etwas, das irgendwie besagte, nun sei »erst der richtige Druck« auf dem Bier, was immer das heißen mochte. Aber geschmeckt hat es uns, und ich würde mir wünschen, dass ich auf einem meiner heutigen Hamburg-Besuche noch einmal mit meinem Vetter in die Schlegel-Kneipe gehen könnte.
Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich damals in Hamburg schon ahnte, aus welcher geografischen Himmelsrichtung Schlegelbier denn überhaupt kam. Als ich jedoch im Jahre 1967, nach erfolgreicher Immatrikulation, meinen ersten Rundgang durch die Bochumer Innenstadt machte, war mir schnell alles klar. Ich begab mich dorthin, wo zwölf Jahre später die große Weltausstellungsglocke aufgestellt wurde, also an die Stelle, an der ich mehr oder weniger das Zentrum meiner neuen Heimstatt vermutete: Hinter mir lag das Rathaus und vor mir das große Gelände der Schlegel-Brauerei mit dem wuchtigen Siloturm, damals noch selbstbewusst und weithin sichtbar das traditionelle Warenzeichen, die drei Hämmerchen aus dem alten fränkischen Wappen der Familie Schlegel, präsentierend. Das gefiel mir irgendwie, und ich gewann den Eindruck, dass ich außer Kalle von Lengerke einen zweiten Freund hatte in Bochum.
Seitdem ist viel passiert. Schon zwanzig Jahre später gab es Schlegelbier nicht mehr, denn im Jahre 1980 stellte die Bochumer Brauerei, die noch in den sechziger Jahren zu den zehn größten Braubetrieben der Bundesrepublik Deutschland gehört hatte, die Produktion ein. Für ein paar Jahre braute man Schlegel bei der Dortmunder Union-Brauerei, und Ende 1987 wurde Schlegelbier, wie es in der betriebswirtschaftlichen Fachsprache heißt, endgültig vom Markt genommen. Aber der Siloturm ist noch da, auch das Sudhaus, das man ebenfalls gern abgerissen hätte, das aber so beharrlich, vielleicht sogar tückisch über Stahlträger mit dem Turm verbunden war, dass der auch eingestürzt wäre, wenn man getan hätte, was man zunächst vorhatte. So gehört denn der Schlegel-Turm nach wie vor zu den wenigen Wahrzeichen, die Bochum geblieben sind. Und man kann sogar noch eine Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte, wie es dazu kam, dass mitten im Westfälischen irgendwann einmal bayerisches Bier gebraut wurde.
Der diese Geschichte ganz genau kennt, heißt Klaus-Joachim Schlegel. Er ist das letzte männliche Glied einer ganzen Kette von Herren aus der Schlegel-Dynastie, die alle irgendwie mit Bier zu tun hatten. Zwölf Generationen kann Herr Schlegel aufzählen. Erst mit seiner Tochter Sibylle endet diese Tradition, der sie sich nur noch privatissime verpflichtet fühlt, wenn sie mal ein Gläschen Bier trinkt. Aber wir wandern zunächst in unserer Erzählung zurück ins Jahr 1850, als das Brauen von Bier noch das eigentliche Metier der Schlegels war; da machte sich nämlich einer von ihnen im fränkischen Steigerwald auf, um den preußischen Bierbrauern im Westfälischen zu zeigen, wie man es richtig macht.
Herr Schlegel empfängt mich in seinem gemütlichen Heim an der Uhlandstraße. Der Dackel wird erst mal in ein anderes Zimmer bugsiert, wo er von Zeit zu Zeit auf sich aufmerksam macht, indem er Töne von sich gibt. Wir trinken vorsichtshalber Mineralwasser, damit die Erzählung nicht ins Schwärmerische abdriftet.
Die für Bochum wichtige Etappe seiner Erzählung beginnt mit Johann Joachim Schlegel. So hieß nämlich der Urgroßvater, der aus Bergtheim im fränkischen Steigerwald stammte und der aus alter Familientradition in Erlangen das Brauhandwerk erlernt hatte. Nach Schlegels Lehrjahren kamen seine Wanderjahre, die ihn zunächst einmal als Brauer in den Süden, nach Augsburg, München und Innsbruck und sogar bis ins heutige Italien führten. Nach fast vierjähriger Wanderzeit kehrte Johann Joachim Schlegel heim ins Fränkische, und es dauerte dann gar nicht mehr so lange, bis an ihn der Ruf aus dem nördlichen Ausland erging, nämlich aus dem eigentlich ungeliebten Preußen. Dass Johann Joachim Schlegel sich trotz väterlicher Bedenken aufmachte, sollte weit reichende Folgen haben. Am 1. Oktober 1850 reiste er von Fürth in das künftige Bochum-Hamme – »zu Condition nach Overdyk bei Cöln fahrend«, wie es bei großzügiger Auslegung der geografischen Verhältnisse in seinem noch erhaltenen Wanderbuch heißt.
Hinter der Ortsbezeichnung »Overdyk« verbarg sich ein Anwesen, von dem heute nur noch Restbestände in Form des Evangelischen Kinderheims Overdyk erhalten sind. Der Besitzer des damaligen Anwesens war Gotthard Graf von der Recke-Volmarstein. Er hatte durchaus politischen Einfluss, war Landrat des Kreises Bochum, außerdem nach Angabe des Schlegelschen Urenkels ein Philanthrop und eben Gutsherr auf »Haus Overdyk«, wo er auch eine eigene Brauerei betrieb. Diese Brauerei versorgte aber nicht nur die gutsherrlichen Bedürfnisse, sondern das Bier aus Hamme konnte man auch käuflich erwerben.
Nun muss dem Grafen von der Recke-Volmarstein, dem nichts Menschliches fremd war, irgendwie zu Ohren gekommen sein, dass die von den Braukünsten seines Hauses profitierenden Einheimischen des herkömmlichen, etwas säuerlich schmeckenden, obergärigen Biertyps, der im westfälischen und darüber hinaus auch im norddeutschen Raum gebraut wurde, überdrüssig waren. Man verlangte nach den erheblich besser mundenden, auch kräftigeren, untergärigen Bieren, wie sie im bayerischen Ausland gebraut wurden. Die Sache hatte jedoch einen Haken: Die bayerischen Biere waren teuer, weil zollpflichtig, mussten gewissermaßen importiert werden. Was den Preis betraf, so verhielt es sich damit wie heute mit den Spritpreisen, denn die steigende Nachfrage verteuerte das aus dem Süden angereiste Bier zusätzlich.
Hier nun regte sich das philanthropische Gewissen des landrätlichen Grafen. Mit Sorge erfüllte ihn, so erzählt es Klaus-Joachim Schlegel, dass vor allem die ärmeren Bevölkerungskreise sich bei ihrer Getränkewahl in Unkosten stürzten, die weit über ihre Verhältnisse gingen. Um das begehrte Gebräu, auf das man trotz finanzieller Engpässe nicht verzichten wollte, seiner Einwohnerschaft billiger anbieten zu können, war er auf den Gedanken verfallen, einen Fachmann aus dem bayerischen Raum herbeizurufen, der nun den neuen »Stoff« nach Erlanger und Augsburger Art brauen sollte. In Mittelfranken wurde der Ruf gehört.
Im Oktober 1850 schon nahm Urgroßvater Schlegel seine Tätigkeit als Braumeister in der Brauerei des Grafen auf. Das von ihm hergestellte Bier schmeckte den Einheimischen vortrefflich, zumal sie es sich jetzt leisten konnten. Außerdem war es haltbarer als das bisher bekannte. Das erste Opfer des nun einsetzenden Konkurrenzkampfes war die unweit von Haus Overdyk gelegene Brauerei von Wilhelm Kabeisemann, die schon 1852 schließen musste.
Aber es dauerte nicht lange, da war abzusehen, dass auch die Haltbarkeit der Brauerei auf Haus Overdyk mit derjenigen des dort gebrauten Bieres nicht konkurrieren konnte. Nicht etwa, weil sich die Bedingungen des Brauens im landrätlichen Hause verschlechtert hätten, sondern weil inzwischen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Grafen prekärer geworden waren. Sein Sohn, der den erzieherischen Maßnahmen des vom Vernunftgedanken beseelten Vaters erfolgreich widerstanden hatte, war offenbar hoch verschuldet, wobei nicht überliefert ist, ob der Genuss des neuen Bieres damit im Zusammenhang stand. Jedenfalls musste der Graf, um die Schulden des Sohnes zu begleichen, seinen Besitz nebst Brauerei nach und nach zerstückeln und schließlich verkaufen. Damit endete im Jahre 1853 auch das Engagement des Braumeisters Schlegel für den Grafen von der Recke-Volmarstein.
Doch Schlegel hatte inzwischen Erfolge zu verzeichnen. Sein bayerisches Bier war gut aufgenommen worden, er selbst scheint sich auch nicht vollkommen unwohl gefühlt zu haben im westfälischen Ausland. Insofern war es nur konsequent, dass er Pläne schmiedete, sich in Bochum niederzulassen und selbstständig zu machen. Das war aber gar nicht so einfach, denn zu diesem Zweck musste er die preußische Staatsangehörigkeit beantragen, ein trotz aller Erfolge im Westfälischen gleichwohl herbes Ansinnen für jemanden, der sich eigentlich eher im Bayerischen heimisch fühlte. Und doch musste es sein: Am 30. Dezember 1853 wurde der in Mittelfranken gebürtige Johann Joachim Schlegel von der Königlich Preußischen Regierung zu Arnsberg in den »Preußischen Untertanen-Verband« aufgenommen.
Zuvor hatte er klugerweise mit dem Maurermeister Wilhelm Hasselkuss verhandelt, dessen Wohnhaus mit kleiner Brauerei und Gaststätte an der Essener Chaussee – vor dem Bongard-Tor – Schlegel für die Dauer von acht Jahren pachten wollte. Man wurde sich einig. Zu den amtlichen Formalitäten gehörte es, dass der Magistrat der Stadt Bochum am 5. November 1853 die Braukonzession erteilte – ein landesherrliches Privileg, das der Stadt seit der Verleihung stadtähnlicher Rechte durch Graf Engelbert II. im Jahre 1321 zustand.
Allerdings gab es noch ein kleines Problem: Braumeister Schlegel musste einiges investieren und benötigte für seine Unternehmung natürlich Geld, das ihm der Vater auch durchaus hätte geben können, aber nicht geben wollte. Der hatte seinem Sohn übel genommen, dass er nicht in die Heimat zurückgekehrt und überdies noch zu den Preußen gegangen war. Da gab es zu Hause nichts zu holen. Doch der Schwiegervater seines Bruders sprang ein und investierte in die Aktivitäten des unternehmungslustigen Braumeisters.
Auch die privaten Verhältnisse sollten sich nun klären. Anfang Januar 1854 wurde im Fränkischen geheiratet. Anna Christiane Schwarz aus Erlangen war die Auserwählte. Ihr Vater musste vor dem Magistrat der Königlichen Universitätsstadt Erlangen einwilligen, dass seine Tochter den Ausländer Schlegel aus Bochum, gelegen im Königreich Preußen, heiraten würde. Der Umzug des jungen Paares war dementsprechend als Auswanderung zu betrachten. Am 7. Januar 1854 kehrte Schlegel mit seiner jungen Frau, beide biografisch gewissermaßen mit Migrationshintergrund ausgestattet, teils per Postkutsche, teils auf einem Rheinkahn nach Bochum zurück.
Im Mai 1854 eröffnete dann der junge Braumeister Johann Joachim Schlegel, der noch keine 33 Jahre alt war, in den Kellereien des Wirtshauses Hasselkuss und gleich vor den Toren der genau im selben Jahr aus der »Gußstahlfabrik Mayer & Kühne« hervorgegangenen Aktiengesellschaft »Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation« die »Bayerische Bierbrauerei J. Schlegel«. In der Nummer 35 der ersten Tageszeitung der Stadt Bochum, des »Märkischen Sprechers«, las sich das Gründungsinserat wie folgt:
Anzeige und Empfehlung.
Die Eröffnung meiner Bierbrauerei und Wirthschaft in dem bisher von Herrn Köchling bewohnten Hause des Herrn Hasselkuss zeige ich Freunden und Bekannten hiermit ergebenst an.
Bochum, den 1. Mai 1854.
Schlegel, ehemaliger Braumeister der Overdykschen Brauerei.
So hat es einmal angefangen mit den Schlegels in Bochum. Bleibt noch nachzutragen, dass schon im Jahre 1857 die gepachtete Braustätte zu klein geworden war. Die Nachfrage nach dem bayerischen Bier war ständig gestiegen. Bedingt durch die Schließung vieler kleiner Braustätten in der Stadt Bochum, konnte der junge Brauereibesitzer bald die Belieferung weiterer Gaststätten mit seinem Bier übernehmen und so den sich anbietenden Übergang von der Hausbrauerei zum gewerblichen Unternehmen vollziehen.
Schlegel kaufte einen Grundstücksstreifen der »Ecker’schen Posthalterei«, der seiner bisherigen Braustätte genau gegenüberlag. Und das war dann der Standort der Schlegelbrauerei, wo heute noch der weithin sichtbare Siloturm zu sehen ist. 1859 begann Braumeister Schlegel mit der Arbeit im eigenen Brauhaus. Das nach bayerischer Art nun in eigener Regie gebraute Bier fand bei der Bevölkerung weiterhin lebhaften Anklang. Die Brauerei wuchs zur maßgeblichen Brauerei Bochums heran. Sie ist es geblieben, bis im Jahre 1980 die Produktion im Bochumer Betrieb eingestellt wurde. Dem Urenkel des Gründers fiel als Personalchef die undankbare Rolle zu, die Auflösung des Betriebs mit zu betreiben. Er sitzt mir gegenüber, und ich habe das Gefühl, dass es ihm mehr Spaß macht, von den guten, alten Zeiten zu erzählen.
Bevor ich mich verabschiede, zeigt er mir nicht ohne Stolz den 23. Band der noblen »Neuen Deutschen Biographie«, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Auf den Seiten 43 und 44 des Bandes wird das Wirken des Bierbrauers Johann Joachim Schlegel gewürdigt und klug in den ihm zukommenden historischen Kontext gesetzt. Dort heißt es über den Gründer der Schlegel-Brauerei:
Schlegels unternehmerischer Weg und Erfolg, aus den kleinsten Anfängen einer Hausbrauerei heraus eines der führenden Brauereiunternehmen aufzubauen, spiegeln prägende Charakterzüge einer Epoche, in der die deutsche Brauwirtschaft einen grundlegenden Umbruch erlebte. Mit der seit den 1830/40er Jahren einsetzenden Umstellung von der in Nord- und Westdeutschland vorherrschenden obergärigen auf die untergärige »bairische« Braumethode, die zahlreiche bayerische Braumeister nach Norden führte, begann die Industrialisierung des Braugewerbes innerhalb der industriellen Ballungsräume.
Ich bin beeindruckt. Klaus-Joachim Schlegel, der Urenkel und fleißige Sammler familien- und firmenträchtiger Devotionalien, verabschiedet mich aufs Herzlichste und stattet mich auch noch aus mit allem Möglichen, was ich aus seiner Sicht für meinen Text gebrauchen kann. Soll ich das wirklich alles lesen? Mal sehen. Zunächst will ich hingehen und mir den Turm angucken, den der Gründer ja nicht mehr kennen gelernt hat, der aber dort steht, wo alles einmal angefangen hat. Und dann haben Herr Schlegel und ich noch etwas vor. Wir sehen uns wieder, ziemlich bald.
Es ist ein paar Wochen später, ein ganz normaler Donnerstagnachmittag im wunderschönen Monat Mai des Jahres 2012. Der Mai ist heute fast zu schön, eher ein bisschen drückend. Ich habe schon zweimal das Hemd gewechselt. An der Haltestelle Rathaus Nord verlasse ich die U 35 und begebe mich auf die Suche nach dem, was einmal die Gaststätte Hasselkuss war. Und ich werde fündig: Eine Gaststätte ist wirklich da, wo sie sein sollte. Allerdings heißt sie nicht mehr »Hasselkuss«, sondern »Game food & fun«, was immer sich hinter dem Namen verbergen mag. Über dem Eingang prangt das Label der Biersorte »Brinkhoff’s No. 1«, mit angelsächsischem Genitiv geadelt und als Premium Pilsener etikettiert.
Ich gehe mal rein, lande in einer Mixtur aus Restaurant und Bar, um diese Zeit noch ziemlich leer. Das Etablissement ist erheblich größer als eine normale Gaststätte, aber was ist heute schon eine normale Gaststätte? Ich frage nach, nenne den Namen Hasselkuss, doch der freundliche, junge Mann, der vorgibt, seit zwölf Jahren an Ort und Stelle tätig zu sein, hört auf sein Ehrenwort diesen Namen im Augenblick zum ersten Mal. Da kann man nichts machen. Draußen knipse ich noch ein bisschen herum, mache die obligatorischen Fotos.
Ein paar Schritte weiter, am Platz »An der Christuskirche«, werde ich dann doch noch fündig. Der äußerlich ein wenig lädierte Gebäudetrakt, der dort, von zwei kräftigen Pfeilern gestützt, in den Platz hineinragt, scheint, das legt jedenfalls die hochfrequente Reklame für »Brinkhoff’s No. 1« nahe, immer noch zu »Game food & fun« zu gehören. Aber von der Frontseite dieses Gebäudeteils her begrüßen mich die drei Hämmerchen des Schlegel-Emblems, als Relief in einer Art Stuckarbeit auf die Wand gesetzt; daneben befindet sich, ebenfalls als Relief, die Abbildung eines zweigeschossigen Fachwerkhauses, vor dem ein Bierfahrer oder der Wirt des Hauses ein Bierfass irgendwohin rollt; vielleicht hat das »Haus des Herrn Hasselkuss« einmal so ausgesehen. Schräg hinter dem Fachwerkhaus erhebt sich eine Abbildung des Schlegelturms; darunter sind die Jahreszahlen 1854 und 1959 abgebildet; ganz unten steht, angesichts der abblätternden Farbe nur mit Mühe zu entziffern, die Erklärung des künstlerischen Ensembles in Großbuchstaben: »ERSTE BRAUSTÄTTE«. Ich hoffe, dass ich auf meinen Fotos später noch mehr erkennen kann als jetzt. Aber eins ist klar: Die Jahreszahl 1854 bezieht sich offensichtlich auf die Schlegelsche Gründungsphase im Hause Hasselkuss. Die Jahreszahl 1959 gibt mir Rätsel auf, sie könnte auf die Entstehungszeit des Reliefs hinweisen.
Dann führt mich mein Erkundungsweg auf die andere Seite der Essener Chaussee, die heute Willy-Brandt-Platz heißt, und zwar in die kurze Passage mit dem Namen »Am Schlegelturm«. Vor mir erhebt sich das 58 Meter hohe Malzsilo aus dem Jahre 1926, rechts daneben das ebenfalls hohe Sudhaus, das schon früher, nämlich im Jahre 1906, gebaut wurde. Links vom Malzsilo sind flachere Gebäude angeschlossen, die auch älter aussehen als die Gebäude auf der anderen Seite des Platzes. Da gibt es ein Haus mit einem dunkelrot gestrichenen, runden Vorbau, das in blauen Lettern als Schlegel-Haus firmiert. Wenn ich mich richtig an die Karten erinnere, die mir Klaus-Joachim Schlegel gezeigt hat, dann muss hier der Generaldirektor residiert haben. Dahinter, also zur Straße hin, lag das Hotel Schlegel. Alles andere, die Gebäude der Verwaltung und der Abfüllung, das Labor, die Schwankhalle, Werkstätten, Küferei und Kesselhaus sind in den achtziger Jahren abgerissen und durch Neubauten ersetzt worden.
Mir wird klar, dass alles, was hier einmal gestanden hat, eine geschlossene Welt für sich gewesen sein muss. Sie reichte im Süden bis zur Junggesellenstraße, die dort früher auch Diekampstraße hieß und noch früher sogar Schillerstraße. Im Westen erstreckte sich das Schlegelsche Territorium bis zum Westring und darüber hinaus, wovon noch zu berichten sein wird. Jedenfalls ist auf diesem Areal Brauereigeschichte geschrieben worden, Aufstieg und Fall eines traditionsreichen Unternehmens haben sich, soweit Bochum betroffen ist, hier abgespielt. Ein paar Hinweise müssen in diesem Rahmen genügen:
Als Johann Joachim Schlegel im Jahre 1890 stirbt, hinterlässt er seinen Söhnen Wilhelm und Hermann Schlegel ein großes Unternehmen, das sich im Sinne des Slogans »Bochums Dreiklang, merk ihn dir: Kohle – Eisen – Schlegelbier« zur bedeutendsten Bochumer Brauerei entwickelt hat. Im Jahre 1899 wird das Unternehmen in eine Familien-Aktiengesellschaft umgewandelt. Vor dem Ersten Weltkrieg zählt Schlegel mit einem Ausstoß von mehr als 100.000 Hektoliter bereits zu den Großbrauereien.
Im Jahre 1918 genehmigen die Hauptversammlungen der Schlegel-Brauerei und der 1853 gegründeten Bochumer Bierbrauerei Moritz Scharpenseel AG die Verschmelzung beider Brauereien zur Schlegel-Scharpenseel-Brauerei AG. Der Zusammenschluss vollzieht sich nicht unbedingt stromlinienförmig, hat er doch seine kirchenpolitischen Knackpunkte; denn was geplant ist und am Ende auch realisiert wird, bedeutet, dass in Bochum das evangelische »blaue« Schlegelbier mit dem katholischen »schwarzen« Scharpenseel-Bier fusionieren wird. Das ist manchem Bochumer ein Dorn im Auge, so dass man anfangs sogar darüber nachdenkt, den Zusammenschluss als »Bochumer Bürgerbräu« firmieren zu lassen, um die konfessionellen Hakeleien zu entschärfen.
Ein Motiv für die Fusion beider Brauereien liegt wohl auch in der Tatsache begründet, dass der im Jahre 1896 geborene Hans Schlegel, Sohn und Erbe Wilhelm Schlegels, der als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg gedient hat, seit 1915 in Russland vermisst wird und auch in der Familie als tot gilt. Doch Hans Schlegel hat das Glück, dass ihm, wie vielen anderen deutschen Kriegsgefangenen, die legendäre schwedische Rot-Kreuz-Schwester Elsa Brändström, die als »Engel von Sibirien« in die Geschichte eingegangen ist, hilft zu überleben. Im Oktober 1920 kehrt Hans Schlegel, der Vater von Klaus-Joachim Schlegel, nach fünfjähriger Kriegsgefangenschaft im ostsibirischen Wladiwostok, wo deutsche Kriegsgefangene in einer Seifenfabrik arbeiten, in seine Heimatstadt Bochum zurück. Hinter ihm liegt eine Odyssee durch verschiedene mittel- und westsibirische Gefangenenlager und eine entbehrungs- und schreckensreiche Flucht quer durch Russland, die ein halbes Jahr gedauert hat. Er tritt schon im Dezember 1920 als kaufmännischer Angestellter in die Schlegel-Scharpenseel-Brauerei ein und wird bis 1961 als Direktor im Unternehmen tätig sein.
Die wichtigste Führungspersönlichkeit der Bochumer Brauerei ist in der Mitte des 20. Jahrhunderts Alfred Hövelhaus, seit 1921 im Unternehmen tätig, später Generaldirektor und Ehrensenator der TU Berlin. Auch während der Naziherrschaft leitet er den Betrieb. In einer Jubiläumsschrift zum 85-jährigen Bestehen der Brauerei heißt es:
Mit besonderem Stolz erfüllt uns alle die hohe Auszeichnung, die dem Werk durch Ernennung zum nationalsozialistischen Musterbetrieb zuerkannt worden ist. Die Schlegel-Scharpenseel-Brauerei war bei den ersten 30 Betrieben, denen diese ehrenvolle Anerkennung am 1. Mai 1937 durch den Führer Adolf Hitler persönlich zuteil wurde; seitdem ist sie ihr zweimal bestätigt worden, am 1. Mai 1938 und am 1. Mai 1939. Diese Auszeichnung ist uns Ehrung und Ansporn zugleich. Ansporn, allezeit einsatzbereit an unserer Stelle mitzuwirken an der Erfüllung der großen volkswirtschaftlichen Aufgaben der Gegenwart.
Im Zweiten Weltkrieg wird aufgrund der zentralen Lage auf der Turmplattform eine leichte Kanone zur Flugabwehr in Stellung gebracht. Genützt hat es nichts. Im November 1944 kommt nach der Zerstörung der Brauerei durch Bomben die Produktion zum Erliegen. Bei Kriegsende ist das gesamte Gelände der Brauerei nur noch ein Trümmerhaufen. Als es ans Aufräumen geht, findet man die geliebte Symbolfigur aus den dreißiger Jahren, das »Schlegel-Männeken«, unversehrt im Schutt. Es war stets Mittelpunkt bei allen Festakten im Schalander gewesen, also im Pausen- und Schankraum der Brauerei.
In den ersten Nachkriegsjahren sinkt der Bierausstoß auf seinen Tiefpunkt, und das Bier – eigentlich ein Ersatzgetränk aus Molke und Süßstoff – schmeckt auch so. Aber es geht dann doch noch einmal bergauf. Ab 1949 gibt es Schlegel-Bier wieder in bewährter Friedensqualität. In den fünfziger Jahren erhält Schlegel-Scharpenseel sogar die Generalvertretung für die Dubliner Guinness-Brauerei in der Bundesrepublik Deutschland. Ausdruck des wachsenden Erfolgs ist die Einrichtung der legendären »Senatorstube« hoch oben im Schlegelturm, mit Blick weit über Bochum. Im Jahre 1966 wird mit 587.000 Hektoliter der größte Brauausstoß erreicht; die AG beschäftigt in Bochum und Recklinghausen, wo das »Vest Pils« gebraut wird, insgesamt 763 Mitarbeiter.
Dann kommt der Abstieg. Die brauhistorischen Fakten, nüchtern aufgereiht, lauten folgendermaßen: Anfang der siebziger Jahre werden zunächst die Schlegel-Scharpenseel-Brauerei AG und die Dortmunder Union-Brauerei AG miteinander verschmolzen. Dann fusionieren die DUB-Gruppe und die Schultheiss-Brauerei-Gruppe miteinander. Am 11. Dezember 1979 wird vom Aufsichtsrat der Dortmunder Union-Schultheiss Brauerei AG beschlossen, den Bochumer Hauptbetrieb der Schlegel-Brauerei stillzulegen. Nachdem schon ein paar Jahre zuvor der Braubetrieb in Recklinghausen geschlossen worden ist, wird im Juni 1980 auch derjenige in Bochum eingestellt. Nur wenige Jahre danach beginnt der Abriss.
Ich blicke auf das, was damals stehen geblieben ist. Oben am Turm sind die bekannten Schlegel-Hämmerchen entfernt und vor zwanzig Jahren durch das Bochumer Stadtwappen ersetzt worden. Statt der Küfer-Hämmerchen nun also das Buch. Wenn man auf die große Tafel neben der Eingangstür guckt, weiß man, warum. Die Stadt hat das hohe Haus in Beschlag genommen, ist wohl auch die Besitzerin. Das Schulverwaltungsamt residiert hier und auch das Schulamt für die Stadt Bochum. Um Gottes willen! Wo ist der Unterschied? Besucher sind nicht zu sehen. Vielleicht sind auch nur noch die Schilder da, während die Ämter längst ausgezogen sind? Potemkinsche Ämter? Die Gleichstellungsstelle – was für eine unglückselige Wortbildung – und das Integrationsbüro, auch das Ordnungsamt, das Presse- und Informationsamt und noch viel mehr. Alles im alten Malzsilo.
Zwei städtisch uniformierte Herren, die aussehen, als wüssten sie, wo sie sind, nehmen mich mit ins Gebäude. Einer wählt den Fahrstuhl, der andere begleitet mich über die Treppe auf die nächste Etage. Er zeigt mir die Übergänge zum Nachbarhaus, also zu dem, was einmal das Sudhaus, einst Herz der Brauerei, gewesen ist. Hinter der Durchgangstür muss irgendwo das Fundbüro sein – habe ich auch nicht gewusst. Bevor er mich allein weiterwandern lässt, fragt er mich noch, halb im Vertrauen, ob ich denn überhaupt wisse, dass dies alles spätestens 2014 abgerissen werden soll? Wieso abgerissen? Wenn das Gerichtsgebäude fällt, sagt er, dann soll auch dies hier fallen. Eine neue Einkaufsmeile, mit vielen Geschäften, mehr oder weniger Einzelhandel, Boutiquen, durchaus höherwertig – so sei es geplant.
Ich bin perplex. So etwas darf man doch nicht abreißen! Nicht hier bei uns in Bochum, wo die paar mehr oder weniger historischen Gebäude, die uns geblieben sind, an zwei Händen abzuzählen sind! Außerdem ist der Turm tatsächlich so etwas wie eine Landmarke, gibt der Bochumer Mitte ein Gesicht.
Wie es der Zufall will, habe ich am selben Abend Gelegenheit, Frau Dr. Ottilie Scholz, die Oberbürgermeisterin der Stadt Bochum, die in der »Herrengesellschaft Kanone« einen Vortrag hält, zu fragen, ob an den kolportierten Plänen etwas dran sei. Sie weiß es – glaubwürdig – nicht, nimmt auch nicht an, dass es so sei. Das Postgebäude, ja, das könnte sein. Aber nicht Schlegel. Schließlich habe sie erst kürzlich veranlasst, dass abends das Wappen am Turm angestrahlt werde. Aber sie will noch einmal nachfragen, will sich drum kümmern, lässt sich meine Karte geben.
Eigentlich ist die Arbeit getan – bis auf eine Kleinigkeit. Klaus-Joachim Schlegel hatte mir bei unserer ersten Begegnung erzählt, dass Mitte der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ein Tunnel gebaut worden sei, der die Werksgelände dies- und jenseits des Westrings miteinander verband. Wie – ein Tunnel? Ich war sofort elektrisiert von der Annahme, dass man da unter Umständen noch einmal reingehen oder vielleicht auch trotz lädierter Bandscheibe reinkriechen könnte. Der Tunnel soll sieben Meter unter dem Westring gelegen haben und sei begehbar gewesen. Er sei bergmännisch vorgetrieben worden, heißt es. Davon müsste doch noch etwas zu sehen sein, vielleicht ein Loch mit einer Platte drauf oder eine Treppe, die vor eine Wand läuft. Herr Schlegel hat Menschen, die sich auskennen, befragt, und – er hat inzwischen etwas herausgekriegt.
Freitagmittag. Ich hole Klaus-Joachim Schlegel in der Uhlandstraße ab. Wir haben Glück, können sogar ganz in der Nähe unseres Ziels auf dem Westring parken, überqueren zu Fuß die Alleestraße. Vor dem Gebäude Westring 23 werfen wir einen Blick auf das große Schild einer Anwaltskanzlei. Einer der Anwälte heißt Michael Emde. Herr Schlegel hat mit ihm telefoniert, und Herr Emde hat uns erlaubt, dass wir mal in seinen Keller blicken dürfen. Er selbst wird allerdings nicht da sein, vielleicht ist er zu Tisch oder schon im wohlverdienten Wochenende. Als wir die Anwaltskanzlei betreten, werden wir gleichwohl erwartet; eine vorgewarnte Sekretärin geleitet uns zu einer Treppe aus Lichtgitterrost, die wir tief hinuntersteigen. Sieben Meter – ja, das könnte schon sein. Unten lagern tausende von Akten, eng in Regalen gestapelt. Um sich hier zurechtzufinden, dürfte man einen Kompass brauchen. Aber ich denke, die meisten der hier abgelegten Ordner wird wahrscheinlich nie wieder jemand hervorholen.
Wir sehen uns um und finden auch etwas. Auf dem Betonboden entdecken wir Spuren, die irgendwie auf die Träger von Förderbändern schließen lassen, die natürlich längst entfernt worden sind. Hier oder bis hierher könnten tatsächlich Bierkästen zur Verladerampe transportiert worden sein. Zur gegenüberliegenden Seite, also zum Westring hin, befindet sich eine Stahltür, die allerdings einen sehr verschlossenen Eindruck macht. Was dahinter ist, weiß niemand mehr. Herr Schlegel und ich sind uns sicher: Es ist der alte Verbindungstunnel.
Postskriptum: Es gibt ja doch noch ein Schlegelbier. »Schlegel Urtyp« heißt es und ist irgendwie ein Nostalgiebier, vor zehn Jahren ins Leben gerufen von zwei Schlegel-Freunden, die sich mit dem endgültigen Verlust ihrer Marke nicht abfinden wollten. Man bekommt es auch in Bochumer Getränkemärkten. Aber mit Bochum als Brauort hat es nichts mehr zu tun, selbst wenn die Rezeptur, was wir mal hoffen wollen, immer noch die alte ist. Übrigens war »Schlegel Urtyp« in den guten alten Zeiten von dem Verdikt, nach übermäßigem Genuss von Schlegelbier würden die heraldischen Hämmerchen des Hauses im Schädel des Genießers für den unvermeidlichen Kater sorgen, stets ausgenommen. Vielleicht eignet diese Qualität auch dem Nostalgie-Schlegel. Gebraut wird es, wie gesagt, nicht in Bochum, sondern seit seiner Wiederbelebung zunächst in Schwelm, heute in Iserlohn, wenn ich richtig informiert bin.
Ach, noch eins, ganz zum Schluss: Frau Oberbürgermeisterin wollte sich doch eigentlich melden, den angedrohten Abriss der Schlegelreste betreffend. Das hat sie bisher noch nicht getan und auch nicht tun lassen. Was soll man dazu sagen? Jammern nützt nichts, denn so eine Oberbürgermeisterin hat wirklich anderes zu tun.
[2012]