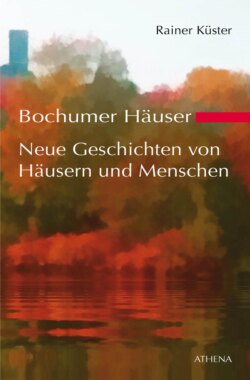Читать книгу Bochumer Häuser - Neue Geschichten von Häusern und Menschen - Rainer Küster - Страница 6
Im Kinderland der Kohlengräber
ОглавлениеDiese Bochumer Straße ist noch immer ein Mythos, zumindest ein bescheidener. Sie wird es bleiben trotz mancher Umbenennungen, die auch Gutwillige zum Verzweifeln bringen können. Wenn am Samstag, dem 20. Oktober 2007, wieder Dreißigtausend, davon die meisten in banger Hoffnung, zum Spiel gegen die Bayern aus München ins Rewirpower-Stadion pilgern werden, dann liegt dieses stilistische Monstrum nach wie vor an der Castroper Straße. Das ist die Straße, nach der das Stadion einst benannt wurde, lange bevor es zum Ruhr-Stadion mutierte, und auf der nach dem Abpfiff eine zähe Autoschlange in beide Richtungen kriechen wird. Wenn man Glück hat, regeln ein paar Polizisten den Verkehrsfluss; Fußgänger, die sich zwischen den Autos hindurchquetschen wollen, leben an solchen Tagen gefährlich, riskieren alles Mögliche – je nach Ausgang des Spiels mit oder ohne Bierflasche in der Hand.
Fast unmerklich steigt die Straße stadtauswärts an. Das Nahziel ist die große Kreuzung von Harpener und Castroper Hellweg, wo sich die Ströme der Heimkehrer zum ersten Mal verästeln; auf dem Sheffield-Ring, der guten alten NS 7, können die Fußballfreunde aus dem Bochumer Süden bald wieder richtig aufs Gas treten. Aber noch sind wir nicht dort, so schnell geht das nach einem Spiel gegen die Bayern nicht. Wer angesichts des mühsamen Flusses der Kolonne aus dem Fenster sieht, gewahrt einen Ruhrpott, wie er im Buche steht. Rechts Häuserreihen, die schon bessere Tage gesehen haben, dahinter mehr oder weniger Industrielles, nicht unbedingt einladend. Links kann man durchaus wohnen, einkaufen, zur Schule oder in die Kirche gehen.
Genau dort, wo es für den Fußballfreund manchmal schon ein bisschen schneller vorwärtsgeht, steht ein bescheidenes, eher unscheinbares Haus mit der Nummer 233, gleich neben der Schule, nämlich da, wo von der Castroper Straße links die Wichernstraße abzweigt. Zwei Betonpfeiler blockieren von diesem Ende der Straße her die Einfahrt für Autofahrer. Am anderen Ende mündet sie in die Josephinenstraße. Von dort sind Autos willkommen. Die Straße ist benannt nach dem Hamburger Theologen Johann Hinrich Wichern, der damals, im einschlägigen Jahr 1848, auf dem Evangelischen Kirchentag in Wittenberg, nicht etwa den VfL Bochum, sondern die segensreiche Organisation der »Inneren Mission« gründete. Aber das hat mit dem Haus, von dem ich erzählen will, wirklich nichts zu tun. Man kann leicht daran vorbeifahren, ohne es wahrgenommen zu haben. Unscheinbar ist es auch deshalb, weil es vielen anderen Wohnhäusern in der unmittelbaren Umgebung und sonst im Revier so ähnlich ist, trotz mannigfaltiger Umbauten, die es immer wieder über sich hat ergehen lassen.
Im Frühjahr habe ich mir das Haus schon einmal angesehen, das sich aus zwei einigermaßen symmetrischen Hälften zusammensetzt. Hellgrau ist der Putz auf der linken, grau in grau auf der rechten Seite. Hier und da sind die Rollläden heruntergelassen. Mit Gardinen geschmückte Fenster an den Kopfenden signalisieren, dass es über der ersten Etage jeweils noch ein bewohnbares Dachgeschoss gibt. Zentral dem Doppelhaus vorgelagert ist ein kleiner, durch ein Satteldach geschützter Windfang, an dem die beiden Hälften des Hauses partizipieren und der sicherlich erst nach dem Kriege angelegt wurde. Zumindest auf der rechten Seite dient der Windfang als Eingangsportal. Eine blaue Plastikbank lehnt an seiner Wand und bringt etwas Farbe ins Bild.
Zwischen Haus und Straße liegt ein gar nicht so kleiner Vorgarten, der auch Platz für die Mülltonnen bietet. Das Grundstück umschließt das Gebäude auf beiden Seiten; zur Wichernstraße hin lehnt sich ein Schuppen an, der so aussieht, als habe man ihn irgendwann einmal vergessen. Eine triste Steinmauer mit aufgesetztem Stacheldraht schützt das Areal vor manchen Unbilden, die entnervte Fußballfreunde der Castroper Straße zugemutet haben. Drei große Reklametafeln flankieren das Ensemble.
In diesem Haus hat der Bergmannssohn Heinz Esken (eigentlich Heinrich), der am Karfreitag im Jahre 1930 geboren wurde, die Kindheit verbracht. Heute lebt er in der Bochumer Constantinstraße und dokumentiert in mächtigen Aktenordnern sein Leben, das in vieler Hinsicht seine Besonderheiten aufweist, das aber zugleich auch exemplarisch ist. Gewissenhaft schreibt er auf, wie es ihm, dem Bochumer Jungen, in bald achtzig Jahren ergangen ist, wie der Lebensweg, privat und beruflich, durch die jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse geprägt wurde, fügt Bilder und vielfältige Dokumente hinzu, so dass eine Vita rekonstruiert und wieder belebt wird, die so wohl nur im Ruhrgebiet, im Kohlengräberland, wie es der Dichter Heinrich Kämpchen genannt hat, verlaufen konnte. Vor einem halben Jahr hat auch die WAZ unter dem Titel »Als ›Knochen-Karl‹ zurückkam« über Esken berichtet. Er hofft natürlich, dass seine beiden Töchter irgendwann die Zeit finden, einen Blick in die Ordner zu werfen. Vielleicht interessiert sich auch das »Institut für soziale Bewegungen« an der Ruhr-Universität für Eskens Sammlung.
Für unseren Weg in die Vergangenheit wählen wir einen normalen und glücklicherweise sonnigen Oktobertag, nicht den zwanzigsten, an dem die Bayern kommen. Das geht auch gar nicht, sonst würde im Block L ein kostbarer Platz frei bleiben. Und kampflos geben wir die Sache sowieso nicht her, denn sogar gegen die großen Bayern fängt ein Spiel zunächst einmal bei 0 : 0 an.
Wir parken auf der Wichernstraße, gleich neben der Schulhofmauer. Fast hätten wir den Fotoapparat vergessen. Linker Hand liegt die Grundschule »In der Vöde«, auf deren Gelände sich ein paar Skater vergnügen. Hinter der Schule, aus ähnlich rotem Backstein errichtet, erhebt sich die katholische »Heilig-Kreuz-Kirche«, seit 2002 degradiert zur Filialkirche der Grummer Liborius-Gemeinde. Heinz Esken erzählt im Vorbeigehen die Geschichte von den Schweinen, die ausgebrochen waren und an die Tür des Pfarrers klopften. Aber davon wird später die Rede sein. Wir wollen vorn anfangen.
Für Heinz Esken ist es schon mit merkwürdigen Erinnerungen verbunden, das Haus seiner Kindheit jetzt wiederzusehen, da zu stehen und zu fotografieren. Gemischte Gefühle kommen auf, Wehmut und auch ein bisschen Skepsis. Wenn er in der Gegend war, hat er das Haus zwar immer wieder flüchtig wahrgenommen, aber seltsamerweise nie mehr so richtig beachtet. Von 1930 bis 1943 oder vielleicht auch 1944 hat er, hat seine Familie hier gelebt. Der Vater war 1942 tödlich verunglückt, und dann ist die Mutter zur Oma gezogen, in die Schmechtingstraße.
Ob das nun Ende 1943 oder Anfang 1944 geschah, weiß Esken deshalb nicht so genau, weil er da gerade in Pommern in der Kinderlandverschickung war, und zwar in Treptow an der Rega. Heute ist das noch weiter weg als damals; jetzt heißt der Ort Trzebiatów und ist eine polnische Stadt, die in der Woiwodschaft Westpommern liegt. Als der Junge im Jahre 1944 aus Treptow zurückkam, da wohnte die Mutter jedenfalls auf der Schmechtingstraße, was schon deshalb keine Verschlechterung bedeutete, weil die Familie dort eine richtige Etagentoilette hatte mit einem Zugband dran. Man brauchte also nicht mehr aufs Plumpsklo im Hof wie an der Castroper Straße. Aber zu dieser Zeit lag die Kindheit längst hinter ihm. Im Krieg wurden die Kinder aus dem Ruhrgebiet früh erwachsen.
Zurück zum Haus an der Castroper Straße. Hierher waren die Eltern erst gezogen, als der Nachwuchs sich ankündigte. Eine Hausgeburt sollte es werden, das war damals nichts Ungewöhnliches. Heinz Esken erzählt:
Meine Eltern haben sich 1929 verlobt und kurz darauf geheiratet. Zuerst wohnten sie für ein paar Monate auf der 2. Parallelstraße, also da, wo du immer dein Auto parkst, wenn du zum Stadion fährst. Und als ich dann unterwegs war, da bekam der Vater von der Zeche diese größere Wohnung auf der Castroper Straße. Vier Familien lebten in den beiden Haushälften, jeweils unten und oben eine Familie. Ich hab hier einen Zettel mit den Namen, die habe ich zu Hause aufgeschrieben.
Wir stehen inzwischen auf der anderen Seite der Castroper Straße, mit Blick auf die Vorderfront des Hauses, den Windfang im Auge. Hinter uns das Haus mit der Nummer 234a, in dem früher ein Schreibwarengeschäft war, wo Heinz die Hefte für die Schule besorgte und der Vater auch seine Zigaretten kaufen konnte. Die Graffiti an der Hauswand sind jüngeren Datums.
Für kurze Zeit versperrt uns die Straßenbahn, die 318, den Blick. Eine Straßenbahn gab es früher auch schon, die war aber deutlich kleiner und erheblich langsamer, manchmal musste man aussteigen, wenn sie zu voll war und den leichten Anstieg stadtauswärts nicht schaffte. Die Fahrt zur Oma in der Schmechtingstraße kostete 10 Pfennig. Heinz Esken erzählt, dass er und sein Freund Heinz Brandau, der um die Ecke wohnte, gern Nägel auf die Schienen legten, bevor die Bahn kam. Wenn die Räder die Nägel plattgefahren hatten, sahen die aus wie türkische Säbel.
Jetzt ist der Blick wieder frei, und Heinz Esken zeigt mir zunächst auf seinem Zettel, dann auch am Objekt selbst die Lage der Wohnungen und die verschiedenen Gebäudeteile. Im milden Herbstlicht sieht das Haus heute schöner aus als bei meinem ersten Besuch im Frühjahr. Esken findet sich schnell zurecht. Irgendwie ist alles noch da, so wie vor siebzig Jahren, sogar der Stall auf dem Nachbargrundstück. Er erklärt:
Also im linken Haus, da wohnte oben die Familie Hornberg. Die hatten eine Tochter, das war die Elisabeth Hornberg, genannt Elli; sie war älter als ich. Sie ist übrigens die Mutter von dem jetzigen VfL-Präsidenten. Unten links wohnte das Ehepaar Goldmann mit einem Jungen. Der war viel jünger als ich, deshalb hatte man wenig Kontakt. Und dann wir, Esken, wir wohnten unten rechts. Über uns die Familie Vierhok, die hatten drei Kinder. Mit dem ältesten Sohn von Vierhok war ich im selben Alter. Wir waren Freunde, haben gespielt, eigentlich alles zusammen gemacht. Insgesamt müssen acht Erwachsene und sechs Kinder in dem Haus gelebt haben.
Heinz Esken beschreibt Lage und Größe der Räume in der elterlichen Wohnung. Das waren drei Zimmer, die Miete betrug 12 Reichsmark. Wohn- und Schlafzimmer waren fast quadratisch, vielleicht 4 × 4 Meter; die Küche kleiner, schmaler, wie auch der Eingang, von dem aus man nach oben oder in den Keller gelangte. Die reine Wohnfläche schätzt er auf 45 Quadratmeter. Allerdings war da noch die Bodenkammer, denn zu jeder Wohnung gehörte ein Zimmer ganz oben unter dem Dach. Das diente als Lagerraum, hatte ein ähnliches Grundmaß wie das Wohnzimmer, nur eben mit Schrägen. In dieser Kammer hingen bei Eskens die Schweinewürste von der letzten Schlachtung. Am Sonntag, wenn die Mutter in der Kirche war, stieg der Vater mit dem Jungen rauf, um sich außer der Reihe ein Stück vom Schinken abzuschneiden. Die Mutter durfte das nicht merken; Vater und Sohn gingen gleich mit dem Messer an das Geräucherte, sie brauchten kein Brot dazu.
Die Dachgeschosszimmer in den Bergmannssiedlungen, das waren praktisch die Zimmer für die Kostgänger. Aber in der Castroper Straße 233 gab es keine Kostgänger, jedenfalls nicht in den frühen dreißiger Jahren. Da herrschte auch im Ruhrgebiet die große Arbeitslosigkeit, so dass Arbeitskräfte kaum nachgezogen wurden. Auch Vater Esken, der bei der Harpener Bergbau-AG auf der Zeche Robert Müser als Hauer beschäftigt war, wurde für kurze Zeit entlassen. Zwischenzeitlich erhielt er Arbeit auf der Zeche Constantin, Schacht 3, nicht weit von der Wohnung entfernt, dort, wo heute der Turm der Telekom steht, gegenüber dem Stadion. Später konnte er in Bochum-Werne auf der Zeche Amalia wieder für die Harpener Bergbau-AG arbeiten, also für die Gesellschaft, der auch die Bergmannskolonie an der Castroper Straße gehörte.
Heinrich, so hieß der Vater, so nannte er auch den Sohn. An sechs Tagen fuhr er mit dem Fahrrad zur Arbeit. Unter der Woche rauchte er nach dem Dienst seine Pfeife; sonntags gönnte er sich drei Zigaretten, immer die grüne Dreierpackung der Firma Eckstein. Wenn er rauchte, saß er auf einem Stuhl neben dem Küchenofen.
Er war ein lustiger Mann. Manchmal wurde bei Eskens gefeiert, dann drängte man ihn, den berüchtigten »einarmigen Geiger« zu spielen. Er besorgte sich einen Krückstock, der als Violine diente, und ein kleineres Stöckchen, das war der Geigenbogen. Allerdings musste die Sache gründlich vorbereitet werden. Im Hausflur präparierte der Vater seinen Auftritt. Den linken Arm steckte er in die Hose und schob den Krückstock so durch den freien Ärmel der Jacke, dass er in Geigenstellung sehr schön hoch stand.
Nun betrat er das Wohnzimmer und forderte die Anwesenden auf, ihm, dem einarmigen Geiger, alles nachzusingen. Er strich die »Geige« mit dem »Geigenbogen« und sang Goethes »Heideröslein«. Beim ersten Mal noch Zeile für Zeile, »Sah ein Knab’ ein Röslein stehn …«, und so weiter, alles wurde von den lernwilligen Zuschauern mit Inbrunst repetiert. Dann steuerte die Vorstellung auf ihren Höhepunkt zu. Da das Publikum inzwischen textsicher war, konnte man die Ballade noch einmal gemeinsam singen. Jetzt kam endlich der versteckte Arm zur Geltung. Der Vater fuhr den Mittelfinger aus dem Hosenschlitz, klemmte damit den »Geigenbogen« ein und betätigte sich gleichzeitig mit der rechten Hand als Dirigent. Heinz Esken sagt, das sei der Moment gewesen, auf den besonders die Frauen, die das Schauspiel schon kannten, gewartet hatten. Sie kreischten aufgeregt. Und manch eine von denen, die den einarmigen Geiger noch nicht kennengelernt hatten, mag zunächst nicht gemerkt haben, dass es nur der Mittelfinger war, der da ausgefahren wurde und den Geigenbogen hielt.
Einmal in der richtigen Stimmung hielt der Vater auch noch eine Sonntagspredigt. Er zog seine Jacke verkehrt herum an, setzte ein Taschentuch als Latz auf die Brust und mimte derart kostümiert einen evangelischen Pastor. Wieder wurde ein Wechselgesang zelebriert, Zeile für Zeile, diesmal mit klerikalem Pathos:
Pastor sine Husölschke
Hätt Sundags nummedags
Von vier bis fünf Utgang
Mit dem Paraplüie
Halleluja
Zum Schluss machte der Vater noch einen Handstand. Dabei, sagt der Sohn, sei ihm einmal ein Fünfmarkstück aus der Westentasche gefallen. »Den Heiermann hatte er wohl beim Restlohn plattgemacht.« Die Mutter hob das Geldstück auf und rief: »Heinrich, du betrügst mich!«
Solche Feiern fanden im Wohnzimmer statt, das für entsprechende Gelegenheiten und für Familienfeste reserviert war, das nur benutzt wurde, wenn Besuch kam. Zum Inventar dieses Zimmers gehörten der Dauerbrenner-Ofen, eine Couch, ein Tisch, zwei Sessel und eine Blumenbank. Dann war da noch ein kleiner Schrank, der eigentlich in die Küche gehörte, dort aber keinen Platz mehr fand. Oben im Schrank hatte der Vater den Bergmannsschnaps, seinen »Klaren mit Speck« – in Bochum Schweinchen genannt – deponiert, von dem die Ehefrau jedes Mal nach der Schicht ein Gläschen für ihn bereithielt. Daneben lagen die Tabakwaren. Unten im Schrank wurde das Spielzeug des Jungen aufbewahrt. Das beste Stück war die Eisenbahn, die man aufziehen konnte. Normalerweise waren Couch und Sessel im Wohnzimmer mit Schonbezügen abgedeckt. Das wollte die Mutter, und bei den anderen Familien in der Kolonie war es genauso.
Das Familienleben spielte sich in der Küche ab. Da war’s gemütlicher als in der kalten Pracht des Wohnzimmers. Es gab den Kohlenherd, den großen Küchenschrank, auf dem der Volksempfänger stand, der im Krieg immer so tolle Erfolgsmeldungen von der Front verkündete. Außerdem ein Sofa, Tisch und Stühle. Heinz Esken hat einen kleinen Lageplan mitgebracht:
Hier war die Hauptfeuerstelle und da rechts der Backofen oder der Aufsatz, in dem es immer heißes Wasser gab. Und hier war der Rauchabzug, gleichermaßen vom Wohnzimmerofen, das war so eine Art Dauerbrandofen im Wohnzimmer – ja, hier saß der Vatter nach der Arbeit und wärmte sich, das hab ich noch in Erinnerung, die Füße angezogen. Mein Platz war auf dem Sofa, das war ein Ledersofa, war nicht so bequem, ich mag auch heute noch kein Leder. Ich weiß nicht, was das für ’ne Lederart war, da klebte man richtig dran fest.
Eine Waschküche gab’s nicht. In der Küche musste auch die Wäsche gemacht werden. Und das ging ja nur auf dem Waschbrett. Hier war der Spülstein, also ein Waschbecken im weitesten Sinne. Da bin ich als Baby reingesteckt worden. Und dann war da ja der Stöpsel, man machte ihn auf, dann lief das Wasser frei nach draußen in die Gosse. Bei der großen Wäsche durchsuchte die Mutter regelmäßig das Arbeitszeug des Vaters, seinen Püngel, um herauszukriegen, ob er etwa auf der Arbeit einen Priem genommen hatte.
Das Schlafzimmer war genauso groß wie das Wohnzimmer, also auch 4 × 4 Meter. Das Ehebett und die Schränke waren aus Eiche und auf Abzahlung gekauft. Hier schlief die ganze Familie, denn im Raum befand sich auch ein großes Kinderbett.
Im Keller lag die Deputatkohle, in den Regalen standen die Gläser mit dem Eingemachten. Strom und Wasser gab es schon im Haus. Das Abwasser lief durch ein Rohr von der Küche in eine Wasserrinne hinter dem Haus. Von dort führte die Rinne um das Gebäude herum bis hin zur Gosse an der Castroper Straße, die war kanalisiert. Direkt neben dem Haus befand sich der Doppelstall mit dem Plumpsklo für jede Familie. Das Klo bestand aus einer runden Holzklappe mit einem Holzgriff, an der Wand hing das Zeitungspapier. Für das kleine Geschäft ging man nachts nicht nach draußen, da hatte man seine Hilfsmittel. Aber wer ein großes Bedürfnis hatte, der musste raus, bei jedem Wetter ums Haus herum. Neben dem Plumpsklo wohnten die Schweine, ein paar Kaninchen und Hühner. Die Mistkuhle war nach beiden Seiten offen, gewissermaßen zu Mensch und Tier; der Inhalt mischte sich harmonisch und wurde naturnah verarbeitet, und zwar auf dem Acker im Grabeland hinter dem Grundstück, dort, wo die Kartoffeln für die Schweine angebaut wurden. Der Kreislauf war gesichert.
»Hat es nicht eine Menge Abfall gegeben, wenn Schweine da waren? Was habt ihr damit gemacht?«, will ich wissen. Heinz Esken sagt:
Was wir an Abfall hatten, das wurde in dem großen Küchenofen verbrannt. Da blieb also nichts über. Die Kartoffelschalen kamen in den Schweinetrog und wurden verfüttert. Die Kartoffeln wurden ja extra gezüchtet, die Schweine kriegten sogar gekochte Kartoffeln und eben Essensreste. Die waren bestens im Fleisch. Da blieb dann nur noch die Asche übrig. Und dafür wurde gesorgt, denn einmal im Monat kam eine zweirädrige Pferdekarre von der Zeche, die die Asche abholte.
»Wie kam es, dass eines Tages die Schweine ausbrechen konnten?«
Hier [Heinz Esken zeigt auf den Plan] war der Stall offen, da war der Sitz, und genau hier war der Schweinetrog. Da gab es eine Klappe, so dass man den Mist von den Schweinen rausschmeißen konnte. In der Mistkuhle wurden zwei, drei Bretter abgedeckt, aufgenommen, und dann konnte hier der Schweinemist entsorgt werden. Und diese Klappe hatte eine Kette, die ist dann eines Tages ab gewesen. Da sind die Schweine ausgebrochen, bei uns raus, die Castroper Straße entlang, an der Schule vorbei und dann wieder in den nächsten Eingang rein, da ist ja die Kirche – und plötzlich waren sie beim Pastor auf dem Hof. Das passierte auch noch an einem Sonntagmorgen. Ein Nachbar hat bei uns geklingelt, hat gesagt, dass unsere Schweine auf dem Kirchplatz herumlaufen.
Vor dem Haus lag der Gemüsegarten. Hier wurde im Zirkel des Jahres angebaut, was man für den Haushalt brauchte. Aber spielen durften die Kinder nicht im Garten, sondern sie gingen auf die Castroper Straße; so hieß damals auch noch der Teil der Kolonie, der seit 1953 Wichernstraße genannt wird.
Die war mitten in der Kolonie, die Straße. Das war ja eine reine Aschenstraße, da haben wir natürlich auch Fußball gespielt. Aber wir hatten keinen richtigen Ball, sondern irgendwas Zusammengebasteltes aus Stoff; das Ding war zwar weich, flog aber nicht weit, Gott sei Dank. Man durfte ja auch nicht hinfallen. Wenn es doch passierte, dann führte das zu bösen Verletzungen.
Für drei Jungen, Heinz Esken, Paul Vierhok und Heinz Brandau, die in der Kolonie eine verschworene Gemeinschaft bildeten, gab es noch andere Spielplätze. Das Grabeland reichte etwa bis zum Fußgängertunnel, der heute unter dem Ruhrschnellweg hindurch von der Matthias-Claudius-Straße zur Josephinenstraße führt. Da hatte jeder sein Stückchen, da war nichts eingezäunt, sondern die Bergleute aus der Kolonie bauten alle ihre Kartoffeln an und manchmal auch ein paar Bohnen. Dahin wurde auch das, was sich in der Aalkuhle angesammelt hatte, transportiert. Irgendeiner der Nachbarn hatte eine Karre mit einem runden Behälter drauf; in diesen Behälter wurde der ganze Schlamassel hineingeschöpft, dann die Straße entlang geschoben und auf dem Acker verteilt. Aber für die drei Jungen war wichtig, was jenseits lag, denn hinter dem Grabeland gab es ein wildes Feld, und mitten auf dem Feld stand eine Ziegelei, umgeben von Lehmbergen, die dort abgebaut wurden. Das war eine Spielecke, von der die Kinder glaubten, dass sie in die Zeit passte. Wo man sich in den Lehmbergen vergraben, sich vor dem Feind verbarrikadieren, Unterstände bauen konnte.
Damals war das ja bei Jungen so üblich. So wurden wir auch erzogen. Wir haben da alle ein bisschen Krieg gespielt, im Dritten Reich.
Ernster wurde die Sache schon beim Jungvolk. In der NS-Zeit wurden Jungen und Mädchen vom neunten oder zehnten Lebensjahr an uniformiert. Das machte anfangs sogar Spaß. Exerzieren und sportliche Übungen waren an der Tagesordnung. Die Aufmärsche und Versammlungen fanden nebenan auf dem Schulhof statt, wo sich auch die Hitlerjugend traf. Heinz Esken war beim Jungvolk zum Jungenschaftsführer ernannt worden, trug eine rot-weiße Kordel und durfte eine kleinere Gruppe kommandieren. Da er von einem Nachbarjungen gelernt hatte, mit dem Kleinkalibergewehr zu schießen, bewies er auch beim Jungvolk in dieser Sparte eine große Treffsicherheit. Er wurde gefördert und errang als erster Pimpf in Bochum das »Jungvolk-Schießabzeichen«. Heinz war stolz, denn die Zeremonie, in der ihm die Nadel mit dem Abzeichen an die Brust gesteckt wurde, fand auf dem Sportplatz an der Castroper Straße statt, und der gesamte Bann Bochum mit Jungvolk und Hitlerjugend war angetreten.
»Die Schule, zu der du gegangen bist, war die nebenan? Dieselbe, auf der ihr auch exerzieren musstet?«
Nein, erst als die Zusammenlegung kam, als die Konfessionsschulen wegfielen. Wir waren katholisch, und ich besuchte zunächst die Schule an der Ecke Rottmannstraße/Ruhrschnellweg. Das ist etwa da, wo heute die Hauptschule am Lenneplatz steht. Woran ich mich erinnere, ist, dass zwischen Lenneplatz und Ruhrschnellweg eine Müllkippe war. Da wurde gekippt, und wir Schüler wurden direkt nebenan in einem alten, verkommenen Schulgebäude unterrichtet. Als i-Männchen saß ich in einer Doppelbaracke. Dahin sind wir am ersten Tag noch von den Müttern begleitet worden. Und dann hieß es nur noch: ›Lauf mal!‹ Da war ja noch nicht so viel Verkehr auf dem Ruhrschnellweg, der war damals noch dreispurig. Jede Fahrtrichtung eine Spur, und auf der mittleren Spur konnte man von beiden Seiten aus überholen.
»Und da musstest du rüber, über den Ruhrschnellweg?«
Ja, sicher. Ich bin also die Castroper Straße ein Stück raufgegangen, und dann in die Rottmannstraße rein, wo heute noch der Friseur Ungetüm ist – das ist immer noch derselbe Name, wo mir immer ein Kurzhaarschnitt verpasst wurde, mit schrägem Scheitel natürlich – und dann über den Ruhrschnellweg. Das war mein Schulweg.
Heute ist diese Schule samt angrenzender Müllkippe vom Erdboden verschwunden. Der ganze Bereich ist nach dem Kriege siedlungsmäßig bebaut worden, bis hinüber zum Gewerbegebiet. Im Jahre 1939 kam Heinz Esken dann auf die Schule neben seinem Elternhaus. Nach der Zusammenlegung gab es keine Konfessionsschulen mehr. Das war für ihn sehr bequem; er brauchte nur über die Straße zu laufen. Stolz war man, weil die Schule inzwischen auch einen Namen bekommen hatte. Bis dahin gab es viele namenlose Schulen. Nun hieß man plötzlich »Kaiser-Otto-Schule«.
Die Schulmauer war niedrig. Da konnte die Mutter dem Jungen jeden Morgen sein Bütterken rüberbringen. Und weil er so ein schlechter Esser war, stand sie an der Mauer und rief: »Junge, iss doch!«, aber er kriegte nichts runter. Geleitet wurde die Schule vom Rektor Aufderheide, einem strengen Mann, der auch den elfjährigen Heinz Esken unterrichtete. Der Rektor besaß einen kleinen Stock, der ihm zu pädagogischen Zwecken diente, denn je nach Maßgabe der Unbotmäßigkeit verpasste er damit seinen Zöglingen entsprechende Schläge in die Hände. Heinz bekam den Stock zu spüren, als er einen Nachbarn abschreiben ließ.
Spielen durfte man nicht auf dem Schulhof. Der Hausmeister sorgte dafür, dass dieser Ort der Hitlerjugend vorbehalten blieb. Und bald wurde ohnehin Ernst aus dem Spiel. Seit dem 1. September 1939 war Krieg. Das bekam man auch im Ruhrgebiet zu spüren. Zum ersten Mal wurde das Ruhrgebiet im Jahre 1940 von der britischen Luftwaffe bombardiert. Vom Mai 1941 an fielen auch in Bochum die Bomben, zunächst aber noch nicht an der Castroper Straße. Doch das war nur eine Frage der Zeit, und die Fliegerangriffe würden nicht mehr aufhören bis zum bitteren Ende. Vater Esken war als Bergmann vom Kriegsdienst freigestellt worden. Wer in kriegswichtiger Position (Bergleute, Stahlarbeiter, Bauern) tätig war, wurde bis zum Jahr 1943 nicht einberufen.
Auch der junge Heinz Esken machte seine Erfahrungen mit der neuen Situation. Einen Bruder des Vaters hatte es nach Ortelsburg in Ostpreußen verschlagen, heute heißt der Ort Szczytno und liegt im masurischen Seengebiet. Dieser Bruder war zum Kriegsdienst eingezogen worden und besuchte, wie es sich gehörte, in Uniform die Familie Esken in Bochum. Es war Sommer, die Familie ging im Stadtpark spazieren. Der Onkel hatte aufgrund der großen Hitze den obersten Knopf seiner Uniform geöffnet. Daraufhin wurde er von einem Offizier angeschnauzt, musste stramme Haltung annehmen und natürlich den Uniformknopf wieder schließen. Ein deutscher Soldat hatte sich ordentlich zu kleiden. Der Junge verstand nicht, was das sollte.
Der Onkel wurde später an der Ostfront eingesetzt, zuletzt vor Leningrad. Eines Tages wurde die Wohnung an der Castroper Straße gestürmt, vom Ortspolizisten, der sich zu diesem Zweck extra seinen Tschako aufgesetzt hatte, und von einigen Herren in Zivil. Man sperrte die Familie Esken in der Küche ein und durchsuchte die gesamte Wohnung, den Keller, das Dachgeschoss und schließlich auch noch den Stall, ohne dass etwas dabei herauskam. Den Grund nannte man der Familie erst am Schluss: Der Onkel war fahnenflüchtig. Später traf ein Brief des Onkels ein, seine letzten Zeilen. Man hatte ihn gefasst. Als der Brief in der Castroper Straße abgegeben wurde, hatte man den Onkel schon erschossen. Mutter Esken musste der Witwe einen Ariernachweis besorgen, damit sie, nun auf sich allein gestellt, Arbeit bekam.
Der Vater wurde nicht mehr eingezogen. Aber man kann in diesem Fall wohl nicht von Glück sprechen. Im April 1942 ereilte ihn das Schicksal unter Tage. Auslaufende Kohle, so hieß die lakonische Erklärung. Auf der Zeche Amalia. Seinem Jungen erklärte man später, der Vater sei von der abrutschenden Kohle eingeklemmt worden, so dass er sich nicht mehr habe retten, sich nicht mehr habe mitlaufend befreien können. Er war in der auslaufenden Kohle erstickt. Die Nachbarn hörten es eher als die Familie. Die heimkehrenden Kollegen wussten, Heinrich Esken war verschüttet. Ihnen war klar, was das bedeutete. Aber der Junge saß in der Küche der Bergmannswohnung und hoffte noch auf ein Wunder, betete. Aufgebahrt wurden die toten Bergleute damals auf der Zeche. Das war so üblich. Anschließend kam die Beerdigung in der Trauerhalle am Freigrafendamm. Das Bergmannsorchester spielte »Ich hatt’ einen Kameraden …«.
Das war das Ende der Kindheit für Heinz Esken, der eine Woche zuvor gerade zwölf Jahre alt geworden war. Der Krieg brachte für ihn gleich zweimal die Verschickung in eins der weit entfernten Kinderländer. Die alten Freunde aus der Kolonie mussten andere Reiseziele ansteuern. Man verlor sich aus den Augen. Von der Harpener Bergbau-AG wurde Mutter Esken als Witwe die Miete erhöht, die Deputatkohle wurde gekürzt. Die Rente war auch für zwei Personen viel zu gering. Man war jetzt arm. Als Heinz Esken aus der zweiten Kinderlandverschickung, aus Treptow an der Rega, nach Bochum zurückkehrte, war die Mutter schon zur Oma an die Schmechtingstraße gezogen. Die Wohnung in der Castroper Straße 233 hatte sie aufgelöst.
[2007]