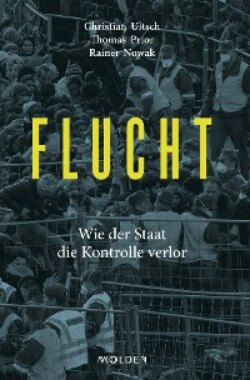Читать книгу Flucht - Rainer Nowak - Страница 10
„DAS KÖNNEN WIR
NICHT SCHAFFEN!“
ОглавлениеIn Deutschland sind die Flüchtlingsheime bereits zum Bersten voll. Angela Merkel hat noch kein einziges besucht. Sie hält sich raus. Die Medien geißeln sie dafür. Seit dem 15. Juli 2015 hat die deutsche Langzeitkanzlerin ein veritables Imageproblem. An diesem Tag führt sie ein Bürgerdialog namens „Gut leben in Deutschland“ in eine Schule nach Rostock. Ein Routinetermin: die Kanzlerin im beigen Blazer inmitten einer Runde von artigen Jugendlichen. Doch dann schildert Reem Sawihl, ein eloquentes 14-jähriges palästinensisches Flüchtlingsmädchen aus dem Libanon, dass sie und ihre Familie bald abgeschoben werden. Ihr Traum von einem Studium in Deutschland droht zu platzen. Nicht zu wissen, wie die Zukunft aussehe, sei bedrückend. „Es ist wirklich sehr unangenehm, zuzusehen, wie andere das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann.“ Merkel antwortet nett, aber klar. Das Verfahren dauere zu lange. Der Libanon sei kein Kriegsgebiet. „Wenn wir jetzt sagen: ‚Ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen, das können wir auch nicht schaffen.‘“ Reem bricht in Tränen aus. Das rührt die Kanzlerin. Sie geht auf das Mädchen zu und streichelt es. Und weil die Kanzlerin aus der Rolle fällt und niemand Trost durch Handauflegung spenden kann, wirkt sie, zusätzlich genervt von Bemerkungen des Moderators, irgendwie linkisch und unbeholfen. Das Video wird viral. Hämische Kommentare folgen. Merkel wird als gefühlskalt dargestellt. „Die Eiskönigin“ hatte der „Stern“ später getitelt und damit ihre Haltung in der Griechenlandkrise gemeint. Solche Bilder können sich schnell verfestigen. Das macht Merkel und ihre Berater nachdenklich.
Die Stimmung in Deutschland ist volatil in diesem Flüchtlingssommer 2015. Bundespräsident Joachim Gauck spricht von einem hellen und einem dunklen Deutschland, einem helfenden und einem geifernden. In Heidenau, einem kleinen Städtchen in Sachsen, protestiert rechtsextremer Pöbel tagelang mit Steinen, Flaschen und ausländerfeindlichen Parolen gegen 250 Asylwerber, die provisorisch in einem leer stehenden Baumarkt untergebracht werden sollen. Die Republik ist geschockt. Deutschland zeigt sein hässliches Gesicht. Merkel bietet den Radikalen die Stirn. Sie fährt nach Heidenau – und wird dort wüst beschimpft. Keine zwei Wochen werden sie und Deutschland die Gelegenheit haben, sich von einer anderen Seite zu zeigen, einer strahlenden, moralisch einwandfreien und menschenfreundlichen Seite.
Spätestens im August wendet Merkel ihre volle Aufmerksamkeit der Flüchtlingskrise zu. Diese Frage werde Europa noch sehr viel mehr beschäftigen als die griechische Schuldenkrise und die Stabilität des Euro, sagt die deutsche Kanzlerin Mitte des Monats öffentlich. Sie hat sich eine Strategie zurechtgelegt. Merkel will eine europäische Lösung. Unbedingt. Alternativlos. Mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vereinbart sie, die Hotspot-Idee auch auf Griechenland auszurollen und die Zahl der zu verteilenden Flüchtlinge auf 160 000 zu erhöhen. Das ist kühn. Denn bisher hat nicht einmal die im Mai präsentierte Miniversion des Modells auch nur annähernd funktioniert. Doch Merkel sieht keine andere Lösung. Am 9. September soll Juncker den Plan vorstellen. Und bis dahin will sie auch den renitenten Viktor Orbán bearbeiten. Immerhin 54 000 Flüchtlinge, mehr als ein Drittel der Gesamtzahl, sollen den Ungarn im Rahmen des Verteilungsmechanismus abgenommen werden. Das ist doch ein Angebot. Aber so viel Zeit bleibt nicht mehr. Denn die Ereignisse überschlagen sich. Und eine Kommunikationspanne erhöht das Tempo.
Ein Tweet setzt Massen in Bewegung
Am 25. August setzt das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine folgenreiche Kurznachricht ab: Dublin-Verfahren syrischer Staatsangehöriger werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von uns weitestgehend faktisch nicht verfolgt. Eine fatale kommunikative Fehlleistung. Der Vermerk ist eigentlich für interne Zwecke gedacht – eine Maßnahme zur Beschleunigung der Asylverfahren, um die deutschen Bundesländer zu entlasten. Aber irgendwie hat die Hilfsorganisation Pro Asyl über ein Leck Wind davon bekommen. Und nun bestätigt die unterbesetzte Pressestelle des BAMF auf Anfrage auch noch per Twitter. Dabei ist die Information keineswegs für die Öffentlichkeit bestimmt, schon gar nicht in der verkürzten Form von 127 Zeichen. Im deutschen Bundesinnenministerium ist man entsetzt. „Wir wurden überrascht und sind absolut nicht begeistert gewesen“, erinnert sich die für die Migration zuständige Staatssekretärin Emily Haber.
In Wien schlägt Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner die Hände über dem Kopf zusammen, als sie davon erfährt. „Ich halte das für einen schweren Fehler, damit werden die Schleusen geöffnet und falsche Hoffnungen geweckt“, sagt sie zu ihrem befreundeten deutschen Amtskollegen Thomas de Maizière. Doch der Tweet lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Er entwickelt ein Eigenleben, geht wie ein Lauffeuer um die Welt. Merkel erhält danach von Syrern Liebesbotschaften auf sozialen Medien. Die Flüchtlinge sind schnell informiert. Sie sind vernetzt, die meisten haben Handys. Egal, wo sie hinkommen, ihre erste Frage ist immer, wo sie ihre Geräte aufladen können. Jetzt sind auf einmal alle Syrer. Die Kurznachricht wird zur Waffe der Schleuser.
Das mächtige Deutschland ist nicht in der Lage, die Informationen zu steuern. Es passiert nicht zum ersten Mal. Als de Maizière am 19. August bekanntgibt, dass bis zum Ende des Jahres mit 800 000 Asylwerbern zu rechnen sei, kommt die Botschaft in Afghanistan ganz anders an. Deutschland nehme 800 000 Afghanen auf, heißt es dort schnell. Ganze Großfamilien beantragen nun Reisepässe und die afghanischen Behörden stellen sie bereitwillig aus. Es ist die Zeit, in der Trittbrettfahrer aufspringen und die Krise befeuern. Der Iran und Pakistan nützen die Gelegenheit, um afghanische Flüchtlinge loszuwerden. Die Türkei lässt Schlepper an ihrer Küste zu Griechenland gewähren. Und auch die Russen treiben ihr eigenes Spiel. Internationale Nachrichtendienste haben Hinweise darauf, dass Russland Äußerungen von Merkel auf irreführende Weise übersetzen und in Flüchtlingslagern Falschmeldungen streuen lässt: Ihr könnt alle kommen, Deutschland nimmt alle auf.
Bilder des Grauens
Am 27. August 2015 kommt Merkel nach Wien. In der Früh überreicht ihr Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich. Doch das ist nicht der Anlass ihres Besuchs. Sie nimmt am Westbalkan-Gipfel teil. Die Regierungschefs, Außenminister und Wirtschaftsminister Mazedoniens, Albaniens, Kosovos, Serbiens, Kroatiens, Montenegros und Sloweniens sind eingeladen. Der Rahmen in der Wiener Hofburg ist gediegen: zur Eröffnung Kammermusik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Ablauf ist bei solchen Veranstaltungen bis ins letzte Detail geplant und getaktet, die Abschlusserklärung längst ausbuchstabiert. Diesmal soll es nicht nur um EU-Beitrittsperspektiven, um Infrastrukturprojekte und Jugendaustausch gehen. Auf der Agenda steht auch das Thema Nummer eins: die Migration. Gastgeber Werner Faymann hat drei Botschaften in seiner Eröffnungsrede: Asyl sei ein Menschenrecht, eine verpflichtende Verteilung von Flüchtlingen unerlässlich und der Kampf gegen Schlepper vorrangig. Hinter den Kulissen will er gemeinsam mit Merkel Mazedonien drängen, seine Grenzen besser zu kontrollieren. Im Schlusscommuniqué wird dann lediglich von verstärkter Zusammenarbeit bei Grenzmanagement und Asyl die Rede sein.
Doch zu diesem Zeitpunkt hat längst ein anderes Ereignis den Gipfel überschattet. Kurz nach 13 Uhr macht Faymann die deutsche Regierungschefin auf eine Eilmeldung aus seinem Kanzleramt aufmerksam. Er zeigt ihr die Nachricht auf dem Handy: In einem Lkw sind mehrere Leichen gefunden worden. Am Ende zählen die Ermittler 71 Tote in dem Kühllaster, den die Autobahnmeisterei in einer Pannenbucht der Ostautobahn bei Parndorf nach 24 Stunden Stehzeit gefunden hat. 59 Männer, acht Frauen, vier Kinder aus dem Irak, Afghanistan, Syrien und dem Iran. Aus dem Fahrzeug tropft Leichenflüssigkeit. Die Flüchtlinge sind elendiglich erstickt in dem Transporter für Gefrierhühnerfleisch; die Schlepper haben sie auf 14,26 Quadratmetern zusammengepfercht und die Türe von außen verschlossen. Nach Luft ringend, haben die Menschen im Todeskampf wie wild an die Außenwände geschlagen. Der Fahrer hat das Klopfen vernommen, aber nicht aufgemacht. Das dokumentieren Tonbandprotokolle, die die ungarische Staatsanwaltschaft zum Prozessbeginn in Kecskemét fast 22 Monate später vorlegt. Die ungarische Polizei hat die Schlepperbande abgehört, aber den Mitschnitt zu spät ausgewertet.
Faymann und Merkel sind tief erschüttert. Dieser Moment, das Parndorfer Drama, verbindet sie. Das ist kein stilles Massensterben mehr, weit weg im Mittelmeer. Die Schrecken der Flüchtlingskrise sind auf einmal ganz nah und sichtbar. Die Tragödie lässt sich nicht mehr verdrängen. Der weiße Volvo-Kühllaster mit der braunen Aufschrift einer slowakischen Geflügelfirma – das Y im Logo zu einem Huhn stilisiert – wird eines der ikonischen Fotos dieses Sommers. Bundespräsident Heinz Fischer hält beim Mittagessen mit den Regierungschefs und Ministern des Westbalkan-Gipfels eine Schweigeminute ab. Alle sind sich einig: So kann es nicht weitergehen.
Die Korridorlösung
Der Vorplatz unter der Neorenaissancefassade des Keleti-Bahnhofs in Budapest quillt inzwischen über. Die steinernen Statuen von James Watt und George Stephenson, den Erfindern der Dampfmaschine und der Dampflok, blicken mittlerweile auf Tausende Flüchtlinge herab, die alle nach Deutschland wollen. Und das rufen sie auch immer wieder, unter rhythmischem Geklatsche. Die Polizei riegelt den Bahnhof ab. Journalisten aus aller Welt haben sich eingefunden. Sie berichten von beschämenden Zuständen. Vom ungarischen Staat haben die Flüchtlinge nichts zu erwarten, kein Wasser und auch kein Essen. Sie sind auf private Hilfe angewiesen. Die ungarische Regierung steht wieder einmal am Pranger. Der mediale Druck ist enorm. Am 31. August zieht sich die Polizei auf einmal zurück. Hunderte stürmen die Züge. An diesem Montag werden am Ende 3650 Flüchtlinge am Wiener Westbahnhof ankommen. Nur sechs stellen einen Asylantrag. Der Rest reist in Zügen weiter Richtung Deutschland.
Merkel nimmt Kontakt zu Orbán auf und versucht, den Dublin-Tweet des Bundesamts für Migration vergessen zu machen. Sie spricht öffentlich von einem „Missverständnis“, das sich sicher schnell ausräumen lasse: Die Dublin-Verordnung gelte weiterhin in ganz Europa. Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner schlägt in die gleiche Kerbe. Dublin ersatzlos zu streichen, komme nicht infrage. Explizit fordert sie eine neuerliche Klarstellung von Deutschland. Berlin reagiert gereizt auf diese Empfehlung. Im ORF-Sommergespräch mit Hans Bürger im Ringturm über den Dächern Wiens verpasst Werner Faymann dem ungarischen Premier einen heftigen Seitenhieb. „Dass die in Budapest einfach einsteigen und man schaut, dass die zum Nachbarn fahren – das ist doch keine Politik.“ Ungarns Ministerpräsident müsse für Kontrollen und für die Einhaltung der Gesetze sorgen. „Wo ist denn da der starke Regierungschef, der immer auffällt durch besonders undemokratische Maßnahmen?“
Auch Faymann pocht auf die Dublin-Regeln, auf Fingerabdrücke und die Registrierung von Flüchtlingen. Doch agiert Österreich anders? All das sagt der Kanzler eines Landes, das am 31. August die aus Ungarn kommenden Flüchtlinge selbst einfach nur weitergewinkt hat zum deutschen Nachbarn. Dem an sich besonnenen CDU-Vorsitzenden im Europaausschuss des Bundestags, Gunther Krichbaum, kommt die Galle hoch. Er fordert die EU-Kommission auf, Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und Österreich zu prüfen. „Es ist skandalös, dass Flüchtlinge nun ungeprüft und ohne Ausweiskontrolle nach Deutschland kommen“, sagt er. Doch auch in den kommenden Monaten wird Österreich so verfahren und keinen einzigen durchreisenden Migranten registrieren. Ungarn ist gar nicht erfreut über Faymanns Belehrung, die auch noch eine Tirade gegen Zäune, Mauern und Wachtürme in Europa beinhaltet. Es zitiert den Österreichischen Botschafter in Budapest, Ralph Scheide, ins Außenministerium. Während die Flüchtlingskrise ihrem Höhepunkt zutreibt, liegen die Nachbarbeziehungen am Boden. Das wird sich noch rächen. Orbán lässt den Keleti-Bahnhof jetzt wieder abriegeln. Die Deutschen und Österreicher wollen es ja nicht anders, sie haben sich ja beschwert über die Flüchtlingszüge. Der provisorische Zaun an der Grenze zu Serbien hält kaum jemanden auf. Immer mehr strömen nach Budapest. Die Stimmung ist aufgeheizt. Der Budapester Ostbahnhof wird zur Bühne, in der sich die Geschichte unter den Kameras internationaler Fernsehstationen wie unter einem Brennglas verdichtet.
Gerry Foitik, den Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes, erinnert die Szenerie an 1989. Damals hatte seine Organisation geholfen, DDR-Flüchtlinge aus der deutschen Botschaft in einer Nacht- und Nebelaktion nach Westdeutschland zu führen. Ähnliches schlägt er nun im österreichischen Innenministerium vor. Warum holen wir die Flüchtlinge nicht einfach ab? Ein Beamter winkt sofort ab. „Dann kommen Sie wegen Schlepperei ins Gefängnis.“ In Wien haben Facebook-Aktivisten, angefeuert von Robert Misik, dem späteren Biografen von Faymanns Nachfolger Christian Kern, eine ähnliche Idee. „Konvoi Budapest Wien – Schienenersatzverkehr für Flüchtlinge“ nennen sie ihre Initiative. Sie wollen Schutzsuchende mit Privatautos aus Ungarn abholen. Am Sonntag, dem 6. September, um 11 Uhr soll auf dem Parkplatz des Praterstadions die erste Wagenkolonne starten. Ein paar fahren schon früher los. Sie werden am Donnerstag verhaftet. Wegen Schlepperei.
Auf Regierungsebene ist niemand daran interessiert, einen Korridor zu errichten. Das ist keine Option, weder für Österreich noch für Deutschland. Die Angst vor einer Sogwirkung, vor einem endgültigen Zusammenbruch des Dublin-Systems, ist zu groß. Und Orbán will unter allen Umständen verhindern, dass sich die Krise im Herzen der ungarischen Hauptstadt institutionalisiert. Ein Korridor zöge noch mehr Flüchtlinge an. Er aber will sie raus haben aus Budapest. Zu diesem Zeitpunkt drängen ihn Merkel und Juncker dazu, Hotspots für Flüchtlinge zu errichten, einen davon in Budapest. Im Gegenzug sollen sie von Ungarn aus in der EU verteilt werden. Doch das ist für Ungarn ein absolutes No-Go. Es sträubt sich gegen große Flüchtlingslager. Die Kapazität der Zentren übersteigt nie 200 Personen. Orbán plant acht bis neun kleinere Asylzentren, um die Flüchtlinge auf jeden Fall aus Budapest wegzubringen.
Am 3. September endet ein solcher Versuch in einem Riesenskandal. Unter dem Vorwand, dass die Reise nach München gehe, locken die ungarischen Behörden Flüchtlinge am Keleti-Bahnhof in einen Zug, dessen Sonderlokomotive noch dazu mit Grafiken verziert ist, die an das paneuropäische Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze vor dem Fall der Mauer 1989 erinnern. Die Menschen kaufen Fahrkarten, stürmen die Waggons, reichen Kinder durch die Fenster. Doch der Zug hält 35 Kilometer außerhalb von Budapest im Flüchtlingslager Bicske, dort wirft sich ein verzweifelter syrischer Mann mit seiner Frau und einem Baby auf die Gleise. Das Foto geht um die Welt, meist versehen mit einem falschen Bildtext, in dem ungarischen Polizisten unterstellt wird, Gewalt anzuwenden.
Orbán ist in diesem Tag in Brüssel. Er versucht Zwangsquoten und Hotspots abzuwehren. Mittlerweile ist publik geworden, dass Juncker und Merkel zusätzlich 120 000 Flüchtlinge verteilen wollen. Der Druck auf Orbán ist groß. Artig verspricht er, Migranten zu registrieren, wenn Merkel das wünsche. Obwohl das gar nicht mehr möglich ist. Seit Tagen verweigern Flüchtlinge jegliche Kooperation mit den Ungarn. Dann provoziert Orbán wieder. „Das ist kein europäisches Problem, das ist ein deutsches Problem“, sagt er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. „Niemand will in Ungarn bleiben und auch nicht nach Slowenien, Polen oder Estland. Alle wollen nach Deutschland.“ Die Regierung in Berlin habe mit unklaren Aussagen Menschen aus Syrien an den „gedeckten Tisch eingeladen“, ergänzt sein Stabschef János Lázár.
Die Ungarn treffen einen wunden Punkt: den BAMF-Tweet, den Merkel & Co. nun wieder verzweifelt ungeschehen machen wollen. Dublin gelte nach wie vor, wiederholen sie bei jeder Gelegenheit gebetsmühlenartig – und vergeblich. Normalerweise ist die deutsche Kanzlerin kaum zu provozieren, doch Orbáns Umschreibung des Flüchtlingsproblems lässt sie nicht unkommentiert: „Deutschland tut das, was moralisch und rechtlich geboten ist. Nicht mehr und nicht weniger.“ In diesen Stunden geht das Foto von Aylan Kurdi über die Nachrichtenkanäle: ein dreijähriger syrisch-kurdischer Bub im roten Kurzarmleibchen, leblos an einen Strand nahe Bodrum gespült.
Am Vorabend einer historischen Zäsur beherrschen Betroffenheit, gegenseitige Schuldzuweisungen, Gesten moralischer Überlegenheit, Zynismus und Widersprüche den politischen Raum. Merkel und Faymann können es nicht fassen, wie schlecht Orbán Flüchtlinge behandelt. Orbán hingegen weiß nicht so recht, was die beiden eigentlich von ihm wollen. Soll er die Flüchtlinge aufhalten oder weiterziehen lassen? Soll er Zäune errichten, sich an den Schengen-Kodex und die Dublin-Regeln halten? Eines ist für ihn klar: Behalten will er die Flüchtlinge nicht. Er glaubt nicht an eine europäische Lösung. Doch wie sich die Lage vor dem Keleti-Bahnhof schnell entschärfen lässt, daran denkt offenbar niemand. Tausende erschöpfte Menschen schwanken zwischen Bangen und Hoffen. „Alemania“, „Germany“ rufen sie immer wieder in Sprechchören. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Bicske-Finte empört die Flüchtlinge. Mittlerweile haben sie einen wichtigen Verbündeten: die Medien.
Der 4. September beginnt für Viktor Orbán mit einem außerordentlichen Treffen der Visegrád-Gruppe in Prag. Die Premierminister Tschechiens, der Slowakei und Polens stärken ihm den Rücken in der Flüchtlingskrise – und versprechen den Westbalkanstaaten Unterstützung beim Grenzschutz. In Wien empfangen Werner Faymann und sein Kanzleramtsminister Josef Ostermayer den ungarischen Botschafter János Perényi. Der österreichische Kanzler regt die Einrichtung von Hotspots an der serbisch-ungarischen Grenze an. Doch das ist undenkbar für Ungarn. Über eine Verteilung ließe Ungarn grundsätzlich mit sich reden, aber erst, wenn die EU die Kontrolle über ihre Außengrenze zurückgewonnen habe. Faymann fragt, wieso so wenige Leute in Ungarn Asyl bekommen. Das sei einfach, antwortet der Botschafter: „Die Migranten ziehen weiter, nachdem sie den Antrag gestellt haben, und sie festzuhalten, ist nicht erlaubt.“ Es ist ein gutes Gespräch, auch wenn die Meinungen weit auseinandergehen. Man beschließt, in Kontakt zu bleiben.
Perényi, der als Kind selbst nach Schweden geflüchtet war, geht davon aus, dass es sich um eine vertrauliche Unterredung handelt. Doch Faymanns Büro gibt danach eine Presseaussendung in ermahnendem Ton heraus: „Ungarn hat eine Registrierungspflicht. Es soll Flüchtlinge menschlich behandeln und es soll sich dafür einsetzen, dass es eine verpflichtende Quote gibt.“ Über die Flüchtlinge vor dem Keleti-Bahnhof sprechen der Botschafter und der Kanzler nicht. Doch bald wird die ganze Welt darüber reden. Um ungefähr 13 Uhr brechen Hunderte Flüchtlinge vom Bahnhof auf, mit Ikea-Säcken und Tragetaschen. Eine bunte Truppe. Sie sind den weiten Weg von Syrien, dem Irak, Afghanistan, Pakistan oder dem Iran bis hierher gekommen. Sie wollen nicht länger in Budapest, umringt von Polizisten, auf einen Zug nach Deutschland warten. Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie setzen sich in Bewegung – und schreiben damit Geschichte.