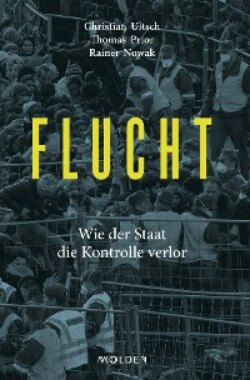Читать книгу Flucht - Rainer Nowak - Страница 5
ОглавлениеProlog
HINTER MERKELS
RÜCKEN
Ende Februar 2016: Sebastian Kurz blickt in besorgte Gesichter. Er hat im ersten Stock des Außenministeriums am Wiener Minoritenplatz 8 seine engsten Berater um sich geschart. Hinter seinem kleinen höhenverstellbaren Schreibtisch hängt eine Collage, die eine auf den Kopf gestellte Europakarte zeigt. Das Kunstwerk, Olaf Ostens „Kaleidoscope“, bringt die Stimmung ganz gut auf den Punkt. Europa steht Kopf. Fast eine Million Migranten sind in den vergangenen sechs Monaten quer durch den Kontinent gezogen. Damit soll nun Schluss sein. Fünf Staaten – Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien – wollen die Grenzen im Alleingang dichtmachen. Die Krise steuert ihrem Finale zu. Nur wie die Geschichte ausgeht, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen.
Alles hängt jetzt von den mazedonischen Sicherheitskräften ab. Es steht viel auf dem Spiel, vielleicht sogar die Karriere des ÖVP-Überfliegers. Sebastian Kurz hat volles Risiko genommen und hinter dem Rücken der mächtigsten Frau Europas eine Allianz geschmiedet, um die Balkanroute für Flüchtlinge an der Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland zu schließen. Er ist keineswegs allein am Werk gewesen. Die Slowenen hatten als Erste die Idee aufgebracht und über Monate die Polizeikooperation entlang des Flüchtlingstrecks im ehemaligen Jugoslawien vorangetrieben. Ungarn hat den Mazedoniern Tausende Rollen Nato-Stacheldrahtzaun und – ebenso wie Slowenien, Kroatien, die Slowakei, Tschechien und Polen – Polizisten zur Verstärkung an der Grenze geschickt. Doch Kurz ist spätestens seit der Westbalkan-Konferenz am 24. Februar 2016 in Wien für alle sichtbar zur Galionsfigur der Grenzschließer geworden.
Deshalb kann er jetzt auch alles verlieren, wenn etwas schiefläuft. Und genau so sieht es im Moment aus. Immer mehr Menschen drängen sich im Flüchtlingslager Idomeni an der griechischen Nordgrenze. Über 7000 sind es vier Tage nach der Wiener Konferenz bereits. Tausende irren durch Griechenland, gehen zu Fuß auf der Autobahn Richtung Norden. Und immer noch setzen täglich 3000 Menschen in Schlauchbooten von der türkischen Küste auf griechische Inseln über. Doch die Mazedonier lassen nur noch ein paar Dutzend Syrer und Iraker über die Grenze, manchmal auch gar niemanden. Die Regierung in Athen stellt dramatische Hochrechnungen auf: Bis zum Sommer könnten 200 000 Flüchtlinge in Griechenland gestrandet sein. Die Griechen präsentieren auch einen Schuldigen für ihr Dilemma: Für sie ist Österreich der Drahtzieher hinter der dichten Grenze in Mazedonien. Hunderte Demonstranten protestieren vor der österreichischen Vertretung in Athen.
Die Republik sitzt auf der internationalen Anklagebank. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Grenzschließung als Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention gebrandmarkt. Und auch die deutsche Kanzlerin macht Stimmung gegen die von Österreich orchestrierte Politik auf der Balkanroute. „Das ist genau das, wovor ich Angst habe. Wenn der eine seine Grenze definiert, muss der andere leiden“, sagt sie in der ARD-Talkshow von Anne Will. Ihre verdammte Pflicht sei es, einen europäischen Weg zu finden. Und damit meint Angela Merkel ihr Abkommen mit der Türkei, das noch immer nicht unterschrieben ist. Der Außenminister aus Wien hat sie ausmanövriert, und das bekommt er jetzt zu spüren.
Am 29. Februar setzen ein paar Hundert Migranten in Idomeni zum Sturm auf die mazedonische Grenze an. Sie verwenden eine lange Metallstange als Rammbock und rennen damit gegen den Stacheldrahtzaun an. Mit Zangen schneiden sie Löcher hinein. Doch der Durchbruchversuch scheitert. Die mazedonische Polizei treibt die Flüchtlinge mit Tränengas zurück. Die Bilder seien ein Beleg dafür, dass nationale Wege nicht zur Lösung führen, sagt der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier am nächsten Tag in Washington. Im Kabinett von Sebastian Kurz setzt das große Nervenflattern ein. Seine Entourage rechnet mit dem Schlimmsten. Was, wenn sich bei einem Sturm auf die mazedonische Grenze ein Kind im Stacheldraht verfängt? Kann Kurz solche hässlichen Bilder politisch überleben? Ein Mitarbeiter des Außenministers setzt vorsorglich eine Erklärung auf, um im Ernstfall mit den richtigen Worten gewappnet zu sein.
Idomeni, das überfüllte Flüchtlingslager an der griechisch-mazedonischen Grenze, ist zu einer Arena geworden, die Aktivisten, Helfer und Journalisten aus aller Welt anzieht. Sie berichten in Echtzeit, sie fangen das Elend ein und schüren die Empörung. Die Diplomaten im Wiener Außenamt eilen mit besorgniserregenden nachrichtendienstlichen Berichten über die Flure: Vor dem gesperrten Grenzübergang zu Mazedonien seien an vorderster Front auch ehemalige Elitesoldaten aus dem Irak und Syrien gesichtet worden, die sich unter die Flüchtlinge gemischt hätten. Und die griechischen Behörden seien nun wieder dazu übergegangen, massenhaft Migranten nach Norden zu karren.
Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Damm bricht. Zwei Mal schon, in der letzten Augustwoche und Anfang Dezember 2015, hatte Mazedonien vergeblich versucht, seine Grenze abzuriegeln. Kann es beim dritten Mal gelingen? Kurz und seine Einflüsterer glauben zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Schließung der Balkanroute an der mazedonischen Grenze wirklich funktioniert. Es ist für sie von Anfang an nur ein Versuch gewesen, den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Mehr nicht. Was sich im Nachhinein wie eine weitsichtige Strategie ausnehmen wird, ist nichts weiter als ein waghalsiges Experiment mit ungewissem Ausgang. Fünf oder sechs Tage werde der Zaun in Mazedonien halten. Länger nicht. So erwarten es die Berater von Sebastian Kurz zunächst. Und danach werde ein Stein nach dem anderen fallen, erst in Serbien, dann in Kroatien und Slowenien. Und am Ende, so glaubt man noch Anfang März 2016 im Außenamt, werden Zehntausende Flüchtlinge vor Spielfeld stehen. Und was dann? Soll dann etwa geschossen werden? Das kommt nicht infrage. In den Schubladen des Innenministeriums liegen Einsatzpläne, um im Fall des Falles gemeinsam mit dem Bundesheer den Grenzschutz zu verstärken. Doch wie lange könnte es Österreich politisch durchstehen, massenhaft Flüchtlinge von der Einreise abzuhalten?
Es sind aufwühlende Stunden und Tage. Der mazedonische Außenminister ruft mehrmals täglich bei Kurz an. „Wir halten das nicht mehr lange durch“, sagt Nikola Poposki immer wieder. Der Druck auf ihn und seine Regierung ist enorm: aus Brüssel, Berlin und aus Washington. Hochrangige US-Amerikaner intervenieren. Am 3. März 2016 sitzt ihm in seinem Außenministerium in Skopje der „Mr. Balkan“ des State Department gegenüber: Hoyt Brian Yee, der Unterstaatssekretär für europäische und eurasische Angelegenheiten. Und dessen Sorge gilt nicht nur der Staatskrise, in die Nikola Gruevski, der zwielichtige Expremier und Parteichef Poposkis, Mazedonien mit seinem korrupten und autoritären Regierungsstil manövriert hat. Die USA sehen in diesen Tagen auch die Stabilität ihres Nato-Verbündeten Griechenland unter der Last der Flüchtlingsmassen in akuter Gefahr. Und deshalb empfehlen sie dringend, die Grenzen offen zu halten. „Wie viele Flüchtlinge nehmt ihr? 15 000 täglich?“, fragt Poposki seine US-Gesprächspartner zurück und trifft einen wunden Punkt. Die Supermacht hat bisher nur wenige Schutzsuchende aus Syrien aufgenommen.
Bei Kurz beklagt sich Poposki auch über massiven Gegenwind aus Deutschland. Frank-Walter Steinmeier habe mehrere Diskussionen mit ihm geführt und sich dabei entsetzt über die humanitären Zustände im griechischen Grenzort Idomeni gezeigt. Wie lange können die Mazedonier noch Kurs halten und ihre Grenzen abschotten? „Ich kann das nicht gegen den Wunsch Deutschlands und der USA machen“, sagt Poposki. Kurz beruhigt seinen mazedonischen Amtskollegen. Denn er weiß, dass die Regierung in Berlin gespalten ist. Für Realpolitiker ist klar: Deutschland profitiert von der Balkan-Aktion, es kommen nun deutlich weniger Flüchtlinge ins Land. Steinmeier und Merkel geißeln die Grenzschließung zwar öffentlich, doch im Lager der Kanzlerin, sogar in ihrem engeren Umfeld, sind viele dafür. Und sie zählen zu Verbündeten von Kurz. Besonders gut ist sein Draht zu Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Er bittet sie und auch Innenminister Thomas de Maizière, ihre wohlwollende Haltung in Skopje zu deponieren und der mazedonischen Regierung bei der Grenzschließung den Rücken zu stärken. Ein Husarenstück: Der österreichische Außenminister organisiert Anrufe deutscher Minister in Mazedonien, damit sie dort auf informellem Weg die öffentliche Position ihrer Kanzlerin unterlaufen.
Seit Monaten hat Kurz auf der Suche nach Alliierten seine Fäden nach Deutschland gesponnen. Anfang Jänner 2016 schon weiht er auch das Umfeld Merkels vorzeitig in die österreichischen Pläne ein, eine Obergrenze für Flüchtlinge einzuführen und die Balkanroute zuzudrehen. Er spricht darüber mit Innenminister de Maizière, CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder und mit Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Doch man glaubt ihm in Berlin anfangs nicht, denn vom österreichischen Regierungskoordinator Josef Ostermayer hat man zu diesem Zeitpunkt noch anderes gehört.
Mit den Bayern ist Kurz ohnehin seit Beginn der Flüchtlingskrise auf einer Linie. Besonders enge Kontakte pflegt er mit der jungen Garde, mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer oder CDU-Finanzstaatssekretär Jens Spahn. Zu seinen Freunden gehört auch der ehemalige CSU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, den Kurz bei jeder Gelegenheit in den USA oder in München trifft. Die Fühler des Freiherrn reichen noch immer tief in die Union hinein. Kurz sucht zudem die Nähe zu Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. „Hat sich Merkel schon bedankt?“, wird ihn der alte Haudegen ein paar Wochen nach Schließung der Balkanroute fragen. Sie alle helfen dem jungen Außenminister, den Zorn der deutschen Kanzlerin abzufedern.
Oder ist es Merkel am Ende insgeheim ohnehin recht gewesen, dass die Mazedonier die Flüchtlinge aufgehalten haben? Hat sie ein doppeltes Spiel getrieben? Das glauben bis zum heutigen Tag viele österreichische Minister und Regierungsbeamte. Weder im Bundeskanzleramt noch im Außenamt in Wien sind deutsche Interventionsversuche erinnerlich. „Sie wollten uns nicht stoppen. Sie wollten nur nicht selbst als diejenigen gelten, die schließen“, sagt ein hochrangiger Diplomat. Im Rückblick tendiert auch der damalige mazedonische Außenminister Nikola Poposki zu diesem Deutungsmodell. „Es gab eine stille Zustimmung Deutschlands zur Schließung der Balkanroute. Die deutschen Politiker wünschten, dass wir es tun, aber sie änderten ihr Vokabular nicht.“ Auf offener Bühne aber kennt Angela Merkel nur ihren Plan A, das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Alles andere sind für sie Scheinlösungen, die dem europäischen Geist widersprechen, weil sie zulasten eines Mitgliedstaats gehen: Griechenland.
Am Ende wird der Flüchtlingsstrom versiegen. Der Wall an der Grenze zu Griechenland hält. Vier Wochen nach der Wiener Balkankonferenz tritt auch das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei in Kraft. Die Westbalkanroute schließt sich. Und eine Ausnahmesituation, die Europa ein halbes Jahr lang in Atem gehalten hat, findet ihren Abschluss.