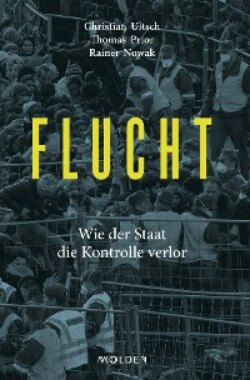Читать книгу Flucht - Rainer Nowak - Страница 8
KURZ ENTDECKT
DIE FLÜCHTLINGSKRISE
ОглавлениеAls Peter Kitzberger am Sonntag, dem 23. August 2015 nach einer Spritztour durch die mazedonischen Berge von seiner Aprilia absteigt, sieht er drei unbeantwortete Anrufe auf seinem Handy. Die Botschafterin hat versucht, ihn zu erreichen. Außenminister Sebastian Kurz hat sich kurzfristig für den nächsten Tag in Mazedonien angesagt. Kitzberger soll ihn zur Grenze nach Gevgelija begleiten. Kurz hat die Krise lange von sich ferngehalten. In seinem Nebenberuf als Integrationsminister fühlt er sich zunächst nur für anerkannte Flüchtlinge zuständig, nicht für Migration und Asylwerber. Darum kümmert sich das Innenministerium. So sind die Aufgaben verteilt, seit Kurz die Integrationsagenden nach seinem Aufstieg vom Staatssekretär zum Außenminister Ende 2013 ins neue Amt mitgenommen hat.
Auch seine europäischen Kollegen lassen die Finger von der Migration. Auf der Agenda des EU-Außenministerrats am 20. Juli in Brüssel finden sich viele Besprechungspunkte: Iran, Libyen, Tunesien, der Friedensprozess im Nahen Osten, nur eine Angelegenheit sucht man vergeblich: die Flüchtlingskrise. Mitte August reißt Kurz das Thema an sich. Dabei spielen nicht nur außenpolitische Erwägungen eine Rolle. Der Kronprinz der ÖVP hat in den Sommertagen eine starke Unterströmung in Österreich erspürt. Unterhalb der medialen Empörungswellen über die schlechte Unterbringung der Asylwerber im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen wächst in der Bevölkerung ein ganz anderer Unmut – über die Kosten der Sozialleistungen für die wachsende Anzahl von Flüchtlingen. Soll man die Hände in den Schoß legen und diese Stimmungen einfach der FPÖ überlassen? Die Frage hat für Kurz auch eine persönliche Note, eine durchaus ambivalente: Als Kind hat er miterlebt, wie seine Eltern in den 1990er-Jahren bosnische Flüchtlinge aufgenommen haben. Doch jetzt schaltet er auf hart.
Kurz wartet nicht mehr. Er beauftragt Alexander Schallenberg, den Leiter der Stabsstelle Strategie, ein Papier auszuarbeiten. Daraus wird ein Fünfpunkteplan. Am selben Tag, an dem er nach Mazedonien fliegt, schickt Kurz einen Brief an Federica Mogherini, die Hohe Repräsentantin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Kopien ergehen an alle anderen 27 Außenminister der EU und an Johannes Hahn, Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung. Österreich habe in den ersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg von 211 Prozent bei den Asylanträgen zu verzeichnen, schreibt er, zwei Drittel der Flüchtlinge kämen über die Balkanroute. Er fordert seine Amtskollegen auf, die Angelegenheit in die Hand zu nehmen und nicht bloß den Innen- und Justizministern zu überlassen. Fünf Punkte schlägt er vor: erstens die Bekämpfung der Ursachen der Fluchtbewegungen in Syrien und Libyen, zweitens die Einrichtung von Sicherheitszonen, Aufnahme- und Asylzentren in Drittstaaten möglichst nahe an den Kriegszonen, drittens einen verstärkten Schutz der Außengrenzen, viertens eine verbesserte Polizeikooperation mit den Westbalkanstaaten und fünftens Quoten zur Verteilung der Flüchtlinge in der Union. Ähnliches hat auch schon die Kommission präsentiert, nur umgesetzt hat es niemand.
Kurz will die Aufmerksamkeit auf die Balkanroute lenken, deshalb reist er nach Mazedonien. Seit Monaten steckt die ehemalige jugoslawische Teilrepublik in einer schweren Staatskrise. Die sozialdemokratische Opposition hat Abhörbänder an die Öffentlichkeit gespielt: Das ganze Volk kann nun hören, wie korrupt und autoritär das System des einstigen Hoffnungsträgers Nikola Gruevski mittlerweile ist. Da wurde geschoben, geschmiert, gedroht, erpresst und manipuliert, was das Zeug hält. Das Land ist in Aufruhr. Die Flüchtlingskrise kommt dem nationalistischen Regierungschef Gruevski nicht ungelegen. Sie kann ihm innen- und außenpolitisch nutzen, wenn er es geschickt anstellt.
In blütenweißem Hemd und Markenjeans steht Sebastian Kurz an der Grenze in Gevgelija und blickt hinüber nach Griechenland. Er ahnt noch nicht, dass sich hier auch seine Zukunft entscheiden wird. Überall verstreut liegen einzelne Schuhe: neben der Eisenbahnstrecke, unter dem Stacheldraht, im Gestrüpp, auf dem Feldweg. Spuren einer Massenpanik. Vor vier Tagen haben die Mazedonier den Ausnahmezustand ausgerufen und versucht, die Grenze abzuriegeln. Doch das haben sie keine 24 Stunden durchgehalten, nicht einmal mithilfe von Schockbomben und Plastikmunition. Der Andrang der Flüchtlinge ist zu groß gewesen. Jetzt warten vor den Augen von Kurz wieder 200 bis 300 Menschen dicht gedrängt in der prallen Sonne zwischen den Gleisen. Eine Frau schreit laut auf Arabisch, ein griechischer Helfer beruhigt sie. Es wird nicht mehr lange dauern. Polizeivertreter Griechenlands, Mazedoniens und Serbiens haben sich in einem Krisengipfel auf Kontingente verständigt: Statt zwei sollen künftig täglich vier Flüchtlingszüge mit jeweils 500 Passagieren gen Norden fahren. Doch schon zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass auch diese Kapazitäten nicht reichen werden. In der Straße neben dem Bahnhof parken Dutzende Busse und Taxis. Der Weitertransport ist zum Geschäft geworden.
Vor einem olivgrünen Zelt nahe der Grenze mischt sich Kurz für ein paar Minuten unter bereits registrierte Flüchtlinge, die unter bunten Strandschirmen auf ihre Weiterreise warten. Ein 38-jähriger Syrer erzählt von seiner Überfahrt aus der türkischen Hafenstadt Bodrum auf die kleine griechische Insel Pserimos: 45 in einem Gummiboot, der Motor fällt aus, schreiende Kinder, ein Horror. Er will weiter in die Niederlande, dort bekommt man angeblich rasch Arbeitsgenehmigungen. Ungarn bereitet ihm Sorgen. „Vielleicht brauchen wir dort einen Schlepper“, sagt der Syrer. Unter keinen Umständen will er sich einen ungarischen Stempel in den Pass drücken lassen.
Kurz hält sich nicht lange auf, er muss durch gewundene Schluchten zurück in die mazedonische Hauptstadt Skopje. Dort streift er sich einen dunklen Slimfit-Anzug über. Bei einer Pressekonferenz im Safarow-Palast sagt er neben dem mazedonischen Außenminister Nikola Poposki, dass er „von Mazedonien, Serbien und vor allem von Griechenland eine ordentliche Grenzsicherung“ erwarte. „Einfaches Durchwinken kann keine Lösung sein.“ Doch was ist die Lösung? Diese Frage stellt Kurz während seiner Reise durch Mazedonien auch Polizeiattaché Kitzberger. Der Beamte aus Golling hat keine Antwort darauf. Er glaubt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sich der gewaltige Flüchtlingsstrom noch stoppen lässt. Schon gar nicht mit dem Stacheldrahtzaun in Gevgelija. Denn diese Absperrung endet nach nur 200 Metern im Nichts.
Der Zaunkönig
Viktor Orbán macht schon das ganze Jahr über mobil gegen die „Völkerwanderung“, die er auf Ungarn und Europa zurollen sieht. Am 11. Jänner 2015 hängt sich der ungarische Ministerpräsident in Paris mit anderen Staats- und Regierungschefs ein, um für ein Bild zu posieren. Es soll den Eindruck vermitteln, dass die Führer der Welt dem Terror trotzen und den gewaltigen Trauermarsch einer Million Franzosen für die 17 Todesopfer der Anschläge auf die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ und einen koscheren Supermarkt anführen. In Wirklichkeit ist das Foto gestellt, wie später eine Luftaufnahme zeigt. Ihre Menschenkette der Solidarität bilden die Spitzenpolitiker aus Sicherheitsgründen beim Place Leon Blum in einer Nebenstraße vor ihrer eigenen Entourage. Danach rauschen sie ab. Orbán setzt vor seinem Abflug noch eine Botschaft ab. Wirtschaftsmigration sei eine schlechte und gefährliche Sache, sie müsse gestoppt werden. Orbán hat sein Thema gefunden, und er schlachtet es innenpolitisch aus. So kann er sich als Beschützer der Ungarn in Szene setzen und der rechtsextremen Jobbik-Partei das Wasser abgraben.
Im Mai lässt der rechtsnationale Volkstribun per Post Fragebögen an die ungarischen Bürger schicken, um sie an einer „Konsultation über Zuwanderung und den Terrorismus“ teilhaben zu lassen. Die Fragen haben suggestiven Charakter: Ob die seitens Brüssel schlecht gemanagte Einwanderung in Zusammenhang mit dem Erstarken des Terrorismus stehe, erkundigt sich Orbán beim Volk. Und ob er statt der Migranten nicht eher ungarische Familien unterstützen solle. Das UNHCR ist entsetzt: Die ungarische Regierung fördere Fremdenfeindlichkeit und stelle Flüchtlinge als Gefahr dar. Orbán ist von dem Zwischenruf unbeeindruckt. Wenig später lässt er im Land Plakate affichieren. „Wenn du nach Ungarn kommst, darfst du den Ungarn nicht die Arbeit wegnehmen“, ist darauf zu lesen. Auf Ungarisch. Die Botschaft richtet sich an die eigene Bevölkerung. Orbán organisiert breite Rückendeckung für seine Ablehnung der EU-Verteilungsquoten, die er als verrückt bezeichnet. Die Beziehungen zur EU sinken unter den Gefrierpunkt, nicht zum ersten Mal seit Orbáns Amtsantritt 2010. „Hallo Diktator!“, begrüßt ihn EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei einem Gipfel in Riga halb im Scherz.
Immer mehr Migranten strömen über die grüne Grenze nach Ungarn. Anfang Juni 2015 sind es bereits über 50 000, mehr als im gesamten Vorjahr und 25 Mal so viele wie 2012. Orbán reicht es, jetzt setzt er endgültig auf einen Alleingang. Er kündigt an, an der 175 Kilometer langen Grenze zu Serbien einen Zaun zu bauen. Eine Sprecherin der EU-Kommission verwendet in ihrer Reaktion eine Metapher, in der sich Europas Debatten in den kommenden Wochen verhaken. „Wir haben gerade erst die Mauern in Europa eingerissen, wir sollten sie nicht wieder aufbauen.“ Ihr Nebensatz geht unter: Die EU hat keine rechtliche Handhabe. Ungarn liegt an der Außengrenze der EU. Und dort erlaubt der Schengen-Kodex den Bau von Grenzzäunen. Die Ungarn sind nicht die ersten, die Absperrungen hochziehen. Spanien hat 2005 die Exklaven Melilla und Ceuta in Marokko zu Festungen ausgebaut: mit sechs Meter hohen Stacheldrahtzäunen. Auch Griechenland und Bulgarien haben Wälle an ihren Landgrenzen errichtet. Darüber hat sich kaum jemand aufgeregt. Doch Ungarn steht am Pranger. Orbán ist nun einmal der böse Bube, und er selbst schürt das Image nach Kräften, es lädt seine Bedeutung auf. Die Zaun-Entscheidung ist zunächst auch intern nicht unumstritten, wie sich Regierungssprecher Zoltán Kovács erinnert. Einzelne Beamte erheben technische Einwände, andere bezweifeln den Nutzen. Doch letztlich orientieren sich die ungarischen Behörden an internationalen Beispielen: an Spanien, Israel und den USA. Bis Ende November soll der vier Meter hohe Zaun fertig sein, heißt es anfangs. Das geht Orbán zu langsam. Gegen Ende Juli beschleunigt er die Bauarbeiten: Bis 31. August soll zumindest ein Vorzaun stehen: 150 Zentimeter hoch.
Setzt nun eine Torschlusspanik ein? Ab Mitte Juli wird die Flüchtlingskrise auch im Herzen Budapests sichtbar. Noch versuchen die ungarischen Behörden, die Personaldaten der Flüchtlinge aufzunehmen. Sie gehen dabei bisweilen nicht zimperlich vor. Doch die Aufnahmelager sind offen. Nach ihren Asylanträgen ziehen die Menschen weiter. Sie wollen nicht in Ungarn bleiben. Das ist nicht das Land ihrer Träume. Ab August lassen sich die Flüchtlinge in Ungarn kaum noch registrieren. Nur ja kein ungarischer Stempel. Denn dann könnte man ja zurückgeschoben werden.
Das kaputte Dublin-System
Das Dublin-Spiel ist längst im Gang. Das Übereinkommen, 1990 in der irischen Hauptstadt unterschrieben und sieben Jahre später in Kraft getreten, ist auch in seiner dritten Version so ganz nach dem Geschmack von Ländern wie Deutschland und Österreich. Denn es hält ihnen Flüchtlinge vom Leib. Die Last liegt auf der südlichen Peripherie, nicht im reichen Zentrum und Norden Europas. Für Asylanträge ist demnach jenes Land zuständig, das Schutzsuchende als erstes betreten. Staaten an der EU-Außengrenze wie Italien und Griechenland sind davon besonders betroffen.
Deren jahrelange Bitten um Solidarität der europäischen Partnerländer haben nichts gebracht. Sie haben sich daher längst auf eine andere Strategie verlegt: wegschauen und durchwinken. Seit vier Jahren ist Griechenland überhaupt aus dem Spiel: Am 21. Dezember 2011 hält der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg in den Rechtssachen C-411/10 und C-493/10 fest, dass ein Asylwerber nicht in einen Mitgliedstaat überstellt werden kann, in dem er aufgrund systemischer Mängel im Verfahren Gefahr läuft, unmenschlich behandelt zu werden. Ein ähnliches Urteil fällt zu Beginn desselben Jahres der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Die griechischen Behörden haben das System ausgehebelt, und die europäischen Richter haben ihren Stempel daraufgegeben: Man muss Asylwerber nur schlecht, schleißig und schäbig genug behandeln, dann ist man nicht mehr für sie zuständig. Dublin ist längst tot, doch das wird erst in diesem Flüchtlingssommer so richtig offenkundig. Für Griechenland, das europäische Einfallstor auf der Balkanroute, gilt eines der wichtigsten Ordnungsprinzipien im europäischen Asylgefüge nicht mehr: Es kann getrost auf Durchzug schalten, von Amts wegen darf kein EU-Staat Asylwerber nach Griechenland zurückschicken.
Ende Juni, knapp vor dem EU-Gipfel, setzt auf einmal Ungarn das Dublin-III-Abkommen einseitig aus. Regierungssprecher Kovács zündet die Bombe in Wien im Gespräch mit Journalisten nach einer Portion Hummerkrautfleisch im Restaurant Vestibül im Burgtheater. Das Boot sei voll, Ungarn werde keine Flüchtlinge aufnehmen und schon gar keine zurücknehmen, sagt Orbáns smarter Staatssekretär für Public Diplomacy in perfektem britischem Englisch. Zwölf EU-Mitgliedstaaten sind auf Beamtenebene informiert. Es ist ein Hilfeschrei, ein taktischer Kniff, um deutlich auf den enormen Flüchtlingsandrang in Ungarn hinzuweisen. Die Aufregung ist groß. Alle pochen auf die Dublin-Schimäre. Damit das System nicht vollkommen zusammenbricht, muss zumindest der Schein gewahrt bleiben. Ungarn rudert zurück – und bekennt sich zu europäischem Recht.
Doch die Lage entgleitet. Im August sind bereits mehr als 100 000 Menschen auf der Balkanroute unterwegs. Es werden mehr und mehr. Der Budapester Bahnhof Keleti hat sich zum Drehkreuz für Flüchtlinge und Schlepper entwickelt. Hunderte campieren auf dem Vorplatz oder im Untergeschoß und täglich gesellen sich neue Ankömmlinge hinzu, ihr Hab und Gut in Rucksäcken. Viele versuchen ihr Glück auf eigene Faust, kaufen einfach Tickets für Züge nach Österreich und Deutschland. Andere heuern Fahrer an. Noch ist für sie die Grenze nach Österreich nicht offen. Doch die Behörden können oder wollen nicht lückenlos kontrollieren, auch nicht in den Zügen. Es gibt zwar trinationale Streifen, die ungarische, deutsche und österreichische Polizisten gemeinsam durchführen. Doch offenbar zu wenige. Langsam rauen die Nerven auf. Deutsche Polizeibeamte beklagen sich öffentlich, dass ihre österreichischen Kollegen wegschauen. Die Innenminister fangen die Unstimmigkeit wieder mit Gelöbnissen zur Zusammenarbeit ein.