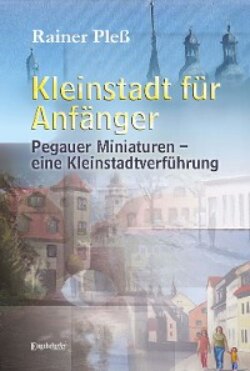Читать книгу Kleinstadt für Anfänger - Rainer Pleß - Страница 7
Rundgang durch eine kleine Stadt – Wunderliches, Merkwürdiges, Denkwürdiges und Absonderliches
ОглавлениеIn alten Tagen führten die meisten Fernstraßen durch Dörfer und kleine Städte. So kam man, oft unbeabsichtigt, in manchen Ort, der ansonsten niemals Ziel einer Reise geworden wäre und fand mitunter einen Grund zur Wiederkehr. Heute führen die Straßen zur Reise in entferntere Regionen um diese kleinen Ortschaften herum oder an ihnen vorbei. Man kennt höchstens noch ihre Namen, erfährt aber ansonsten nichts von ihnen.
Grubenvorgelände
So ergeht es auch dem Kleinstädtchen Pegau im Süden von Leipzig. Bereits seit 1964 führt die Fernverkehrs- und spätere Bundesstraße Numero 2 an ihm vorbei. Bis dato musste ein jeder, der nach Zeitz oder Hohenmölsen und darüber hinaus wollte, über den Markt und durch die Breitstraße dieser Stadt fahren, sah so manche einladende Gastwirtschaft, eine beachtliche Kirche, ein wunderlich an das Leipziger gemahnendes Rathaus und beschloss, wenn Zeit sei, wiederzukehren.
Zu dieser Zeit lag der Bahnhof dieser Stadt, wie einige Einwohner vermuteten, an der Strecke Borne-Peesche-Budabeschd, Pegau schien international werden zu können.
Zur Gewinnung von Kohle nahm ein Tagebau Teile der Stadt und die alte B2, die damals noch eine Fernverkehrsstraße war, von der Landkarte. Heute führt die neue B2 und der Zufall keine Gäste mehr nach Pegau. Wer hier ankommt, hat den Ort mit Bedacht zum Ziel der Reise gewählt.
Doch welche Großstädter wollen schon nach Pegau?
Aber hat man sie einmal hergelockt, sind die meisten doch begeistert von einer wunderbar intakten Altstadt, den kleinen Läden, die noch immer (trotz Lidl, Rewe, Norma, Netto und Kik) existieren, von den Gaststätten und der Gastlichkeit dieser sechstausend Seelen Stadt.
Und viele kommen wieder!
Kommt man von der B2 nach Pegau, so wird man von Rewe, einem Autohaus, der Tankstelle, Lidl und einem kleinen Blumenladen begrüßt, ohne dass dies etwa großstädtisch wirken würde.
Kurz danach reckt sich rechts der Straße eine alte Postmeilensäule in den Himmel.
Einst hatte die Stadt zwei davon. Eine vor dem Unter- (eben jene, vor der wir gerade stehen), und eine vor dem Obertor.
Die Pegauer Kursächsischen Postmeilensäulen sind aus Zeitzer Sandstein gefertigt und wurden 1723 errichtet. Eine Säule kostete ehemals 20 Taler.
Zur Feier ihrer „Inbetriebnahme“ spendierte der damalige Bürgermeister für drei Groschen Bier. Eine Tatsache, die so bedeutsam war, dass sie in den Chroniken der Stadt verzeichnet wurde und wiederum ein Beispiel dafür ist, wie sich die Zeiten wandeln.
An diesem Beispiel wird nämlich wieder einmal deutlich, wie sehr die Aufgaben der Kommunalpolitiker mit den Jahren doch gewachsen sind. Stellen Sie sich vor, einer dieser politischen Würdenträger käme heute mit Bier für drei Groschen (ein halber Liter Sachsenbräu) und riefe Ihnen zu: „Ich geb’ einen aus!“
Der Mann oder die Frau würde die nächste Kommunalwahl nicht überleben.
Etwas anderes wäre es da schon, wenn er diesen halben Liter Bier annehmen würde. Da könnte ein Parteifreund oder ein anderweitig Missgünstiger eine Anzeige wegen Bestechlichkeit anstrengen. Das gibt es nicht nur auf kommunalpolitischer Ebene sondern auch ganz oben. Denken Sie doch nur an den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Gut, der hat auf dem Oktoberfest für siebenhundert Euro Bier getrunken, aber dafür war er auch Bundespräsident. Da geht schon etwas mehr hinein.
Also lässt sich an Postmeilensäulen nicht nur eine geographische Entfernung sondern durchaus auch eine historische ablesen.
Leider aber haben sich nicht alle diese Kilometerzähler erhalten. So ist die zweite dieser Säulen in Pegau Ende des neunzehnten Jahrhunderts der Westerweiterung unserer kleinen Stadt zum Opfer gefallen.
Doch die erhaltene wurde gepflegt und gehegt, nach 1990 restauriert, teilweise erneuert und was aus den übriggebliebenen und ersetzten Teilen geworden ist, verrate ich Ihnen später.
Gegenüber dieser Postmeilensäule, an der anderen Straßenseite, befindet sich eine Grünanlage, die am Ufer des Flüsschens Elster entlangführt. Hier soll nach dem Willen der örtlichen Stadtregierung in den Folgejahren eine Bootsanlege- und -einstiegsstelle gebaut werden. Das wird teuer.
Alles Neue ist zunächst umstritten. Besonders, wenn es Geld kostet. So, wie es bei der für die Stadt so notwendigen, genialen und erfolgreichen Sanierung des Volkshauses zu seiner Zeit Stimmen gab, die meinten: „So’n Blödsinn, das schöne Geld! Könnte man doch was Nützliches damit machen“, gab es aber auch Stimmen, die riefen: „Wundervoll! Pegau wird Kulturhauptstadt! Mit Bussen werden die Besucher angerollt kommen, um in unserem Volkshaus Kultur zu feiern!“ Dazwischen gab es wenig.
Dass man mit dem Haus nicht allzu viele Opern- oder Gewandhausbesucher aus Leipzig angelockt hat ist mittlerweile völlig unwichtig. Das Volkshaus gehört zur Stadt und niemand möchte es missen. Und selbst die eifrigsten früheren Gegner dieses Vorhabens wissen heute nicht mehr, dass sie es jemals waren.
Der große Komiker Karl Valentin spielte einmal einen Gemeindevertreter, der aus Prinzip gegen alles war, was der Herr Bürgermeister tat und unternahm. Als er einmal zu spät zu einer Gemeinderatssitzung kam, die Herren waren bereits in heftigster Diskussion, grüßte er nicht, wie es Sitte ist, mit einem „Guten Abend“ oder dergleichen, sondern mit: „Ich bin dagegen!“ Auf den Einwurf des Bürgermeisters: „Aber du weißt doch gar nicht, worum es geht.“ Antwortete Valentin: „Egal, ich bin dagegen!“
Ein solcher Meckerer ist zwar schwierig in der Haltung und Zusammenarbeit, aber doch jedem Entscheidungsträger zu wünschen, zwingt er doch dazu, Gründe des Für und Wider genau und wiederholt abzuwägen, Entscheidungen exakt zu diskutieren, Gründe zu formulieren und alles gründlich zu hinterfragen.
Doch der Bootsanleger wird werden.
Die einen in der kleinen, naiven Stadt Pegau, rechnen damit, dass die Wasserstraße Elster eine größere Anzahl Touristen an die pegischen Gestade spülen wird, womit die gemütliche Stadt zu einem Mekka vermögensschwerer Touristen werden soll. Das sind die Befürworter und ihre Argumente.
Die anderen sind nicht unbedingt dagegen, aber sie glauben auch nicht an den mit dem Anleger verbundenen Massentourismus. Sie sagen: „Menschen, die vom Wasser aus hinter Deichen, dichtem Grün von Hecken, Bäumen und Unkraut im Vorübergleiten eine Kleinstadt vermuten könnten, von der sie genau so wenig sehen, als würden sie auf der B 2 vorbei rasen und die die Grundlage ungeahnter aber erhoffter Touristenströme zur Genesung des örtlichen Einzelhandels bilden sollen, sind eine Chimäre. Paddler, die hier nur mal aussteigen, wenn sie ihre Notdurft verrichten müssen, die ob ihrer legeren, verschwitzten Bekleidung keinen Schritt von ihrem Kanu weichen und die als einzige Erinnerung die an die unzureichenden Toiletten des Jugendclubs der Stadt mitnehmen werden, sind auch nur sehr bedingt zur Wiederkehr nach Pegau angeregt.“
Argumente, die nicht von der Hand zu weisen sind und die bei geschätzten Kosten von siebzigtausend Euro nicht unbeachtet bleiben dürfen. Es ist die Zukunft, die zeigen wird, ob es eine Erfolgsgeschichte oder eben nur ein teurer Bootsanleger wird.
Der Kleinmütige
Mit Sicherheit aber wird es einheimische Wassersportler geben, die diesen „Hafen Pegau“ nutzen und feiern werden. Ein kleines Schrittchen auf dem Weg zu einem Naherholungsstandort. Und das kann einer kleinen, grünen Stadt nur gut tun.
Gehen wir nun etwas weiter Richtung Innenstadt, so überqueren wir den wilden Strom der Elster und erkennen, wiederum auf der rechten Straßenseite, den Giebel der neuen Feuerwache. Davor, direkt hinter der Brücke, auf welcher wir daher geschritten kommen und deren Pfeiler aus den Quadern der St. Ottenskirche errichtet sein sollen, befindet sich ein fast quadratisches Rasenstück, auf welchem wir einen Besucher von den Osterinseln zu erblicken glauben. Es ist die „Wächterfigur“, die der Leipziger Bildhauer und Grafiker Wolfgang K E Lehmann im Jahr 2008 während des zweiten Pegauer Bildhauer-Pleinairs aus einem einheimischen Eichenstamm schuf. Diese blau eingefärbte mit Helm und Schulterpanzer aus Walzblei bekleidete archaische Figur wurde mit Bedacht an dieser Stelle aufgestellt. Denn in alten Zeiten befanden sich an dieser Stelle der Geschirrhof (heute der städtische Bauhof) und die Brückenzolleinnahme.
Der Wächter hat also nichts mit dem Hinweis auf die wachsame, segenswerte und äußerst hülfreiche Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr unserer Stadt , die seinerzeit, als die Skulptur hier errichtet wurde, verlangt hatte, man solle sie nicht blau sondern rot einfärben, zu tun. Sie gibt Hinweis auf eine der Absonderlichkeiten der kleinen Stadt Pegau, nämlich auf die Tatsache, dass gerade hier der Brückenzoll für die gute Stadt Pegau kassiert wurde. Diese Maut der frühen Jahre wurde ebenfalls nicht nur, wie wohl bereits damals vorgesehen, zu Reparatur und Erhaltung von Straßen und Brücken verwandt, sondern diente bereits in alter Zeit zur Finanzierung anderer kommunalpolitischer Notwendigkeiten. Es ist also auch heute noch eine gewisse Skepsis angebracht und im Volke verwurzelt, wenn die Ankündigung einer PKW Maut, besonders deren angebliche Kostenneutralität, dem fahrenden Volk gegenüber angekündigt wird.
Einer Brückengeldeinnahme ein Denkmal zu setzen ist jedoch auch in einer Stadt, die winzig klein, hinter vielen Hügeln und Tagebauen gelegen ist und aus ihrer Zeit gefallen zu sein scheint, nicht opportun.
Die Skulptur soll auch dieses nicht sein. Sie steht vielmehr für Starrsinn und Beharrlichkeit, den Stolz und die Findigkeit der Bürger dieser schönen Stadt Pegau.
Denn als im Jahre 1833 im Königreiche Sachsen der Zollverein eingeführt wurde und aus der Landeshauptstadt ein Brieflein bei dem örtlichen Rat ankam, des Inhalts, ab sofort hätten entsprechend Artikel 7 im Lande alle Brücken- und Wegezölle zu entfallen, war man im Rathause ratlos. Der Brückenzoll war eine städtische Einnahme. Und Ausgleichszahlungen waren in der alten Zeit noch nicht üblich. Es war zu vermuten, dass diese vom Hofe zu Dresden abgelehnt würden. Auch der heutige Hof zu Dresden praktiziert den Finanzausgleich lieber von den Stadtsäckeln in die Landeskasse als anders herum.
So war zunächst Klagen und Heulen im Hause des Rates.
Hochwasser an der Elster
Doch in der guten Stadt Pegau lebte zu jener Zeit ein Mann namens Friedrich August Fissel, Ratsschreiber seines Zeichens und ein Mann von unbändigem Fleiße, einer, wie man ihn jeder Regierung nur wünschen kann. Dieser hoch zu lobende Mitarbeiter des Rates der Stadt erledigte nicht nur seine Arbeit zu allgemeiner Zufriedenheit, sondern er führte auch für die Nachwelt ein sehr detailliertes , umfangreiches und exaktes Tagebuch über alle Geschehnisse in der kleinen Stadt und hatte darüber hinaus noch Muße gefunden, die zahlreichen Urkunden im Rathaus zu kopieren.
Dieser Fissel erinnerte sich an eine das Problem betreffende Urkunde, die man entsprechend seinem Hinweis suchen ließ, fand und voller Verwunderung las. Es war das Privilegium des Straßen- und Brückenrechts, unterzeichnet von Markgraf Friedrich und datiert auf den 20. November 1417.
Diese Urkunde präsentierte man triumphierend zusammen mit einer Abschrift den Dresdener Herrschaften und entgegen den Zeichen und den Erfordernissen der neuen Zeit durfte in Pegau weiter Brückenzoll kassiert werden, was man fleißig bis ins Jahr 1918 hinein tat. Im Jahre 1907 beschloss der Rat der Stadt, die dem Brückengeldeinnehmer zugestandenen Tantiemen von 10 auf 12 Prozent der vereinnahmten Summe zu erhöhen und ab Februar 1914 musste dann auch für die neuartigen Automobile Brückenzoll an der Elsterbrücke zu Pegau entrichtet werden.
Ein Hundsfott, wer davon dem derzeitigen Verkehrsminister berichtet.
Damit jedoch noch nicht genug der Besonderlichkeiten an diesem Orte.
Genau gegenüber des Standortes der Wächterfigur, auf der anderen Straßenseite, befindet sich nämlich die sogenannte „Puddingschule“.
Die Pegauer Landwirtschaftliche Schule wurde im Jahre 1896 in dem ursprünglich als Armenhaus errichteten Gebäude in der damaligen Kaiser-Wilhelm-Straße (heute Ernst-Reinsdorf-Straße.) errichtet und erlangte bald deutschlandweit einen guten Ruf. Der Herr Gutsbesitzer Friedrich Hirschfeld, damals zuständiger Kreisvereinsvorsitzender, regte Anfang 1922 die Gründung einer Mädchenabteilung für diese Schule an. Trotz der „Neuheit dieser Sache“ wurden so viele Elevinnen bäuerlichen Tuns an dieser Hauswirtschaftsschule angemeldet, dass eine Erweiterung des Schulbaues notwendig wurde. Die Stadtoberen der feinen Stadt Pegau entledigten sich dafür eines Schandfleckes ihres blühenden Gemeinwesens, des alten Schützenhauses, und so konnte am 4. Februar 1925 das neue Schulgebäude der Landwirtschaftlichen Schule für Mädchen hier an diesem Standort eingeweiht werden.
Es ist in den Annalen der guten Stadt Pegau überliefert, dass bereits in den alten Zeiten die städtische Jugend die landwirtschaftlichen Schüler wegen deren Vorliebe für Pudding neckte und foppte.
Heute ist in dem Gemäuer der ehemaligen „Puddingschule“, die die Möglichkeit ihrer Gründung der Übergabe des Armenhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße verdankte, eine Seniorenresidenz installiert worden. In Armenhäusern lebten vor allem ältere Menschen, die nicht mehr selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten. Sie erhielten dort einen Wohnplatz und tägliche Verpflegung. Nun ist also die landwirtschaftliche Lehranstalt zu ihren Wurzeln zurückgekehrt.
Wir gehen jetzt weiter die Leipziger Straße Richtung Stadtzentrum. An der nächsten Einmündung biegen wir in die kleine Gasse nach rechts ein. Wir treffen uns auf dem Ottomarsplatz wieder.