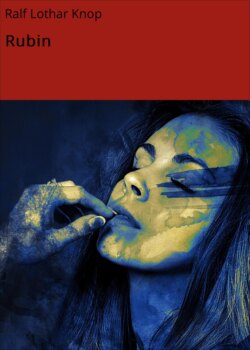Читать книгу Rubin - Ralf Lothar Knop - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sünder
ОглавлениеIn Marburg an der Lahn wollte Rubin Rudolf Bultmann und anschließend dessen Schüler Herbert Braun in Mainz kennen lernen. Aufgrund seiner Naivität wusste Rubin allerdings nicht, dass Bultmann bereits 1951 emeritiert worden war. Umso glücklicher war er, als er 1968 an einem Fackelzug zu Ehren Bultmanns an seinem 84. Geburtstag teilnahm und anschließend in dessen Garten ihn persönlich kennenlernen durfte. Herbert Braun, der 1968 emeritiert wurde, hat Rubin jedoch nie getroffen, weil ihn die nächsten Jahre schicksalshaft an Marburg an der Lahn binden sollten.
Entmythologisierung war das Schlagwort, das Rubin sein Leben lang faszinierte und dieses Schlagwort verband er mit den Namen der Theologen Bultmann und Braun. Bereits als Jugendlicher wollte er mit dem Gesangbuch und der Bibel unter dem Arm in die Kneipe gehen; er wollte an einen Gott glauben, der seinen Platz mitten in unserer Gesellschaft hat, doch so vieles von dem, was im Neuen Testament stand, passte einfach nicht zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen des 20. Jahrhunderts.
Insbesondere die Erzählungen von den Wundern konnten auf gar keinen Fall stimmen, denn wenn man diese Erzählungen wörtlich nahm, schilderten sie ja nichts weiter als Zauberei, als Simsalabim ohne jegliche Bedeutung. Warum sollte Gott den Menschen sagen:
Ich kann etwas, was du nicht kannst!
Das waren Fragen, die Rubin beschäftigten, er wollte einen Sinn in den Wundererzählungen finden, den er akzeptieren konnte. Wenn Gott ihn als gleichberechtigten Partner, als sein Ebenbild, geschaffen hatte, dann musste es auch möglich sein, seine Worte in die heutige Sprache zu übersetzen.
Natürlich kann man Tote zum Leben erwecken, Menschen, die ihr Leben vergeuden, indem sie ständig stumpfsinnig vor dem Fernseher sitzen, was Rubin insbesondere an seinem Vater hasste, weil es nicht möglich war, eine vernünftige Unterhaltung zu führen, ohne dass das Gerät einem die Ohren zu dröhnte, können sich ändern und ein spannendes und aufregendes Leben führen. Natürlich kann man Wasser in Wein verwandeln, indem man die Alltäglichkeit durchbricht. So machten diese Erzählungen für Rubin einen Sinn.
Blindheit, Lähmung und Muskelschwund hindern einen Mann achtunddreißig Jahre lang daran, rechtzeitig den Teich von Betesda zu erreichen, um in seinen unregelmäßigen Fluten geheilt zu werden, immer bleibt er auf der Strecke.
Niemand hilft mir und alleine habe ich ja doch keine Chance.
Solange die anderen an meinem Zustand schuld sind, kann sich in meinem Leben nichts ändern, deshalb ergeht an den Kranken die Aufforderung:
Steh auf!
Du darfst selbstständig sein und einen eigenen Standpunkt haben. Doch die „führenden Männer“ reagieren sofort mit ihrem Standardspruch:
Das darfst du nicht! Wenn das jeder machen wollte!
Sie sehen ihre Machtposition gefährdet. So macht diese Erzählung einen Sinn.
Und dann war da noch die Geschichte mit dem sogenannten Verräter Judas. Wenn doch Gottes Heilsgeschichte geplant war, dann musste ja wohl auch dieser angebliche Verrat von Gott geplant sein. Wie konnte man dann aber Judas verdammen, wenn er doch den Willen Gottes erfüllte. War der Kuss, den Judas Jesus gab nicht doch ein Zeichen seiner großen Liebe zu Jesus? Judas war ein frommer Jude und er war von der Lehre Jesu begeistert, er wollte seinen Beitrag zu einer Versöhnung leisten, weil er zerrissen war zwischen den Lehren der Synagoge und der Heilsbotschaft Jesu.
Als Judas erkennt, dass sein Versöhnungsversuch jämmerlich gescheitert ist, platzt er vor Wut, sein Leib platzt auf und die Eingeweide treten heraus. Genau diese Gedanken findet Rubin bestätigt am Portal der Kathedrale von Benevento: Judas hängt an einer Palme mit aufgeplatztem Leib, aus dem die Eingeweide dringen, er wird von einem Engel umarmt, der ihn küsst. So macht das Sinn.
Auch die Gleichnisse, die Rubin in der Bibel findet, kann er einfach nicht so verstehen, wie man es ihn lehren wollte. Er fühlte sich immer wie der verlorene Sohn in dem gleichnamigen Gleichnis. Auch Rubin hatte einen Bruder, der immer, so schien es ihm zumindest, vorgezogen wurde. Im Gleichnis bleibt der gehorsame ältere Bruder zu Hause, doch wie ist dieser Mann denn wirklich. Er ist leistungsorientiert, autoritätshörig, profitsüchtig, zornig und neidisch, er verachtet seinen Bruder und macht sich der üblen Nachrede schuldig. In dieser Welt droht der jüngere Bruder zu ersticken, er verspürt in sich die unendliche Sehnsucht nach einem Leben in Freiheit, nach einem Leben, in dem Liebe nicht durch versorgt sein ersetzt wird.
Doch auch in der Ferne findet der jüngere Bruder nur die käufliche Liebe, sodass schließlich nicht nur sein Geld alle ist, sondern er ist innerlich auch vollkommen ausgebrannt. Er ist leer und nun kann er mit frischem Wein gefüllt werden. Die Liebe seines Vaters wird ihm geschenkt, aber dafür muss er seinen älteren Bruder ertragen, der seinerseits erkennen muss, dass er sich die Liebe seines Vaters nicht verdienen kann, sie wird ihm geschenkt.
Schließlich beschäftigte Rubin noch die Frage nach der Gottessohnschaft Jesu und ihm fiel auf, dass die Kirche über vierhundert Jahre gebraucht hatte, um zu dem heute immer noch geltenden Dogma der Zwei-Naturen-Lehre zu gelangen. Bevor man sich auf diese Lehre durch die Unterscheidung zwischen Person und Hypostase einerseits, wodurch die Einheit ausgedrückt werden sollte, und dem Begriff der „Zwei Naturen“ andererseits, wodurch die Eigentümlichkeiten der beiden Naturen gewahrt werden sollten, einigen konnte, gab es sogenannte Irrlehren, die unter Begriffen wie Trennungschristologie, Monophysitismus und Vermischung der beiden Naturen Christi diskutiert wurden.
Das alles war nach Meinung von Rubin doch nichts weiter als Hirnfick, was ja nicht weiter schlimm gewesen wäre, wenn die Kirche sich nicht angemaßt hätte und immer noch anmaßte, die Menschen zu verdammen, die sich nicht der Überzeugung anschlossen, auf die sie sich nach über vierhundert Jahren des Streites geeinigt hatten. Der schlimmste Begriff, den die Kirche im fünften Jahrhundert einführte, war für Rubin der Begriff der „Gottesgebärerin“. Wer ungläubig fragte, wie kann ein Mensch denn Gott gebären, dem wurde immer wieder die Antwort gegeben, die die Kirche auf alle Fragen gibt, auf die sie keine Antwort hat: Geheimnis des Glaubens.
Aber das war für Rubin immer noch nicht das Allerschlimmste. Er wollte an einen Gott der Liebe glauben, einen Gott der unmenschlichen, himmlischen Liebe, die jedes menschliche Maß überstieg, denn das, was er in der Bergpredigt, insbesondere in den Seligpreisungen las, überstieg die Fähigkeiten des Menschen.
Liebet eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen.
Solange diese Feinde eine nicht definierte unbekannte Masse waren, lag darin überhaupt kein Problem, aber konnte eine Mutter einen Mann lieben, der ihre dreijährige Tochter vergewaltigt und ermordet hat? Das ist vollkommen unmöglich, zumal diese Mutter ihrer Tochter ja ein zweites Mal Gewalt antun würde, indem sie ihr die Ehre verweigert, ihren Mörder zu hassen und zu verurteilen. Nur bei Gott gibt es diese bedingungslose Liebe für alle Menschen.
Doch im Gegensatz dazu stand die monströse Behauptung der Kirche, dass ein Vater seinen Sohn abschlachten ließ, um die Menschen zu erlösen. Nie und nimmer würde ein Vater so etwas tun, und vor allem wollte Rubin nicht von einem Vater erlöst werden, der so grausame Dinge mit seinem Sohn machte. Er konnte und wollte nicht glauben, dass eine Frau Gott gebärt und nach kürzester Zeit Gott durch seinen eigenen Beschluss geschlachtet wird.
Nein, nein und nochmals nein. Für Rubin war die Liebe Gottes unendlich. Da wurde ein Mensch geschlachtet, weil die Menschen diese unendliche Liebe nicht ertragen konnten, weil für die Menschen ihre Ideologien schon immer wichtiger waren als Menschenleben. Die Liebe eines Vaters aber kennt keine Grenzen. Rubin war überzeugt, dass es ein Naturgesetz ist:
Väter geben, Söhne nehmen.
Schließlich wurde Rubin fündig; er fand seine Antwort bei Ludwig Feuerbach:
Der Mensch hat Gott nach seinem Ebenbild geschaffen.
Das war die Lösung, nun gab es für alles eine Erklärung: Die Gedanken Gottes sind die Gedanken des Menschen, anders ist es ja gar nicht möglich; und nun ging Rubin auch den letzten Schritt: Wenn der Mensch Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dann gab es ihn ja gar nicht wirklich, dann waren ja auch die vielen Gebote und Verbote und all die vielen angeblichen Sünden ja eine reine Festlegung des Menschen, mehr noch, eine Festlegung der Menschen, die es nicht ertragen konnten, dass andere Menschen glücklich waren, dass andere Menschen sich an Dingen erfreuten, die sie sich selbst ständig untersagten.
Endlich, endlich hatte Rubin einen Schuldigen gefunden; nicht er selbst war es, der zu schwach war, um sich an all die Gebote zu halten, er war kein Sünder; dies kam wie eine Erlösung über ihn. Es waren all die Menschen, die ihn mit diesen unmenschlichen Vorstellungen indoktriniert hatten. Gleichzeitig wurde ihm natürlich klar, dass er Jahre seines Lebens verschwendet hatte, indem er sich dem Leben verweigert hatte, indem er das ihm dargebotene Glück mit Füßen trat.
Zu dieser neuen Lebenseinstellung gehört vor allem, dass der Mensch sich so akzeptiert, wie er ist, mit all seinen Begabungen und Begrenzungen, mit all seinen Fähigkeiten und Schwächen, unter diesen Bedingungen wird er Sanftmut, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gegenüber sich selbst und seinen Mitmenschen üben. Er wird befähigt, mit den Trauernden zu weinen, mit den Armen zu teilen und mit den Verfolgten zu leiden. Er wird das Salz der Erde sein.
Wenn der Mensch diesen neuen Weg beschreitet, wird er ein zufriedenes und glückliches Leben führen, er wird das Himmelreich auf Erden erleben.