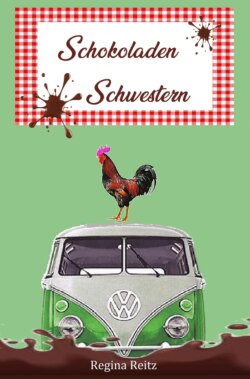Читать книгу Schokoladenschwestern - Regina Reitz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Kapitel
ОглавлениеNein! Ich will nicht! Lasst mich in Ruhe! Ich will nicht aufstehen und mich dem stellen, das sich mein verkorkstes Leben nennt. Lieber lasse ich mich gemeinsam mit einem Esel den Himalaja hinauf jagen und dabei würde ich sogar in Kauf nehmen, dass nicht ich diejenige bin, die auf einem Rücken getragen den Gipfel erreicht.
Ich war maßlos von mir enttäuscht und deshalb war ich, nachdem ich Matti in den Kindergarten gebracht hatte, wieder nach Hause geschlichen und unter die Decke gekrochen.
Meine Mutter interessierte mein Gefühlschaos jedoch herzlich wenig. Sie entschied, ob und wann ich ein Teil der Weltgemeinschaft war – und vor allem – ob ich daran liegend oder stehend teilnahm. Schimpfend betrat sie das kleine Gästezimmer, das ich nach Mattis Geburt bezogen hatte, damit er sich in meinem alten Kinderzimmer ausbreiten konnte.
„Pauline! Hast du dich etwa wieder hingelegt? Was sind denn das für Manieren, mitten am helllichten Tag? Los, komm jetzt! Wir müssen zum Einkaufen und das Auto müssen wir auch noch in der Werkstatt vorbeibringen. Wer weiß, wie lange das dauert! Und danach müssen wir Matti vom Kindergarten abholen.“
Resolut riss sie mir die Decke weg.
„Lieber Himmel! Du trägst ja deine Kleidung. Im Bett! Das habe ich dir nicht beigebracht. Nun, mir soll es recht sein. Umso schneller bist du fertig.“
Meine Mutter fragte nicht einmal, wie der vorangegangene Tag im Restaurant verlaufen war und sie würde sich auch die nächsten Stunden weigern, die sie so brennende Frage an mich zu richten, auch wenn die Hoffnung, dass ich dieses Mal Erfolg gehabt haben könnte, ihr Gesicht eine Weile verzaubern würde. Doch mit jeder Stunde, die verstrich, würde die Verzauberung von der Resignation zerfressen werden und ich war zu feige, meiner Mutter die Wahrheit sofort zu sagen, damit ihr Leiden ein schnelles Ende nahm.
Während des Einkaufs war ich deshalb so gesprächig wie eine Seegurke und auch in der Werkstatt blieb ich stumm.
Dafür quasselte meine Mutter umso mehr.
Der Meister, sichtlich genervt, grummelte vor sich hin.
„Meine Tochter hat ein ausgezeichnetes Abitur gemacht“, sagte meine Mutter plötzlich, weil sie sich mittlerweile ausmalen konnte, dass ich in Zukunft wohl nicht in dem Restaurant arbeiten würde. „So was kann man immer gebrauchen“, betonte sie mit einem vielsagenden Blick zum Werkstattbüro.
„Abitur?“, brummte der Meister. „Unsere Leute müssen anpacken können und nicht klugscheißen.“
Meine Mutter verzog beleidigt das Gesicht. „Sind die Scheibenwischblätter denn auch fachgerecht montiert?“, fragte sie schnippisch.
„Klar, das schafft unser Azubi ganz ohne Abitur“, entgegnete der Meister prompt.
Meine Mutter zog hörbar die Luft ein und verstummte nun ebenfalls. Mit versteinertem Gesicht bezahlte sie die Rechnung. Auf den Cent genau zählte sie die Münzen auf den Tresen und um den Meister zu ärgern, suchte sie dafür das letzte Kupfergeld aus ihrem Portemonnaie zusammen.
Nach diesem unerfreulichen Intermezzo holten wir Matti vom Kindergarten ab und fuhren nach Hause. Das Auto parkte noch nicht ganz in der Einfahrt, da erschien unsere Nachbarin Frau Barsch am Gartenzaun und winkte meine Mutter zu sich heran.
„Christa, meine Liebe. Wie gut, dass ich dich treffe!“, rief sie, wobei ihr Tonfall verriet, dass dieses Zusammentreffen lediglich für eine Person gut sein konnte und diese Person war mit Sicherheit nicht meine Mutter.
„Hallo Ingrid, schön dich zu sehen.“ Meine Mutter zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht, das so echt war wie ein 36-Euro-Schein und folgte dem herrischen Winken, blieb aber an der Hecke vor dem Zaun stehen.
„Hallo, Frau Barsch“, grüßte auch ich brav, erntete jedoch nur einen kurzen Blick und ein frostiges Nicken.
Seit ich so unverschämt gewesen war, meinen dicken Bauch mit einem gewissen Stolz durch die Nachbarschaft zu schieben und das, obwohl ich keinen entsprechenden Vater für die Frucht meines Leibes vorweisen konnte, war ich im Gefüge der nachbarschaftlichen Hierarchie auf der untersten Sprosse der Leiter angekommen. So jedenfalls sah es Frau Barsch. Selbst Manfred, der arbeitslose Alkoholiker, der sich in Familie Schneiders Einliegerwohnung eingenistet hatte und dessen Miete seit Jahren vom Sozialamt übernommen wurde, stand in Frau Barschs persönlichem Ranking über mir und das, obwohl er schon mal gegen die Hauswände pinkelte oder in einem der gepflegten Vorgärten zum Liegen kam, und es hin und wieder zwei starken Männern und eines Eimer kalten Wassers bedurfte, ihn zum Aufstehen zu bewegen.
Frau Barsch tat alles daran, dass meine Mutter nicht vergaß, dass ich meinen gesellschaftlichen Status mit der unehelichen Schwangerschaft in den Keller manövriert hatte, so als lebten wir noch in den 50er Jahren.
„Du Arme“, heuchelte sie in regelmäßigen Abständen, wobei sie auf die kleinste Regung im Gesicht meiner Mutter lauerte. „Wenn es wenigstens einen Versorger für den Jungen geben würde. Aber nein, so bleibt die ganze Last allein an dir hängen.“
Matti als Last zu bezeichnen war schon eine Bosheit an sich und dass ich mich nicht um meinen Sohn kümmern würde, davon konnte keine Rede sein. Schließlich brachte ich ihn jeden Tag in den Kindergarten, stand nachts auf, wenn er Bauchweh hatte oder übte mit ihm, Socken und Schuhe anzuziehen, aber das zählte anscheinend nicht.
Matti sprang aus dem Auto, ohne von Frau Barsch Notiz zu nehmen. Er war wirklich schlau und wusste seine kleine Kinderseele vor ihrer Boshaftigkeit zu schützen. Außerdem hatte er auf den von der Frühlingssonne erwärmten Steinplatten einen braunen Käfer entdeckt und dieser war wesentlich interessanter als Frau Barsch mit ihrer spitzen Zunge. Mit zappelnden Beinen lag das Krabbeltier auf dem Rücken und suchte vergeblich nach einem Grashalm, der ihm helfen würde, sich wieder aufzurichten. Matti hockte sich zu dem Käfer auf den Boden und sprach leise mit ihm.
Frau Barsch schielte an meiner Mutter vorbei zu Matti hinüber, während ich den Kofferraum öffnete, um die Einkäufe herauszuheben. „Wie schade, der Junge hat ja nichts von eurer Familie“, stichelte sie. „Wer weiß, warum der Vater sich immer noch nicht gemeldet hat. Vielleicht sitzt er im Gefängnis oder er hat sich eine schlimme Krankheit gefangen. Christa, ich kann dir nicht sagen, wie bedauerlich ich das finde. Ich bin nämlich nicht sicher, ob du es schon wusstest und es stimmt mich außerordentlich traurig, es dir zu sagen, doch es ist meine Pflicht, nicht wahr? Der Hang zu Kriminalität und zu Krankheiten vererbt sich bekanntlich immer auf die Kinder. Du hast aber auch ein Pech!“
Es interessierte Frau Barsch in keinster Weise, dass ich, aber vor allem Matti ihre Beleidigungen hören konnte. Vermutlich gab ihr unsere Anwesenheit den rechten Antrieb, sich die schlimmsten Gemeinheiten auszudenken und ich fühlte mich dem hilflosen Käfer sehr verbunden, dem Matti nun vorsichtig auf die Beine half, während ich gefühlsmäßig noch immer zappelnd auf dem Rücken lag.
Frau Barsch war wirklich eine dumme Schnepfe und leider gab es nichts, das man vor dieser Frau geheim halten konnte, weil sie in alles ihre spitze Nase stecken musste, und es war ein ausgesprochenes Pech, dass sie ausgerechnet neben uns wohnte. Warum besaß sie kein Haus am anderen Ende der Straße? Oder am anderen Ende der Stadt oder besser gleich auf einem anderen Kontinent, vorzugsweise Australien?
Durch diese unausweichliche Nähe genoss unsere Familie, allen voran meine Mutter, Frau Barschs zweifelhafte Aufmerksamkeit und wir hatten nur selten eine Verschnaufpause vor ihren Spitzelattacken.
Einen Herrn Barsch, der seine Frau an die Leine legen konnte, gab es leider nicht mehr. In der Nachbarschaft hielten sich hartnäckige Gerüchte, die Herrn Barschs plötzliches Verschwinden erklärten. Der Klassiker, er wäre vom abendlichen Zigaretten Holen nicht mehr zurückgekehrt, obwohl er bekennender Nichtraucher gewesen war, wurde nur von meiner favorisierten Variante übertroffen, Frau Barsch hätte ihren Mann wegen einer Lappalie, vielleicht ein nicht geschlossener Toilettendeckel, mit einer Bratpfanne erschlagen und ihn anschließend im Garten hinter dem Haus vergraben. Nur so war es zu erklären, warum das Grundstück seit Jahren unverändert blieb und der Boden lediglich von einem Rasen bedeckt wurde, und warum Frau Barsch regelmäßig Tobsuchtsanfälle bekam, wenn der Hund von Schneiders sich auf ihrem Grundstück verirrte und zu buddeln anfing. Interessanterweise grub der Hund nämlich stets an der gleichen Stelle, nämlich jene, die am weitesten vom Haus entfernt lag und wenn man ganz genau hinschaute, erhob sich eben an dieser Stelle ein kleiner Hügel, der besonders nachts fatale Ähnlichkeit mit einem Grab aufwies.
„Liebe Ingrid, du machst dir zu viele Gedanken. Matti ist völlig gesund. Leider habe ich nicht viel Zeit. Wir müssen nämlich die Einkäufe ins Haus bringen“, sagte meine Mutter, die nun ihre Hände dermaßen knetete, dass ihre Knöchel bereits weiß hervortraten.
„Ja, das müsst ihr wohl. Es ist aber auch immer eine Schlepperei bei euch. Wie bei den Zigeunern! Aber bevor du gehst, muss ich dir noch etwas sagen, liebe Christa.“
Fragend hob meine Mutter die Augenbrauen.
„So geht das nicht weiter!“, verkündete Frau Barsch und ihre Stimme driftete in dramatische Gefilde.
Ich fragte mich, was passiert sein könnte und spitzte die Ohren.
„Ist etwas nicht in Ordnung, Ingrid?“ Nun umklammerte meine Mutter ihre Hände so fest, dass man Sorge haben musste, sie könnte sich den ein oder anderen Finger brechen.
„Nein, ETWAS ist ganz und gar nicht in Ordnung! Du machst dir keine Vorstellungen, aber als ich heute morgen aus dem Haus getreten bin, habe ich meinen Augen nicht getraut.“
Etwas Weltbewegendes musste geschehen sein. Ein Elefant war über Frau Barschs unberührbaren Rasen marschiert und hatte einen riesigen Haufen hinterlassen oder Außerirdische waren auf dem Dach ihres Hauses gelandet. Schade, dass sie Frau Barsch nicht gleich mitgenommen hatten, um sadistische Versuche an ihr zu erproben, aber selbst den grünen Männchen würde Frau Barsch den Marsch blasen und ihnen sagen, was sie alles falsch machten und wie es besser ginge und, da war ich mir sicher, dass den Männchen Grün überhaupt nicht stand.
Nun suchte Frau Barsch in ihrer Jackentasche und zog schließlich etwas daraus hervor. Es war so klein, dass ich zwei Schritte näher herantreten musste, um es überhaupt erkennen zu können.
„DAS habe ich heute morgen direkt vor meiner Haustüre gefunden.“ Frau Barsch hob das Corpus Delicti anklagend in die Höhe. Es schimmerte in der Sonne, weiß, blau und rot und knisterte dabei leise.
War das etwa eine Kondomverpackung? Nein, wohl eher nicht. Es war nur ein Bonbonpapier.
Meine Mutter runzelte die Stirn. „Du meinst...“
„Ja!“, fiel Frau Barsch ihr ins Wort. „Das hat DEIN Enkel vor UNSERE Haustür geworfen. So eine Sauerei!“
„Matti war das nicht“, eilte ich meiner Mutter zur Hilfe. „Er hat überhaupt kein Bonbon von mir bekommen.“
Den Blick, den mir Frau Barsch daraufhin zuwarf, hatte die Macht, alle Ratten in Köln mit einen Schlag zu vernichten und wenn man bedenkt, dass Köln wieder zur Millionenstadt aufgestiegen ist und dass auf jeden Einwohner statistisch gesehen drei Ratten kommen, war das keine schlechte Leistung. Verständlicherweise zuckte ich vor diesem Blick zurück.
„Natürlich war er das! Wer sonst, außer ein Kind, würde diese Schokobonbons essen? Immerhin steht ja auch Kinder drauf.“ Dieser Argumentation war nichts entgegenzusetzen – zumindest vertrat Frau Barsch diese Ansicht.
Das Einfachste wäre gewesen, Matti direkt hinzuzuziehen, aber meine Mutter würde ihn niemals Frau Barschs inquisitorischen Fragen ausliefern.
„Entschuldigung, Ingrid. Ich werde mit Matti reden“, sagte meine Mutter und stellte sich schützend vor ihren Enkel, damit unsere Nachbarin nicht auf die Idee kam, ihn ins Verhör zu nehmen. „Das kommt nicht wieder vor.“
Wieso hielt es eigentlich niemand für möglich, dass der Wind das Papier vor Frau Barschs Haustüre geweht haben könnte oder dass ihr eigener Sohn der Missetäter war?
Jörg war zwar auch schon Ende Zwanzig, benahm sich aber immer noch wie zwölf, wozu er jedes Recht hatte, wie Frau Barsch nicht müde wurde zu betonen, denn immerhin war er ein Mann und die brauchten eben etwas länger, um sich von Mutters Schürze zu lösen. Das lag in ihrer Natur und eine bessere Frau als die eigene Mutter fand ein Mann ohnehin nicht. Wenigstens dann, wenn die Mutter Frau Barsch höchstpersönlich war.
Dabei hätte ich wetten können, dass Jörg vor allem deshalb keine Frau fand, weil er den dürren Hintern und die spitze Nase seiner Mutter geerbt hatte, aber mehr noch, weil er kleine Tiere quälte, was in der Nachbarschaft schon lange bekannt war, aber jemand sollte sich mal wagen, das Frau Barsch ins Gesicht zu sagen. Derjenige sollte schon im Vorfeld Kontakt zu den grünen Männchen aufnehmen, damit sie ihm halfen, auf den Mars zu entfliehen.
Meine Mutter trat den Rückzug an, doch so schnell ließ unsere Nachbarin sie nicht vom Haken.
„Reden allein hilft nicht, Christa. Du musst ihn für sein Verhalten bestrafen.“
„Bestrafen?“, protestierte ich. „Er hat doch nur ein Bonbonpapier auf den Boden geworfen und ich bezweifle, dass er es überhaupt gewesen ist!“
Den Blick, den Frau Barsch mir daraufhin zuwarf, eliminierte nicht nur alle Ratten, sondern die gesamte Kölner Mäusepopulation gleich mit und die niedlichen Häschen, die ahnungslos im Stadtwald über die Wiesen hoppelten.
„Christa, würdest du dich darum kümmern“, säuselte unsere Nachbarin nun und als meine Mutter nicht sofort reagierte, fügte sie hinzu: „Meine Liebe, es reicht doch vollkommen, wenn ein Mitglied eurer Familie vom rechten Weg abgekommen ist. Findest du nicht?“ Sie warf einen angewiderten Blick in meine Richtung.
Meine Mutter wechselte die Farbe von Rot zu Weiß. „Natürlich“, sagte sie leise.
„Christa, du musst strenger sein und aufpassen, dass es nicht noch mehr werden.“
Noch mehr werden? Wie meinte sie das und vor allem, wen meinte sie damit? Doch nicht etwa Matti? Ihr Vergleich erinnerte an einen, von Läusen befallenen Rosenstock, den man mit Pestiziden von den lästigen Plagegeistern befreien musste.
Ein harter Klumpen ballte sich in meinem Bauch zusammen und machte mir das Atmen schwer. Ich wollte Frau Barsch ins Gesicht sagen, was für eine hässliche, gemeine Kuh sie war, doch meine Mutter nahm mich bei der Hand und zog mich hinter sich her ins Haus.
Matti, der vom Krieg am Gartenzaun nichts mitbekommen hatte, trottete uns mit glücklichen Augen hinterher. In seiner geschlossenen Hand brummte es verdächtig.
Im Haus angekommen verschwand meine Mutter im oberen Badezimmer und war für die nächsten Minuten nicht mehr zu sehen.
Es tat mir leid, ihr solchen Kummer zu bereiten, deshalb hockte ich mich zu meinem Sohn und fasste ihn an den Schultern. „Du musst immer ganz lieb zu Oma sein, versprich mir das.“
Matti schaute mich mit großen Augen an. „Aber Mama, ich habe Oma doch immer lieb.“
„Ich weiß!“
„Hat Frau Barsch Oma geärgert?“
Ich nickte und staunte mal wieder darüber, wie klar ein Vierjähriger die Welt sehen konnte.
„Frau Barsch darf Oma nicht ärgern“, stellte er fest. „Sie ist ein Kakaschwein.“ Das war Mattis neustes Lieblingswort, welches er von seinem Freund Lukas im Kindergarten aufgeschnappt hatte. Zu Lukas Entschuldigung sollte man erwähnen, dass er vier ältere Brüder besaß und einen Vater der Fußballfanatiker war, vor dem selbst die Jugendtrainer Reißaus nahmen.
„Besser kann man es nicht sagen“, flüsterte ich verschwörerisch. „Sie ist ein Kakaschwein! Ein ganz gemeines Kakaschwein sogar!“
Matti kicherte. „Ich schenke Oma etwas, dann ist sie wieder fröhlich.“
„Das ist eine schöne Idee, mein Spatz, aber ich glaube kaum, dass ein Käfer sie aufmuntern wird.“ Ich tippte mit dem Finger auf Mattis brummende Hand.
„Nein, ich schenke Oma keinen Käfer. Den muss ich doch wieder freilassen. Ich male Oma ein Bild.“
„Oh, das ist natürlich etwas Anderes. Um nicht zu sagen, es ist eine fantastische Idee.“
Matti stürmte die Stufen hinauf und verschwand in seinem Zimmer.
Als meine Mutter endlich wieder aus dem Bad trat, wirkte sie beinahe wie immer, doch wenn man genau hinschaute, sah man, dass ihre Augen gerötet waren. Sie hatte tatsächlich geweint.
Ich fühlte mich schuldig, dabei saß die Schuldige im Haus nebenan und plante aller Wahrscheinlichkeit nach die nächste Gemeinheit gegen meine Mutter und unsere Familie. Dass jemand so viel Freude daran haben konnte, anderen Menschen weh zu tun, verstand ich nicht.
Ich schielte besorgt zu meiner Mutter, aber das ertrug sie erst recht nicht.
„Pauline, deck den Tisch!“, sagte sie streng. „Ich kümmere mich um das Mittagessen.“ Geschäftig stürzte sie sich auf die Töpfe, in denen das vorbereitete Essen darauf wartete, aufgewärmt zu werden.
Ich eilte zum Schrank, schnappte das Geschirr und deckte in Windeseile den Tisch. Die Teller drehte ich so, wie meine Mutter es am liebsten mochte, das Motiv geradeaus gerichtet, so dass ein aufmerksamer Beobachter es betrachten konnte, wenn nicht eine riesige Portion Gulasch die abgebildete Dorfidylle unter sich begrub. Messer und Gabeln legte ich im akkuraten Abstand zu den Tellern und die Gläser positionierte ich auf vierzehn Uhr. Jetzt suchte ich in den Schubladen sogar nach Servietten, die schönsten, die ich finden konnte und gab mir Mühe, sie so ordentlich wie möglich zu falten. Ich wollte alles richtig machen, damit meine Mutter wieder glücklich sein konnte und wenn dies mit einem perfekt gedeckten Tisch zu erreichen war, dann machte ich eben auch das.
Die Tür ging auf und mein Vater betrat den Flur. „Hallo! Jemand da?“, rief er gut gelaunt.
„Hallo“, sagte ich. Mir wurde direkt leichter ums Herz. Papa sah die Dinge immer viel lockerer als meine Mutter. Er war der Einzige, der sie jetzt noch aufmuntern konnte.
Meine Mutter jedoch schob meinen Vater stumm zur Seite und stellte die dampfenden Schüsseln auf den Tisch. Noch nicht einmal ihr obligatorisches Ludwig, geh deine Hände waschen, kam über ihre Lippen, dabei konnte Papa nun wirklich nichts dafür, dass Frau Barsch ein Kakaschwein war.
Mein Vater warf mir einen überraschten Blick zu.
Ich schüttelte den Kopf. Besser, niemand sprach mehr über die unschöne Szene am Gartenzaun.
„Ich geh dann mal meine Hände waschen?“ Papa machte einen Schritt vor und vergaß vor lauter Verwunderung, den Kopf einzuziehen. Hart prallte seine Stirn gegen die Dielenlampe. Er blieb unschlüssig stehen und schaute meine Mutter erwartungsvoll an. Als sie immer noch stumm blieb, hielt er es nicht mehr aus. Er machte einen Schritt auf sie zu und nahm sie in den Arm.
Für einen Moment lehnte meine Mutter ihren Kopf an seine Schulter.
Er küsste ihr Haar. Eine zärtliche Geste, die äußerst selten zu beobachten war, mich dafür aber umso mehr berührte.
Der Zauber verflog so schnell, wie er gekommen war. Resolut schob meine Mutter meinen Vater von sich. „Ludwig, geh deine Hände waschen!“
Mein Vater schaute zunächst verdutzt, dann nickte er erleichtert.
„Pauline, sag Matti, dass es Mittagessen gibt.“
Auch ich atmete auf.
Die Königin von Saba war zurückgekehrt.